Wallfahrten 4

Inhalt:
91. Maria Trost in Graz
92. Das Haus der Hl. Familie in Loreto
93. Unsere Liebe Frau von Seckau
94. Philippsdorf
95. Maria Elend in Straßgang bei Graz
96. Maria Einsiedeln in Ungarn
97. Maria Lankowitz in der Steiermark
98. Die "Zelle Mariens" in Niederwaldkirchen in Oberösterreich
99. Der Heilige Berg bei Görz
100. Die Wallerkapelle im Mühlbachgraben
101. Die Mutter Gottes vom guten Rat von Albanien
102. Bogenberg
103. Der Herz-Jesu-Berg bei Velburg i. d. Oberpfalz
104. Dorfen
105. Das Bistum Eichstätt 1845
106. Anaya – Ein Lourdes des Orients
107. Abtei Unserer Lieben Frau vom Wagnis
108. Pompeji als Wallfahrtsort
109. Die Mariahilf-Kapelle zu Eggenbach bei Döringstadt in Oberfranken
110. Die Wallfahrtskirche auf dem Fahrenberg in der Oberpfalz
111. Das Franziskaner-Kloster mit der marianischen Wallfahrtskirche oder Tilly-Kapelle in der Nähe von Freystadt in der Oberpfalz
112. Die Wallfahrtskirche U. L. F. zu Dettelbach in Unterfranken
113. Die Wallfahrtskapelle auf dem Kronberg bei Griesbach im Rottal: "U. L. F. vom Schutz"
114. Die Steinfels-Kapelle zu Landau an der Isar in Niederbayern
115. Die Wallfahrt Mariä Heimsuchung zu Langenwinkel bei Beuerbach in Niederbayern
116. Lechfeld, Wallfahrtskirche Mariahilf und Franziskaner-Kloster in Schwaben
117. Die St. Marienkirche zu Limbach in Unterfranken
118. Unsere Liebe Frau zu Schnals in Südtirol
119. Mariahilfberg bei Neumarkt in der Oberpfalz
120. Unsere Liebe Frau von Sasvár, deutsch: Maria Schlossberg, Basilika der Sieben Schmerzen Unserer Lieben Frau
_______________________________________________________________

Mutter Gottes, breit den Mantel – Deiner Liebe um uns aus,
Dass wir sicher sein und bleiben – Mach ein schützend Dach daraus.
Da die Feinde uns bedrängen, - Lass uns all darunterstehn,
Bis wir sehn in deinem Schutze – Die Gefahr vorübergehn.
(Auguste Poestion: „Kriegswallfahrt“)
Die schöne, weitbekannte Gnadenstätte Maria Trost bei Graz stand im Jahr 1914 im Zeichen des Jubiläums. Papst Pius X. hat mit Reskript der Kongregation S. officii dd. 31. Januar 1914 bewilligt, dass die Gläubigen, die innerhalb dieses Jahres die Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Trost besuchen und nach Empfang der heiligen Sakramente die üblichen Ablassgebete verrichten, einmal einen vollkommenen Ablass gewinnen können, der auch den Armen Seelen zugewendet werden kann. Auch wurde bewilligt, dass alle zugereisten Priester am Gnadenaltar die Votivmesse von Mariä Geburt lesen können, wenn nicht ein höherer Festtag gefeiert wird. Damit war das Maria Trost-Jubiläum eingeleitet, dem im September große Feierlichkeiten folgen sollten und wir Grazer Katholiken freuten uns schon sehr auf dieses schöne Jubelfest Unserer Lieben Frau draußen im waldumrauschten Gnadenort. Doch dies blieb ein schöner Traum!
Wie ein Sturmwind fegte plötzlich das Wort „Krieg!“ über alle Gebiete unseres weiten Landes, entflammte Begeisterung für Kaiser und Vaterland, für Recht und Pflicht, brachte aber auch namenloses Leid über die Völker.
Da stand auch unser Maria Trost im Zeichen des Krieges und wurde den Zurückbleibenden im wahrsten Sinne das, was sein Name ausdrückt: die Zuflucht der Verlassenen und Traurigen, die bei der himmlischen Mutter Trost suchen. Auch viele Soldaten kamen zum Abschied heraus, erbaten sich Kraft und Ausdauer zum schweren Kampf und legten ihr Geschick in Marias Hände.
Da zog von Graz unter Führung des Fürstbischofs Dr. Leopold Schuster am 27. September 1914 ein endlos langer Zug frommer Waller aller Stände nach Maria Trost. Keine Jubelprozession war es mehr, sondern eine mächtige Kriegswallfahrt erhebend und tief ergreifend in ihrer ernsten Bedeutung.
Und es zogen viele tausend
Fromme Pilger betend aus,
Dorthin, wo von freier Höhe
Ihnen winkt das Gotteshaus.
Bangen Herzens waren alle,
Von der Leiden Sturm umtost.
Doch schon legen sich die Stürme
Vor dem Wort: Maria Trost.
Aus den Wolken strahlt die Sonne
Auf der Beter große Schar,
Und ihr Schimmer leis umzittert
Dort das Bild am Hochaltar.
Es geschieht, was tausend Male
Schon geschah am heil`gen Ort:
Die in Schmerzen zu ihm kamen
Geh`n getröstet wieder fort.
(Auguste Poestion)
Bei 12.000 Personen füllten die Gnadenkirche und bedeckten den Kirchberg bis hinunter zu den Abhängen, flehten in inbrünstigem, heißem Gebet um Schutz im Krieg und erbaten sich bei der teuren Gnadenmutter die Vermittlung des Friedens. Diese große Prozession, verbunden mit der 200jährigen Jubiläumsfeier, gab zugleich Zeugnis von dem Vertrauen und der hohen Verehrung, die das Volk dem altberühmten Gnadenort entgegenbringt.
Seit 200 Jahren erhebt sich nun schon die majestätische, weiße Kirche mit ihren charakteristisch roten Türmen auf der freien, luftigen Höhe, weit ins Land hinausblickend und sich vom dunklen Hintergrund der wälderreichen Hügellandschaft wie eine leuchtende Blüte abhebend.
Der Ursprung des Gnadenortes reicht in ferne Zeiten zurück. Schon zur Zeit des Kreuzzugs gegen die Sarazenen soll hier eine Kirche gestanden sein. Viele der aus Palästina glücklich heimgekehrten Kreuzfahrer besuchten diese Kirche, in der sie ein Stück vom heiligen Kreuz verehrten, weshalb sie die heilige Kreuzkirche genannt wurde. Später errichtete man daneben eine Herberge für kranke Pilger und war nun dieser Ort weit und breit unter dem Namen bekannt: „Heiligkreuz zum Landestrost“. Mehr als 300 Jahre hielt diese Kirche vielen anstürmenden Feinden stand, bis sie 1480 von den Türken nach tapferer Gegenwehr erobert und durch Brand vernichtet wurde. – Das sogenannte „Landplagenbild“ an der Außenseite der Grazer Domkirche, ein kunsthistorisch höchst wertvolles und interessantes Freskengemälde, zeigt unter den „Landplagen“, von denen die Steiermark hart heimgesucht war, auch den Einbruch der Türken und die Erstürmung der von Ringmauern umgebenen Heiligenkreuzkirche.
Der kahle Berg, nun „Purberg“ genannt, kam in verschiedene Hände, bis 1676 Hans Freiherr von Wilfferstorf, der letzte des berühmten Geschlechtes, sich auf der Höhe ein Schlösschen erbaute. Als er einmal seinen im Zisterzienserstift Rein oder Graz lebenden Bruder besuchte, sah er in dessen Zelle eine hölzerne Muttergottesstatue mit dem Jesuskind auf dem Arm, die sein Wohlgefallen erweckte und ihm über seine Bitte überlassen wurde. Er brachte sie in seine Stadtwohnung nach Graz und als seine damals kranke Tochter auf die Fürbitte der Mutter Gottes gesund wurde, ließ der Freiherr am Purberg eine kleine Kapelle errichten, in der er die Madonnenstatue zur allgemeinen Verehrung aufstellte. Er befasste sich weiterhin mit dem Plan, die zerstörte Kirche wieder aufzubauen, starb jedoch noch ehe er zur Ausführung kam und erst im Jahr 1693 wurde unter Franz C. Canduzzi Edler von Heldenfeld, mit Unterstützung der Fürstin Karoline von Eggenberg, die Kapelle im Sinne von Wilfferstorf vergrößert. Die neue Kirche: „Maria zum Landestrost“ genoss bald einen weitverbreiteten Ruf, und als 1708 der Orden der Pauliner das Heiligtum übernahm, unter deren eifrigen Tätigkeit sich der Andrang der Gläubigen beständig mehrte, wurde beschlossen, die Kirche umzubauen und zu vergrößern. Es fanden sich bald viele Wohltäter, besonders unter dem steirischen Adel, deren größter aber war Kaiser Karl VI., unter dem am 18. Dezember 1714 Fürstbischof Graf Lamberg den Grundstein zur jetzigen Kirche weihte. Schon 1719 war der Bau zum großen Teil hergestellt, verzögerte sich aber in der Folge wegen Geldmangel und fand erst 1746 seine Vollendung. Die in vollkommener Symmetrie sich zu beiden Seiten der Kirche anschließenden Klostergebäude bilden mit ihr eine schöne, stattliche Front. Auf dem Hochaltar steht – gegenwärtig im reichsten elektrischen Lichterglanz – die liebliche Gnadenstatue, zu deren Füßen unzählige kummervolle Menschenherzen Hilfe und Trost suchen und auch finden. An den beiden ersten, der aus kostbarem Marmor verfertigten neun Seitenaltäre befinden sich Gemälde der berühmten italienischen Maler Giordano Luca und Tiapolo. Einen prächtigen Schmuck bilden die schönen Fresken von Maler Scheid. Sie wurden im Lauf der letzten Jahre restauriert oder besser gesagt, übermalt und geben nun dem Gotteshaus ein zwar farbenfrisches und festliches Gepräge, allein der Altertumsfreund wird mit Bedauern die verblassten, alten und darum umso interessanter wirkenden ursprünglichen Gemälde vermissen. Die Kirche ist in Kreuzform erbaut und wird von einer mächtigen Kuppel gekrönt. Unter dem Haupteingang befindet sich die alte Klostergruft, in der über 30 Pauliner in ihrer Ordenstracht ruhen.
In den zum Teil offenen Särgen kann man die merkwürdigerweise unverwesten, eingetrockneten Leichen der Mönche sehen. Leider wurde der Grufteingang von der Kirche aus im Jahr 1895 vermauert aus dem Grund, weil pietätlose Besucher in der Gruft Unfug trieben.
Ein ergreifend schönes Kapitel aus der steirischen Heimatgeschichte, das mit Maria Trost in innigstem Zusammenhang steht, möge hier Platz finden.
Im Jahr 1680 wütete in Granz die Pest in verheerendster Weise. In den Häusern, sogar auf den Straßen lagen die Toten, niemand wagte es, sie anzurühren. Die Stadt schien dem Aussterben nahe. Da machten sich unter Führung von Paul Menitzer 60 Taglöhner aus Graz auf und pilgerten zur neuen Kapelle Maria vom Landestrost. Dort empfingen sie mit großer Andacht die heiligen Sakramente, bereiteten sich auf einen nahen Tod vor und gelobten, sich dem Schutz Gottes und Mariens empfehlend, die Stadt vor dem Untergang zu retten. Nach Graz zurückgekehrt, begab sich Paul Menitzer zum Pestkommissar, dem Grafen Dietrichstein, und stellte sich ihm und seine Zunftgenossen zur Verfügung. Sie wollten die Leichen begraben, was sonst niemand um teures Geld getan hätte. Gerührt dankte der Graf dem edelmütigen Anerbieten und gab die nötigen Anordnungen. Also gleich machten sich die braven Taglöhner an die schreckliche Arbeit, luden die Toten auf Fuhrwägen und schafften sie eiligst fort, verbrannten die verpesteten Betten und gingen an die Säuberung der Stadt. Als sie sich am anderen Morgen, wie verabredet, wieder am Hauptplatz trafen, zählte Menitzer besorgt seine tapfere Schar. Doch, o Wunder!, alle waren vollzählig erschienen. Da sprach er unter Tränen: „Großer Gott, sei gelobt! Keiner ist verloren.“ Mutvoll begannen sie ihre schauerliche Tätigkeit von neuem, fanden sich tags darauf wieder alle insgesamt am Hauptplatz ein und setzten unter Gebet und Gottvertrauen die gefährliche Arbeit solange fort, bis die Seuche im Schwinden und die Stadt gerettet war. Sie waren alle wunderbarer Weise vom Tod verschont geblieben und pilgerten nun zur Danksagung nach Maria Trost, wohin sie eine alljährliche Wallfahrt gelobten. Diese hat sich bis auf unsere Zeit erhalten. Noch jetzt zieht jedes Jahr die Taglöhner-Bruderschaft in Prozession hinaus nach Maria Trost. Maria ist den Österreichern schon oft in schwerem Kampf beigestanden und verhalf ihnen zum Sieg. Als im Jahr 1683 die Türken vor Wien besiegt wurden, schrieb man dies der Fürbitte der Gottesmutter zu und führte als Danksagung das Fest Mariä Namen ein. Dieses Fest wird in Maria Trost als Patroziniumsfest gefeiert, darum ist unser Vertrauen zu Maria auch groß, sie wird uns wieder zum Sieg führen!
(A. Matura in „Ave Maria“ vom Januar 1915)
graz-wallfahrtskirche-mariatrost
_______________________________________________________________________

92. Das Haus der Hl. Familie in Loreto
Ein berühmter Wallfahrtsort
(Aus: Katholischer Digest, Mai 1958, Nr. 5, S. 23)
Loreto, in einer der fruchtbarsten Landschaften der italienischen Provinz Marche die Spitze eines Hügels krönend, ist eine malerische Stadt von besonderem Charakter, deren Leben sich rings um die berühmte Kathedrale abspielt, die die „Casa santa“, das Haus der Hl. Familie, enthält.
Die Überlieferung berichtet, dass das Haus der Heiligen Familie – in dem Maria geboren war, in dem sich das Geheimnis der Fleischwerdung vollzog und in dem Jesus nach der Rückkehr von der Flucht nach Ägypten bis zu seinem 30. Lebensjahr lebte – am 10. Mai 1291, als die Sarazenen in Palästina eindrangen, auf wunderbare Weise von Engeln auf den Tersalto-Hügel bei Fiume gebracht worden war. Alessandro di Giorgio, der Bischof der Stadt, und Niccolò Frangipane, der Gouverneur von Dalmatien, beschlossen, als sie die Kunde vernahmen, Beauftragte nach Palästina zu schicken, die nachforschen sollten, ob das geheimnisvolle Gebäude auch tatsächlich bisher in Nazareth gestanden habe. Als die Abgesandten zurückkehrten, berichteten sie, in Galiläa die Fundamente gesehen zu haben, auf denen das Haus gestanden habe, bevor es durch die Lüfte nach Dalmatien entführt worden sei.
Am 10. Dezember verschwand jedoch das Heilige Haus plötzlich und erschien auf der anderen Seite des Adriatischen Meeres, unweit Recanati, inmitten eines Ahornwaldes. Da die Gegend von Räubern unsicher gemacht wurde, trugen die Engel es erneut hinweg, und zwar etwa einen Kilometer weiter zum Bauernhof zweier Brüder namens Simon und Stephan, die jedoch bald wegen des Besitzes dieses Schatzes in Streit gerieten.
Zum vierten Mal verschwand das Heilige Haus auf wunderbare Weise durch die Lüfte und wurde mitten auf einer Landstraße an der Stelle niedergesetzt, wo es sich noch heute befindet. Die ständige Überlieferung der wunderbaren Versetzung dieses Hauses wird offiziell bestätigt durch den Bericht Don Bartolommeo Teramos, eines Mönchs von Vallombrosa, aus dem Jahr 1483, der die Zeugenaussagen von Leuten enthält, die zur Zeit des Wunders lebten. Rings um das Heilige Haus entstand der kleine Ort Santa Maria, und zur Zeit Papst Leos X. wurde die Burg mit ihrer Mauerumgürtung errichtet. Papst Sixtus V. machte Loreto zum Sitz eines Bischofs. Der gleiche Papst entwarf den Plan der Straßen von Borgo di Montereale, und alle Städte der Region Piceno mussten auf seinen Befehl dort je ein Haus errichten.
Die Kirche in ihrem heutigen Zustand geht auf Papst Paul II. zurück. Sie umschließt mit ihren Mauern das Heilige Haus. Der Name des ersten Baumeisters ist nicht bekannt, doch wissen wir, dass Giuliano de Miasso den Bau vollendete.
Im Jahr 1500 errichtete Giuliano da Sangallo nach Plänen Brunelleschis den herrlichen achteckigen Dom, und Bramante fügte 1511 die Pfeiler und Stützmauern hinzu. Der Entwurf der Fassade mit dem Turm an der Seite und den Arkaden und Loggien des Apostolischen Palastes wird von manchen ebenfalls Bramante zugeschrieben, während andere annehmen, dass er auf Giuliano da Sangallo zurückgeht.
Wenn wir auch keine vollständigen Unterlagen darüber besitzen, steht doch fest, dass das Hauptportal des Palastes von Sansovino begonnen und von Sangallo, Nerucci und Giovanni Boccolini fortgesetzt wurde. Das Innere der Kirche zeigt die schmucklosen Wände des kleinen Heiligen Hauses. Die aus dem Holz einer Libanonzeder geschnitzte Marienstatue ist eine Stiftung Papst Pius` XI., der sie segnete und krönte, bevor sie von Rom nach Loreto verbracht wurde.
Das Heiligtum vermittelt starke religiöse Eindrücke. Über dem Altar finden sich die Worte „Hic Verbum caro faktum ist“ (Hier ist das Wort Fleisch geworden) eingemeißelt. Sie erinnern daran, dass dies der Ort ist, an dem der Überlieferung nach der Gottessohn menschliche Gestalt annahm. Die in aller Welt bekannte Statue U. L. Frau ist in ein langes, kostbares Gewand gekleidet, das ihr besonderes Aussehen verleiht.
Seit den Tagen seiner wunderbaren Versetzung wurde das Heilige Haus von Loreto ununterbrochen von zahlreichen Pilgerscharen aus allen europäischen Ländern besucht. Jahrhundertelang ließ es sich kein König oder Heerführer nehmen, es aufzusuchen und dem Heiligtum reiche Gaben zu vermachen. Papst Benedikt XV. bestimmte U. L. Frau von Loreto zur Schutzpatronin der Flieger.
Um U. L. Frau von Loreto verbreitete sich der Ruhm zahlloser Wunder, und alljährlich besuchen noch heute riesige Scharen gläubiger Pilger das Heilige Haus. Wie nach Lourdes verkehren auch nach Loreto weiße Sonderzüge für Kranke. Die Pilgerfahrten finden besonders an den hohen Marienfesten statt: Mariä Verkündigung am 25. März, Mariä Himmelfahrt am 15. August, Mariä Geburt am 8. September, Fest der Unbefleckten Empfängnis am 8. Dezember sowie am Jahrestag der wunderbaren Versetzung des Heiligen Hauses, dem 10. Dezember.
Loreto ist eines der berühmtesten und gefeiertsten Heiligtümer der Christenheit. Seine Entstehung, die der Statue entgegengebrachte Verehrung sowie die jahrhundertelange Fortdauer der Wunder, die endlose Ströme von Pilgern – gesunden, kranken und bedrängten Menschen – anziehen, haben das kleine Städtchen zu einem Zentrum religiöser Verehrung gemacht.
________________________________________________________________________

93. Unsere Liebe Frau von Seckau
Ein Wallfahrtsort auf luftiger Höhe
(Von Anton Krenn, „Ave Maria“, Heft 1, 1913, S. 7)
Zwei Wegstunden von Knittelfeld, einem größeren Industrieort des oberen Murtales, entfernt, liegt auf bergenumrankter Hochebene die ehrwürdige Benediktinerabtei Seckau. Dieses Kloster, gleich ausgezeichnet durch den erbauenden Chorgesang der Mönche wie durch die tiefsinnige Marienverehrung, die dort so warm gepflogen wird, ist zu einer Gnadenstätte der seligsten Jungfrau auserkoren. Denn alle Sonntage ziehen die Mönche nach der Vesper in die Gnadenkapelle, wo ein wundertätiges Gnadenbild „Unsere Liebe Hausfrau von Seckau“ durch Gebet und Lied verehrt wird. Eine Nachbildung dieses Gnadenbildes befindet sich nun auch in dem schmucken Bergkirchlein auf der Hochalm, zu dem man in drei Stunden von Seckau aus leicht hinaufkommen kann. Die Hochalm ist ein Ausläufer eines größeren Gebirgsstockes und hat eine Höhe von 1816 Meter. Auf so hohem Bergeskamm thront schon seit über 350 Jahren die Königin des Himmels und der Erde, denn man schrieb den 10. Mai 1660, als man daranging, für die „Halter“, denn so bezeichnet man im Volksmund die Hirten, eine Kapelle zu errichten. Der damalige Stiftsprälat Maximilian Ernst von Glaispach gab selbst die Erlaubnis und die Mittel zur Erbauung des Marienheiligtums. Schon im Juli desselben Jahres war die Kapelle vollständig fertig gebaut und man gab ihr bei der Einweihung den Titel: Maria Schnee, jedenfalls deshalb, weil den größeren Teil des Jahres dort oben Schnee liegt. Das Kirchlein, das 20 Meter lang und 9 Meter breit ist, steht auf einem vorspringenden Bergesgipfel und diese kahlen Kapellenwände stechen passend ab von den grünbemoosten Steinen, die in Unordnung am Boden liegen. Im Jahr 1904 wurde auch ein gewaltiger Turm aufgeführt, in dessen unterstem Raum die Sakristei untergebracht ist. Sinnvoll weist dieser Turm auf hoher Bergeskuppe himmelan als ein Zeichen dafür, dass der eigentliche Thron der Gottesmutter droben im Himmel ist, wo sie als regina coeli et terrae an der Seite ihres göttlichen Sohnes immer fürbittend für die bedrängte Menschheit waltet. Im Jahr 1905 wurde der Hochaltar neu hergerichtet, der, grottenartig aufgebaut, in einer Felsnische das Gnadenbild „Unserer Lieben Hausfrau von Seckau“ birgt. Auf beiden Seiten stehen dann in kleineren Nischen die beiden Statuen des Heiligen Vaters Benediktus und des hl. Josef. Ein Seitenaltar ist dem heiligen Leonhard, dem Patron der Viehherden, geweiht. Auf diesen Altar sind schon an die 200 Weihegeschenke gelegt worden, die ob ihrer seltenen Ausführung einigermaßen Wert und Bedeutung haben. Diese ex voto-Geschenke sind nämlich aus Blech hergestellte Abbildungen von Tieren und stammen sicherlich schon aus dem 17. Jahrhundert. Schon von der ersten Zeit des Bestandes des Alpenkirchleins an pilgern bis auf den heutigen Tag alljährlich zahlreiche bedrängte Menschenkinder aus nah und fern zu dem Sitz der „Alpenkönigin“ hinauf, um bei ihr, die sie doch als die consolatrix afflictorum in der Lauretanischen Litanei gepriesen wird, Schutz, Hilfe und Tröstung zu suchen. Oft hat auch die Gnadenmutter von der Hochalm Beweise ihrer wundertätigen Hilfe gegeben. So kann man nach einem noch vorhandenen Votivbild entnehmen, dass der Chorherr P. Ferdinand Paumann auf die Fürbitte der Gottesmutter hin eine besessene Frau geheilt hat und als im Jahr 1714 die Pest in dieser Gegend wütete, war es nur dem wundertätigen Beistand der Gnadenmutter von der Hochalm zu danken, dass diese Seuche bald wieder aufhörte. Damals machte auch die Seckauer Gemeinde das Gelübde, alljährlich am Fest Mariä Heimsuchung auf die Hochalm zu wallfahren. Als aber im Jahr 1782 durch das Klosteraufhebungsedikt Josefs II. das Augustiner-Chorherrenstift Seckau auch geräumt werden musste, da trat nicht nur im Kloster zu Seckau, sondern auch in dem Hochalmkirchlein Verwaisung und Stille ein und traurig war es seither auf der Hochalm geworden und wo früher so oft im Jahr der fromme Gesang der Pilgerscharen zum Himmel emporstieg, hallte die ganze Gegend nur mehr von dem Blöken der Rinder wider. Etwas Leben herrschte später einmal auf der Hochalm, als der Fürstbischof von Seckau Graf von Attems im Jahr 1858 am 2. Juli im Beisein von nahezu 5000 Menschen eine heilige Messe zelebrierte und vier Jahre nachher, als man neun Tage hindurch das zweihundertjährige Jubiläum des Hochalmkirchleins feierte. Damals sollen an die 15.000 Menschen dieses so hoch gelegene Marienheiligtum besucht und 4000 auch die heiligen Sakramente der Buße und des Altares empfangen haben. Dann geriet dieser Wallfahrtsort wieder in Vergessenheit, bis im Jahr 1883 die Beuroner Benediktiner das alte, fast zerfallene Kloster wieder erneuerten und auch das Alpenkirchlein einer vollständigen Renovierung unterzogen und die Wallfahrten zur Gnadenmutter auf der Hochalm neu belebten. Im Jahr 1910 feierte man in prunkvoller, erhebender Weise das 250jährige Jubiläum des Bestandes des Hochalmkirchleins, zu welchem Fest von weit und breit die Pilger herbeiströmten. Wer je einmal Lust hat, auf hohem Bergesgipfel die Gottesmutter so recht vom Herzen zu verehren, der komme nach Seckau und steige auf die Hochalm hinauf und in kräftiger, würziger Bergesluft wird er nicht nur seinen Leib stärken, sondern auch seine Seele, die wieder Labung und Tröstung findet bei dem wundertätigen Gnadenbild Unserer Lieben Hausfrau von Seckau.
________________________________________________________________________


94. Philippsdorf
(Zum 50jährigen Jubiläum der Gnadenstätte 1916 – Von Josef Kunte)
Im nördlichsten Teil Böhmens und damit zugleich im nördlichsten Teil der ganzen Monarchie erhebt sich, von der Reichsgrenze gegen Sachsen nur einen Steinwurf weit entfernt, eine herrliche marianische Wallfahrtskirche romanischen Stiles, die Gnadenkirche von Philippsdorf.
Philippsdorf, nur zehn Minuten von zwei Bahnen entfernt, ist von Prag aus mit dem Schnellzug in wenigen Stunden, von Reichenberg oder Dresden aus in noch kürzerer Zeit zu erreichen.
Die marianische Gnadenstätte von Philippsdorf zählt zu den jüngsten und doch bereits zu den besuchtesten Wallfahrtsstätten unserer ganzen Monarchie. Am 13. Dezember 1916 werden es 50 Jahre, dass die Mittlerin der Gnaden einem armen Webermädchen namens Magdalena Kade erschien und es von einem nach dem übereinstimmenden Urteil der behandelnden Ärzte unheilbaren schweren Leiden plötzlich befreite. Magdalena Kade, geboren zu Philippsdorf am 5. Juni 1835, lebte nach dem frühzeitigen Tod ihrer Mutter unter der Hut ihres Vaters mit einem Brüder höchst zurückgezogen in einem kleinen Häuschen, das in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar 1866 der Schauplatz einer himmlischen Erscheinung werden sollte, durch die der Name der armen Weberstochter weithin bekannt wurde. Seit ihrem 19. Lebensjahr litt Magdalena an den Folgen eines Erschreckens. Zunächst von Krämpfen befallen, erkrankte das Mädchen in den folgenden zehn Jahren wiederholt an Lungen-, Rippenfell- und Gehirnhautentzündung so schwer, dass sie mehrere Male mit den Sterbesakramenten versehen werden musste. Seit Oktober 1864 war sie ganz ans Bett gefesselt. Im Februar 1865 traten heftige Brustschmerzen hinzu und es bildeten sich eiternde Blasen an der linken Seite des Oberkörpers, die sich dann über den ganzen Körper ausbreiteten und zu großen Geschwüren ausbildeten. Nach dem Urteil des sie behandelnden Arztes Doktor Ulbrich aus dem nahen Georgswalde und dem gleichen Parere des Arztes Gürlich aus dem protestantischen Neugersdorf war die Krankheit unheilbar.
In der Nacht vom 12. zum 13. Januar 1866 war der Zustand der mit großer Geduld und Hingebung an Gott Leidenden derart bedenklich, dass mit dem baldigen Ableben der stillen Dulderin gerechnet werden musste. In der Stube, in der Magdalena Kade im Bett lag, war als Pflegerin eine treue Person, Veronika Kindermann, anwesend, die mit der Schwerkranken zeitweise betete. Eben war Veronika für einige Minuten neben dem Bett auf der Ofenbank eingeschlummert, als die bei vollem Bewusstsein heftige Schmerzen Leidende plötzlich einer himmlischen Erscheinung gewürdigt wurde. Magdalena Kade selbst schilderte den wunderbaren Vorgang mit folgenden Worten:
„Auf einmal wurde es licht in der Stube, noch lichter als am Tag. Da erschrak ich und fing zu zittern und zu beben an. Ich stieß die Veronika mit dem Ellbogen und sprach zu ihr: Veronel, steh nur auf, siehst du nicht, wie es licht wird? Da sprang sie von der Ofenbank und fing mich zu halten an, sonst wäre ich vor Schreck und Zittern aus dem Bett gestürzt. Veronika sagte: Ich sehe ja nichts! Es wurde beim Bett, an seinem unteren Ende noch lichter und glänzender. Da stand am Ende des Bettes eine lichte, ganz weiß glänzende Gestalt, eine gelbe Krone auf dem Haupt, und ich dachte zugleich, dass dies die Mutter Gottes sei. Da sprach ich zu Veronika: Knie nur nieder! Siehst du nicht die Mutter Gottes da stehen? Sie hielt mich aber und kniete nicht nieder. Sie fing zu weinen an und ich mit ihr. Ich hielt mir beide Hände vor die Augen, weil diesen Glanz nicht gesunde, viel weniger kranke Augen ertragen konnten. Veronika nahm mir die Hände vom Gesicht weg und ich faltete sie und fing zu beten an: Hochpreiset meine Seele den Herrn und mein Geist frohlockt in Gott meinem Heiland! Nach diesen Worten hörte ich mit ungewöhnlicher, nicht menschlicher Stimme sprechen: Mein Kind, von jetzt an heilt`s! Und ich fühlte keinen Schmerz mehr. Darauf betete ich den angefangenen Lobgesang bis zu Ende und Veronika mit. Hierauf fragte ich die Veronika, ob sie nichts gesehen habe, was sie jedoch verneinte. Darauf forderte ich sie auf, sie möge die Angehörigen wecken. Sie entfernte sich und weckte den Bruder. Als er eintrat, rief ich ihm entgegen: Ich bin frisch, ich bin frisch! Darauf kam die Schwägerin und sie standen eine Weile und sie fingen an, mich zu trösten. Weil ich merkte, dass sie meinen Worten nicht glaubten, sagte ich: Nein, nein, die Mutter Gottes hat es gesagt. Als ich in ihren Gesichtern noch Misstrauen sah, nahm ich das Pflaster vor ihren Augen rasch ab. Auf dem Pflaster war besonders viel Eiter zu sehen, auf dem Leib aber keiner. Auf der Brust blieb eine Stelle, die lind und nässend war, in der Größe eines Pfennigs.“ Soweit Magdalenas eigene Worte.
Von dieser Stunde an war Magdalena so gesund, dass sie schon am nächsten Morgen die Arbeit aufgenommen hätte, wenn man es ihr erlaubt haben würde. Als der Arzt sie bald darauf untersuchte, bemerkte er staunend: „Das ist ein großes Wunder!“ Und zum Bruder der Geheilten sagte er: „Das bleibt mir ein Rätsel, so lange ich lebe!“ Eine kirchliche Untersuchung, die vom 7. bis 10. März 1866 dauerte und bei der die geheilte Kranke und alle Zeugen ihre Aussagen mit einem Eid bekräftigen, befreite die Geheilte von jedem Verdacht unredlichen Vorgehens. Magdalena führte bis zu ihrem erbaulichen Tod (10. Dezember 1905) ein ärmliches, abgehärtetes, frommes Leben, enthielt sich bis in die letzte Woche ihres Lebens jedes Fleischgenusses und verwendete das, was ihr geschenkt wurde, zum Bau der Gnadenkapelle (eingeweiht am 13. Januar 1873) und zur Verschönerung der herrlichen Kirche (konsekriert am 11. Oktober 1885 durch Bischof Dr. Em. Joh. Schöbel).
Kirche und Kapelle waren, wie bereits erwähnt, schon gegen Ende des abgelaufenen Jahrhunderts erbaut und zum größten Teil auch im Innern vollendet worden, doch verdankt der Wallfahrtsort auch dem neuen Jahrhundert manche Verschönerung und Erneuerung. So wurde im Jahr 1906 der imposante Hochaltar, der größte Schmuck der Gnadenkirche, herrlich zur Vollendung gebracht. Ein kunstsinniger Benediktiner-Laienbruder brachte die elektrische Beleuchtung in dem herrlichen Gotteshaus zur vollen Geltung. So zieren nun an Festtagen mehr als 800 elektrische Lämpchen den Hochaltar, während rund 500 solche Sterne den Lichterschmuck der Seitenaltäre bilden.
Ein wahres Schmuckkästchen ist die Gnadenkapelle, die an die Stelle der ersten, schon baufälligen Kapelle trat und nach Entwürfen eines Beuroner Künstlers mit herrlichen Deckengemälden geschmückt wurde. Auch diese Gnadenkapelle zieren 500 elektrische Glühlämpchen.
Was das Gebets- und Andachtsleben an der heiligen Stätte betrifft, so ist es von Jahr zu Jahr in größerer Steigerung begriffen. So betrug beispielsweise im Jahr 1900 die Zahl der empfangenen Kommunionen 36.200. Bis zum Jahr 1909 hatte sie sich auf 60.000 vermehrt, also nahezu verdoppelt. Auch die Zahl der Prozessionen wächst noch immer an.
Unmittelbar neben dem stattlichen Mariendom liegt das Kloster der Redemptoristen, die seit ihrer Berufung in diesen Gnadenort unermüdlich nicht nur auf der Kanzel, und in den Beichtstühlen dieser Kirche tätig sind, sondern auch durch Abhaltung von Exerzitien für Geistliche, Lehrer, Studenten, Frauen und Jungfrauen, durch Abhaltung von Volksmissionen an zahlreichen Orten des weiten Deutschböhmens und durch Förderung des katholischen Vereinswesens seit Jahrzehnten viel dazu beigetragen haben, dass auch auf dem harten Boden Nordböhmens das religiöse Leben an vielen Orten neu zu sprossen beginnt.
Wenn ich als Laie mir ein Urteil über die Zukunft dieses Gnadenortes erlauben darf, dann geht es dahin, dass Philippsdorf, dessen Fremdenzuzug ich seit fast 30 Jahren in etwa zu beobachten Gelegenheit hatte, noch lange nicht auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung angelangt ist. Bezeichnend ist, dass die Gnadenstätte schon seit Jahrzehnten besonders von Katholiken aus dem Deutschen Reich, Deutschen wie Wenden, darunter vielen Angehörigen der Intelligenzberufe, oft besucht wird, während Österreichs Katholiken erst in neuerer Zeit in größerer Anzahl erkennen, welch reichen Schatz sie an dem Sanktuarium in Philippsdorf besitzen. Dass in den trauten, herrlichen Räumen dieser Kirche auch so mancher Protestant in den Schoß der Mutterkirche aufgenommen wurde, sei nur nebenher erwähnt.
basilika-minor-der-jungfrau-maria-helferin-der-christen
_______________________________________________________________________

95. Maria Elend in Straßgang bei Graz
(aus: „Ave Maria“, Heft 1, Januar 1916)
Die romantische Umgebung der schönen Landeshaupstadt Graz weist mehrere altberühmte und vielbesuchte Marien-Gnadenorte auf, von denen unser großes, weit und breit bekanntes Maria Trost, das idyllische Waldkirchlein Maria Grün, das reizende, mittelalterliche Straßengel und die schöne Gnadenkirche von Fernitz bereits bekannt sind.
Eine andere altbekannte Gnadenstätte, von Graz aus in einer Wegstunde erreichbar, haben wir in der Haupt- und Dekanatspfarrkirche in Straßgang, die sich auf dem südlichen Ausläufer, der sich im Westen der Stadt hinziehenden Hügelkette erhebt und das weite Grazerfeld beherrscht. Ein herrlicher Rundblick über Graz und Umgebung erschließt sich dem Beschauer von der traulichen Höhe, an deren Fuß sich das Dorf ausbreitet.
Die Kirche „zur heiligen Maria im Elend“ ist ihres hohen Alters wegen interessant und vom frommen Volk viel verehrt, das in mannigfaltigen Schicksalsschlägen gerne seine Zuflucht bei Maria Elend sucht. Sie wurde bereits 1140 erbaut, doch Urkunden melden, dass schon im Jahr 1074 hier eine dem heiligen Georg geweihten Kirche bestand. In den Jahren 1130 bis 1140 erbaute ein Pfarrer von Feldkirchen in Straßgang eine neue Kirche zu Ehren Mariä Himmelfahrt und Erzbischof Konrad I. von Salzburg übertrug 1140 die Pfarre mit allen Rechten einer Mutter- und Hauptkirche von Feldkirchen nach „Straßgauch“. Im Jahr 1460 (1461) wurde die schon fast baufällig gewordene Kirche durch die Brüder Reichsritter Hans und Georg von Gradner erneut und vergrößert, und zwar „zur schuldigen Danksagung der von ihnen wider die Türken erhaltenen Vittori“. Leider wurde im Laufe der Zeit durch mehrfache Erneuerungen und Zubauten der gotische Stil der Kirche beeinträchtigt.
Interessant ist das alte Altarbild in Holzrelief, das die Himmelskönigin mit dem Jesuskind am Arm darstellt, während Engel den ausgebreiteten Mantel halten, unter dem Betende und Bittende aus allen Ständen ihre Zuflucht suchen. Dieses Gnadenbild scheint ebenfalls von den beiden Brüdern Ritter von Gradner gespendet worden zu sein, da sich vordem in der alten Marienkirche am Hochaltar ein Gemälde von Weißkircher – Mariä Himmelfahrt –, das noch gegenwärtig in der Kirche zu sehen ist, befand. Interessant ist ferner eine Familie Christi von Holz aus dem 15. Jahrhundert, dann das an der Evangelienseite des Hauptaltares angebrachte Denkmal des Erbauers Georg Ritter von Gradner, der (1476) mit seiner Familie unter dem Gnadenaltar begraben liegt. Durch die Bemühungen des jetzigen Dechants und Hauptpfarrers Hochwürden Markus Perl wurde das Innere der Kirche schön restauriert, wozu die Pfarrangehörigen und Bewohner der Umgebung und von Graz beisteuerten. Auch Se. Majestät der Kaiser, als Patron der Kirche, spendete einen Betrag.
Unter den zahlreichen Wallfahrern, die seit altersher voll Vertrauen hierher pilgerten, befanden sich auch Kaiser Karl V., Kaiserin Christine, Erzherzog Karl II. von Innerösterreich und dessen so fromme Gemahlin Maria, Herzogin von Bayern, die alle häufig nach Straßgang kamen.
Seit 1401 hat man die ununterbrochene Reihe der Pfarrer und Vorsteher dieser Kirche, von denen jene von 1685 bis 1786 zugleich Erzpriester waren. Einer von ihnen war Franz Philipp Graf von Inzaghi (1758 – 1759), der hierauf Bischof von Görz wurde.
Von größtem Interesse sind einige Römersteine an der Außenseite der Kirchmauer, und zwar zwei Reliefs mit je drei und vier Köpfen und eines mit Jupiterkopf und zwei Löwen, ferner einen romanischen Denkstein mit der Inschrift: NAMMONIA . MATER . I . V . F . SIBI . ET . C . SEMPRONIO . SECUNDINO . MAR . D . SOL . ET . C . SEMPRO . SECUNDINO . FIL . LIBR . COS . AN . XVIII ., „nach welchem es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Decurius Solvensis in Straßgang einen Landsitz hatte, wie es den Anschein hat an der Stelle des jetzigen Pfarrhofes, wenn er nicht gar der nordwestliche Trakt desselben war“.
Verklungene Zeiten tauchen vor unseren geistigen Blicken auf. Wir sehen die mächtige Römerstadt emportauchen, das alte Flavium Solvense, und wir sehen es dann in Schutt und Trümmer sinken. – Die Pflugschar zog ihre Narben über den historischen Boden. –
Da brauste der Schlachtruf durchs weite Reich, und während unsere Helden in monatelangem Ringen das Vaterland verteidigten, rüstete sich unser „Freund“ und Bundesgenosse zum Verrat. – Und auf dem weiten Leibnitzerfeld, dort wo im Altertum die Flavia Solva gestanden hatte, tauchte eine neue Stadt auf: das Flüchtlingslager unserer österreichischen Italiener, der stammverwandten Nachkommen der alten Romanen . . .
_______________________________________________________________________

96. Maria Einsiedeln in Ungarn
Wer kennt nicht die hochberühmte Wallfahrt Maria Einsiedeln, die, gehütet und gepflegt von den Söhnen des heiligen Benedikt, in den Schweizer Bergen mit ihren hochragenden Türmen steht und jährlich von ungezählten Tausenden von Pilgern besucht wird.
Wir ziehen, o Mutter der Gnade,
Zu deinem hochheiligen Bild,
O lenke der Wanderer Pfade,
Erhöre, Maria, sie mild!
Auch Ungarn, in dem Marienliebe und Marienkult seit Jahrhunderten und Jahrtausenden blüht, auch das marianische Königreich Ungarn hat sein Maria Einsiedeln. Es liegt bei Hidegkut im Pester Komitat, in der Diözese Stuhlweißenburg.
Katharina Tolwitzer übersiedelte aus der Schweiz nach Ungarn und brachte als teures Andenken von der Wallfahrt Maria Einsiedeln ein Gnadenbild der dortigen Wallfahrt mit sich. Dieses Bild hing sie auf einem Baum im Wald auf und oft dahin ihre Schritte, um dort ihre Andacht zu verrichten. Viele folgten ihrem Beispiel, besonders als sich die Nachricht verbreitete, dass dort eine Frau aus Ofen vor dem Gnadenbild ihr Augenlicht wiedererlangt hatte und sonst viele Wunder geschehen. In Kürze war über dem Bild eine aus Holz gezimmerte Kirche errichtet, der bald eine gemauerte Kapelle folgte, in der dreimal wöchentlich durch den Seelsorger von Hidegkut eine heilige Messe gelesen wurde. Die Kirchweihfeier fand am Tag Mariä Geburt daselbst statt.
Da aber der Zudrang der Wallfahrer immer mehr wuchs, erwies sich die Kirche zu klein, und so beschloss der 1879 gegründete „Maria-Einsiedeln-Kapellenverein“, eine neue Kirche zu bauen.
Im Jahr 1898 wurde mit dem Bau einer großen, schönen Kirche begonnen, die anfangs kleiner berechnet, schließlich in großen Dimensionen ausgebaut wurde. Die Kosten beliefen sich auf 200.000 Kronen. Das neue Gotteshaus, im gotischen Stil erbaut, durch 15 Fenster erleuchtet, macht einen außerordentlich freundlichen Eindruck, eine echt marianische Gnadenkirche. Die innere Länge beträgt 44, die Breite 15 Meter, nebst dem Hochaltar schmücken noch zwei Seitenaltäre die Kirche, die auch eine Lourdeskapelle besitzt. Vom Turm, der, 54 Meter hoch, weit die Umgebung beherrscht, künden vier mächtige Glocken Gottes Lob und der Unbefleckten Ehre.
Die Einweihung der Kirche fand in feierlichster Weise am 1. Oktober 1899 statt und wurde vom Bischof Doktor Philipp Steiner von Stuhlweißenburg vorgenommen, der in Begleitung zweier itularbischöfe, zweier Domherren, des Abtdomherrn Dr. Barady, des Abtpfarrers Dr. Nemes etc., und im Geleit von 10.000 Menschen erschienen war. Der Bischof trug in feierlicher Prozession das Gnadenbild zuerst um die Kirche, dann durch die große Pforte in das Innere, wo er es an jenem Baum wieder befestigte, an dem es seit Jahren hing. Tiefergreifend war die Predigt des Oberhirten vom Hauptportal aus. Nach der heiligen Messe vollzog Bischof Steiner die Wiedereinsegnung der Ehe des größten Wohltäters der Kirche, der durch seine Tatkraft in erster Linie den Kirchenbau zustande brachte, des Kirchenbauvereinsobmannes Anton von Szentkiralyi und seiner Gattin Emilie geb. Igler, die an diesem Tag ihr Silbernes Hochzeitsjubiläum feierten, allseits beglückwünscht von hoch und nieder, arm und reich.
17 Jahre sind seit der Einweihung (1899/1916) der Kirche vorübergegangen. Maria Einsiedeln aber, der wunderbare Magnet für fromme, marienliebende Herzen, hat seine Anziehungskraft nicht verloren. Nur der Allmächtige weiß allein, wie viele Gnaden Tausende und aber Tausende Pilger, die jährlich hinauswallen zum ungarischen Gnadenbild der Schweizer Mutter Gottes, dort erlangt haben, wie viele Tränen des Dankes in dieser Kirche geflossen sind. Noch heute hängt das Bild auf dem Baum droben, wo es die fromme Frau dereinst aufgehangen, die es aus der Schweiz gebracht hatte. Die ganze Wallfahrt aber ist ein Baum des Segens geworden für die Umgebung, die Hauptstadt Budapest und das ganze marianische Königreich Ungarn. Mögen besonders die Gebete Unzähliger zur Mutter Gottes um das kostbare Gut des Friedens Erhörung finden. Möge sie, die den Feinden Gottes und der christlichen Sache „furchtbar ist wie ein geordnetes Schlachtheer“, Österreich-Ungarns Völker zum Sieg führen und ihnen beim König des Friedens, ihrem göttlichen Sohn, das kostbarste Gut des Weltfriedens erbitten! Maria Einsiedeln, bitte für uns!
(aus: „Ave Maria“ Heft 2, Februar 1916)
________________________________________________________________________

97. Maria Lankowitz in der Steiermark
(aus: „Ave Maria“, Heft 2, 1916, von A. Reif)
Es haben ihre Lieder viel Sänger dir geweiht,
Sie singen immer wieder von deiner Herrlichkeit.
(Auguste Pöstion)
Unter den vielen steirischen Gnadenstätten nimmt in der westlichen Steiermark der altberühmte Wallfahrtsort Maria Lankowitz im romantischen, burggekrönten Kainachtal eine hervorragende Stelle ein. Aus nah und fern kommen alljährlich zahlreiche Marienverehrer hierher gepilgert, um der Gnadenmutter ihre Liebe zu bezeigen und im frommen Vertrauen Gnaden zu erbitten. Über die Herkunft der hölzernen, der Mariazeller Mutter ähnlichen Madonnenstatue, die aus dem 11. oder 12. Jahrhundert zu stammen scheint, erzählt die Legende das Folgende:
Bis zum Jahr 1426 befand sich diese Statue in der Pfarrkirche des nächst der Stadt Radkersburg in Steiermark gelegenen ungarischen Dorfes Wert, wo es hoch verehrt wurde. Beim Einfall der Türken im selben Jahr wurde die reichgeschmückte Marienstatue nebst anderen Schätzen von ihnen geraubt und nachdem sie ihr alles Kostbare wegnahmen, warfen sie das nur mit einem Kleidchen – das noch in der Schatzkammer von Lankowitz gezeigt wird – angetane Madonnenbild in ein Dorngestrüpp, woselbst es durch sieben Jahre verborgen lag. Eines Tages (1433) traf ein in jener Gegend weidender Hirte einen Teil seiner Herde vor jenem Gebüsch auf den Knien. Es gelang ihm nicht, die Tiere davon wegzubringen, und so untersuchte er den Dornbusch, in dem er zu seiner größten Freude die Marienstatue entdeckte.
Seine Anstrengungen, sie hervorzubringen, waren jedoch vergeblich, und auch der von ihm herbeigerufene Pfarrer, der das „Liebfrauenbild“ gleich wieder an seinen früheren Ort in der Kirche zurücktragen wollte, vermochte nicht, es wegzubringen. Es gelang ihm nur, es aus dem Gebüsch zu heben. Er lud es daher auf einen Karren, der mit zweien der knienden Ochsen bespannt wurde. Doch sie wollten nicht zum Dorf fahren und, als auch Anwendung von Gewalt nichts half, ließ man den Tieren freien Lauf, die zum größten Leid der Dorfbewohner, die ihr „Liebfrauenbild“ gerne wieder zurückbekommen hätten, sich immer weiter entfernten und nach Steiermark hineinfuhren. Drei Tage lang fuhren sie unaufhaltsam ohne Futter und ohne Anleitung längs der Mur und der Kainach entlang bis zum Dorf Lankowitz unterhalb der Stubalpe, wo sie bei der Dorflinde, an der ein Bild des Heilands angebracht war, Halt machten und nicht mehr weiterwollten. Man hielt dies für ein besonderes Zeichen und brachte die Marienstatue an dieser Linde an, woselbst sie mehrere Jahre verblieb. Bald verbreitete sich der Ruf von der wunderbaren Mutter Gottes und der Andrang des frommen Volkes wurde zusehends größer, so dass Kaiser Sigismund eine Kapelle errichten ließ.
Im Jahr 1446 erbaute der Schlossherr von Lankowitz, Georg Ritter von Gradner, mit Bewilligung Kaiser Friedrichs IV. eine Kirche samt Kloster, die 1468 eingeweiht wurde, und die Franziskaner bezogen das Kloster. – Kaiser Friedrich III. (auch der IV. genannt) nahm bei seinen häufigen Jagden in dieser Gegend im Kloster Wohnung. Noch hängt vor seiner einstigen Zelle sein Bild und eine Aufschrift trägt die Worte: „Sacristissimi et invictissimi Romanorum Imperatoris Friderici IV. cubiculum.“
In der Zeit der Reformation kamen auch über das Heiligtum von Lankowitz traurige Tage. 1566 wurden die Franziskaner von den protestantischen Ständen vertrieben, die Kirche geplündert und entweiht. Mit der Gnadenstatue trieb man seinen Spott und die Gemahlin Amalia Christophs von Kainach soll an ihm schwer gesündigt haben. Sie lästerte es, riss es vom Altar, zerbrach es an mehreren Stellen und zerstach das Antlitz mit Nadeln. Doch diesem Frevel folgte eine schreckliche Strafe. Die Unglückliche wurde gleich darauf von einer grausamen Krankheit befallen, der sie unter vielen Qualen erlag.
Endlich 1588, unter der Regierung Herzog Karls II., der sich der katholischen Religion annahm, wurde auch die Gnadenkirche aus ihrer Verwahrlosung errettet. Die Franziskaner konnten wieder zurückkehren und nahmen sich gleich mit Eifer der Wiederinstandsetzung von Kirche und Kloster an, und so nahmen auch die Wallfahrten rasch wieder zu. Auch der fromme Kaiser Ferdinand II. kam öfter nach Lankowitz.
Da in der Folge der Andrang zur Gnadenstätte immer größer wurde, die Kirche ihm aber nicht entsprach, ging man 1681 daran, sie umzubauen, wozu Johann Seyfried Fürst von Eggenberg das Meiste beitrug und auch den prächtigen Hochaltar errichten ließ, woselbst das Gnadenbild schon 1684 feierlichst übertragen werden konnte. Verschiedene Wunder trugen das Ihre zur Verbreitung des Rufes, den der Gnadenort erlangte, bei und Papst Klemens XII. verlieh auf immerwährende Zeiten allen Pilgern, die hierher kommen, einen vollkommenen Ablass. Im Jahr 1786 erhob Josef II. Lankowitz zur Pfarre. – Mehrfache herbe Schicksalsschläge brachten es dahin, dass der Gnadenort später allmählich in Vergessenheit geriet, bis er im vorigen Jahrhundert (19. Jhd.) durch den unermüdlichen Eifer des Franziskaner-Provinzials P. Antonius Ortner (+ 1828) wieder neu erblühte.
Die ganze Gegend von Voitsberg, Köflach und Lankowitz birgt ein mächtiges Kohlenlager, in dem die schönsten Steinkohlen vorkommen.
Das Lankowitzer Kohlenlager, das seit 1772 in Betrieb ist, brachte den Gnadenort bereits in höchste Gefahr. Darüber berichten uns mehrere Artikel des „Grazer Volksblatt“ vom Jahr 1868, nach denen der im Jahr vorher ausgebrochene unterirdische Steinkohlenbrand immer größere Dimensionen annahm und auch in einen Stollen geriet, der „in nächster Nähe von der Wallfahrtskirche zur hl. Maria von der Gnaden in Lankowitz vorbeigeht“. Dadurch waren Kirche und Kloster aufs höchste gefährdet. Es dauerte aber ein Jahr, bis nach mehrmaligen kommissionellen Untersuchungen und langweiligen Unterhandlungen endlich energisch an die Eindämmung und Erstickung des Feuers geschritten wurde.
So war denn die Gefahr für den Gnadenort „auf dem brennenden Vulkan“ glücklich beseitigt und neue Scharen zogen nach dem freundlichen, blütengeschmückten Markt mit seinem trauten Heiligtum.
________________________________________________________________________

98. Die "Zelle Mariens" in Niederwaldkirchen in Oberösterreich
(Von A. Aichberger, August 1916)
Niederwaldkirchen, im schönen Tal des Pesenbaches gelegen, ist eine der ältesten Pfarr- und Mutterkirchen des oberen Mühlviertels und hatte hier, von der Donau bis zum Böhmerwald reichend, viele Pfarren zu Tochterkirchen. Die Pfarre Niederwaldkirchen ist ein Geschenk des Grafen Eppo von Windberg. Kaiser Heinrich V. hat diese Schenkung ans Stift St. Florian bestätigt (1109). Das geht hervor aus der Konfirmationsurkunde des Bischofs Udalrikus von Passau (1111), in der Niederwaldkirchen als eine zum Kloster St. Florian gerhörige Kirche bezeichnet wird. Diese Schenkung des Grafen Eppo wurde 1478 auf die Mauer der Kirche gemalt.
Das Gemälde stellte die Schenkung und Übergabe der Pfarre vom Grafen Eppo an den damaligen Prälaten Isembert von St. Florian vor. Dieses Gemälde erhielt sich bis zum Jahr 1807. In diesem Jahr ließ Pfarrer Josef Wiesmayr die Kirche ausweißen und auch dieses Gemälde mit Kalk übertünchen.
Im Jahr 1113 wird Niederwaldkirchen „cella S. Mariä“ (Zelle der Mutter Gottes) in „Waltkirchen“ und im Jahr 1122 als „eclesia conventualis“ (Konventkirche) für die in der dortigen Gegend wirkenden Missionare genannt. Die früher hier bestandene „U.L.Frauen-Bruderschaft“ oder „Frauenzeche“ besaß 1469 bis 1490 bedeutende Güter. Eppo von Windberg, der kinderlos starb, setzte, nach Pritz, das Stift St. Florian zu seinem Erben ein. Er war auch der Erbauer der ersten Kirche zu Ehren des Geheimnisses „Mariä Himmelfahrt“.
Die jetzige Kirche ist im frühgotischen Stil erbaut, und zwar zugleich mit der auf der Epistelseite sich befindenden, sogenannten „Blasius-Kapelle“, die gegenwärtig sich als „Beichtkapelle“ sehr praktisch erweist. Die Rippen der Gewölbe sowohl im Presbyterium als im Schiff der Kirche sind in reiner Kreuzform ausgeführt. Die ursprünglichen Maßwerke der Fenster wurden im Lauf der Zeit entfernt, , wie dies ja in so vielen Kirchen geschah. Im Jahr 1881 aber wurden aus schönem Margaretenstein wieder gotische Maßwerke eingefügt. Im Jahr 1906 wurde die Kirche im Innern vollständig restauriert. Einen besonderen Schmuck der Kirche bildet der Hochaltar (neu vergoldet und gefasst im Jahr 1907) mit prachtvoller, reicher Bildhauerarbeit, die Himmelskönigin mit dem Jesuskind auf dem Schoß darstellend. Die übrigen drei Altäre und die Kanzel sind neu und im gotischen Stil gehalten. Eine neue Orgel mit 14 klingenden Stimmen trägt zur Verherrlichung des Gottesdienstes bei.
Die ältesten Pfarrer, die in der Chronik Erwähnung finden, sind Rudgerus, Ludovikus und Heinrikus, alle drei vor dem Jahr 1316. Der erste Pfarrer, der als „Pfarrer von Waldkirchen“ genannt wird, ist Albertus von Aschach (1316 bis 1330). Die Matriken reichen zurück in das Jahr 1612 und sind sämtlich vom Pfarrer Jakob Livius (1612 bis 1613 und 1616 bis 1650), von dem ein sehr schönes Porträt im Pfarrhof aufbewahrt wird.
In früherer Zeit war Niederwaldkirchen ein vielbesuchter Wallfahrtsort. Die vielen Gasthäuser in der Nähe der Kirche sind heute noch die Überreste aus jener Zeit. Doch ist die Liebe zur Mutter Gottes und ihre eifrige Verehrung in der Pfarre durchaus nicht erloschen. Am 2. Mai 1915 fand in sehr feierlicher Weise die Gründung einer marianischen „Jungfrauen-Kongregation“ statt, wobei 60 Sodalinnen aufgenommen wurden. Durch eine „Jugendsektion“ mit 40 Mitgliedern ist reichlich für den notwendigen Nachwuchs gesorgt.
Seit jeher ist der Empfang der heiligen Sakramente in der Pfarre ein eifriger, aber besonders im Jahr 1915, wo die Zahl von 20.000 Kommunikanten erreicht wurde. Der Krieg mit seinem Jammer und die Kongregation haben das Ihrige dazu beigetragen. Auch das übrige Vereinswesen blüht. Da verdient vor allem die „Armenseelen-Bruderschaft genannt zu werden mit zirka 1400 Mitgliedern, darunter viele auch aus den Nachbarpfarren.
Eine Zierde des Ortes bildet der schöne und große, auf der Nordseite der Kirche gelegene Pfarrhof, der in der Zeit von 1730 bis 1735 erbaut wurde.
________________________________________________________________________

Der Held vom Heiligen Berg
(A. Reif, „Ave Maria“, Heft 12, 1916, S. 263)
Es schritt ein Ritter durchs brennende Land,
Der Ritter der seligsten Minne,
Und trug in den Armen durch Feuer und Brand
Seine himmlische Königine.
Er trug vom rauchenden Bergaltar,
Vom zerschossenen Heiligtume,
Geborgen im flammenumwehten Talar,
Des Heiligen Berges Blume.
(Adele Billitzer)
In der Reihe der altberühmten und beliebtesten Wallfahrtsorte nimmt unstreitig der Heilige Berg (Monte Santo) bei Görz eine hervorragende Stelle ein. Er ist im Süden Österreichs der berühmteste und größte Gnadenort, der alljährlich von vielen Tausenden frommen Pilgern aus dem Görzer Land, aus Triest und Istrien, aus Krain, Kärnten, dem italienischen Friaul, von Venetien, und wohl auch noch von weiter her besucht wurde, und unbegrenzt war im Volk das Vertrauen und die Verehrung zur lieblichen Madonna vom Heiligen Berg.
Der einfache, aus massigen Quadersteinen aufgeführte Bau der sehr großen, altertümlichen Kirche wirkte mit ihrem viereckigen, einem Wartturm gleichenden Glockenturm beinahe wie ein altes Höhenschloss, das weit in die Lande hinein und über das Meer hinaus schaute. Und diese Hochburg des christlichen Glaubens und frommer Marienverehrung schmückte Gott mit den wunderbarsten Schätzen der Natur. So oft ich das Glück hatte, auf dem Monte Santo verweilen zu können und von dort oben in die weite Herrlichkeit schaute, die sich vor meinen Blicken ausbreitete, musste ich der Worte des Dichters gedenken:
Herrlichstes der Meisterwerke:
Buch Natur, nimm meinen Dank!
Gabst so oft mir Trost und Stärke,
Kraft, wenn mir der Mut entsank.
In dies Buch hat Gott geschrieben,
- Als er schloss das Paradies -
Sein Erbarmen und sein Lieben.
Menschenkind, o nimm und lies!
(Friedrich Pesendorfer)
Da kam plötzlich für das Stille, friedliche Isonzoland eine furchtbar schwere Zeit, die die kaisertreuen Bewohner mit Schrecken erfüllte: der kommende Krieg mit dem ungetreuen Nachbar. – Ungezählte Scharen erstiegen da den 684 Meter hohen Monte Santo, um bei ihrer teuren Madonna Schutz und Hilfe zu suchen. Doch es war mehr ein allgemeines Abschiednehmen von der Lieben Frau am Heiligen Berg, die den armen Menschenkindern Trost und Stärke mitgab für die bittere Leidenszeit, die ihrer harrte, denn Gott ließ es zu, dass der Krieg ausbrach. Da verließ ein großer Teil der Bevölkerung schweren Herzens die Heimat und die Gottesmutter vom Heiligen Berg schloss sich ihnen an.
Die Franziskaner, die das Heiligtum betreuten, hatten den Befehl erhalten, das Kloster zu verlassen, dem sie am Pfingstdienstag 1915 nachkamen. Sie nahmen das kostbare Gnadenbild mit sich und übergaben es zunächst dem Kuraten von Gargaro zur einstweiligen Aufbewahrung. Kurz danach fuhr P. Franz Ambroz, einer der Mönche vom Gnadenort, mit dem Muttergottesbild im Automobil nach Santa Lucie bei Tolmein, von wo er es mittelst Bahn nach Laibach ins dortige Franziskanerkloster in Sicherheit brachte. P. Franz rastete nun nicht eher, bis er die Erlaubnis zum Aufenthalt auf dem Heiligen Berg erhielt; damit begann für den unerschrockenen Priester die Zeit des Heldentums. Fünf schwere Monate hielt er dort oben aus und verließ den Heiligen Berg erst dann, als das Kloster samt Heiligtum fast gänzlich zerstört war und sich für ihn gegen die herannahende Winterkälte kein schützendes Obdach mehr bot.
In seinen schriftlichen Aufzeichnungen heißt es unter anderem: „Schon am 6. Juni wurde mir meine Wohnung, eine Klosterzelle, durch eine italienische Granate zerstört; die zweite vernichteten die Flammen, aus der dritten verdrängte mich das durch die durchschossene Decke strömende Wasser, aus der vierten blies der Luftdruck einer schweren Granatexplosion Fenster und Türen hinaus. Trotzdem hielt ich, von Gott beschützt, aus und wappnete mich nach Möglichkeit gegen Granaten, Flammen, Nässe und Ratten. Am 25. Oktober blieb aber die Kälte Sieger. Ich musste dem Heiligen Berg Lebewohl sagen. Diese Zeilen habe ich niedergeschrieben, damit die frommen Pilger erkennen, dass wir nicht feige und unverlässliche Wächter des Heiligtums gewesen sind, die sich bei der ersten Gefahr aus dem Staube machten. Als wir gingen, da war es ein unerbittliches „Muss“, das uns zwang. Ich selbst ging aber erst, als kaum noch etwas zum Bewachen übriggeblieben war, denn ich musste noch vor dem 25. Oktober die furchtbare Zerstörung des Heiligtums mitansehen.“
Während seines langen Ausharrens auf dem Heiligen Berg kam er öfter herunter, um seine Mitbrüder vom Görzer Franziskanerkloster Kostanjevica (Castagnavizza) aufzusuchen, die ihn in begreiflicher Weise immer mit unendlicher Freude empfingen. Von dem auf einem Hügel isoliert stehenden Kloster aus ließ sich der Heilige Berg gut überblicken und so konnten die Mönche die schrecklichen Vorgänge am Wallfahrtsort ziemlich deutlich beobachten. Der Guardian des Görzer Klosters, Hochwürden P. Vinzenz Kunstelj, schildert in einer biographischen Skizze des P. Franz die Herzensangst, die sie um das bedrohte Heiligtum und ihren treuen Mitbruder ausgestanden haben, wenn es oben gerade schlimm zuging. Einmal befürchteten sie ernstlich, P. Franz werde nicht wiederkehren. Dies war am Sonnwendabend 1915, wo ein dichter Rauch aus dem Heiligen-Berg-Kloster himmelan stieg, dem mächtige Feuergarben folgten. „O, wie traurig, wie furchtbar war jener Abend für uns!“, schreibt P. Vinzenz. „Und nicht nur für uns – weit und breit im Küstenland sah man das Feuer vom Heiligen Berg und überall zitterten die guten Herzen in Furcht um das berühmte Heiligtum.“
Und wie mag es erst dem P. Franz zu Herzen gegangen sein, dessen Liebe zum Heiligen Berg besonders groß war. Er musste es mitansehen, wie der Feind alles vernichtete, was menschlicher Fleiß und fromme Verehrung durch Jahrhunderte geschaffen hatten. P. Franz fürchtete nicht um sein Leben und hielt tapfer im schrecklichen Feuer aus. Es ist ihm auch wunderbarerweise nichts geschehen und er verblieb weiter auf den Ruinen ein treuer Wächter, versuchte sogar auszubessern und zu verstopfen, was er konnte. Bei karger Nahrung, die er sich des Nachts heraufholte – auch diese hatte er nicht immer –, hielt er oben aus, las im Donner der Geschütze die heilige Messe, und als ihm auch des zur Unmöglichkeit wurde, stieg er wöchentlich den Berg hinab, um an Sonntagen im Dorf Gargaro das heilige Messopfer darzubringen und dem dortigen Seelsorger, Josef Godnic – auch einem jener stillen Helden – auszuhelfen. Die Soldaten, die er auf seinen Wegen traf, kannten ihn alle und wussten ihn zu schätzen. Trotz des großen Kummers und der vielen Bitternisse war P. Franz liebenswürdig und mitteilsam und eine wunderbare Kraft ging von ihm aus, die alle neu belebte und ermutigte. Als die ersten Granaten ins Görzer Kloster einschlugen, gab er seinen Mitbürgern gute Ratschläge und munterte sie auf, und als ihm das Verweilen am Heiligen Berg unmöglich wurde, zog er zu ihnen. Doch auch hier wurde die Beschießung immer heftiger und schließlich war der P. Guardian gezwungen, den größten Teil der Insassen seines Klosters nach Krain abgehen zu lassen. Er schildert uns in seinem Aufsatz die traurige Stunde, da sie am 21. November 1915 im Refektorium versammelt waren und voll Weh im Herzen von ihrem geliebten P. Franz Abschied nahmen. Es war ein Abschiednehmen zeitlich für immer!
Bald darauf übersiedelte auch P. Franz in die Stadt zu den Barmherzigen Brüdern, wo er sich als freiwilliger Pfleger in aufopfernder Weise am Samariterdienst betätigte.
Doch auch von hier aus, wie früher von Kostanjevica, wanderte er manche Nacht hinauf auf seinen geliebten Heiligen Berg, „zu dem es ihn mit geheimnisvoller Kraft hinaufzuziehen schien“.
Zum letzten Mal war er am St. Josefs-Tag oben, am 19. März 1916. Ergreifend ist seine Beschreibung jener Wallfahrt. Er schien zu ahnen, dass er seine irdische Aufgabe bald erfüllt haben werde, und drückte in einem Brief an den hochwürdigen P. Provinzial den Wunsch aus, am Heiligen Berg begraben zu werden.
Was seit langem zu befürchten war, hat sich am 11. April 1916 ereignet. P. Franz weilte gerade in seinem Zimmer im Barmherzigen-Spital und betete sein Brevier, als eine Granate vor seiner Tür explodierte und ihm durch deren Splitter so schwere Wunden beigebracht wurden, dass er am 13. April darauf verschied. Man fand den Abdruck eines Fingers tief im Brevier eingedrückt. So endete der fromme, heldenmütige Ordensmann sein außergewöhnliches Leben. Sicher hat die himmlische Frau, deren Heiligtum er auf Erden so treu behütet hat, ihn an der Pforte der Ewigkeit voll Liebe empfangen . . .
Mit militärischen Ehren hat man ihn begraben. Soldaten trugen seine Leiche in dunkler Nacht auf den Heiligen Berg und der General, zu dessen Front der Heilige Berg gehört, gab ihm mit einigen Offizieren das Geleit. Oben begruben sie ihn andächtig um 11 Uhr nachts, am 15. April.
P. Franz war ein echter Held! Dies hat auch das Militärkommando bestätigt. Es wurde nämlich ein Buch herausgegeben mit einer Abbildung der Helden unserer Isonzofront und inmitten dieser Helden befindet sich der Heldenpriester P. Franz. Der Kommandant der Isonzoarmee gab dem Buch mit den inhaltsreichen Worten das Geleit: „Seine unvergleichlichen Helden an der Isonzofront grüßt auch auf diesem Weg Boroevic, G.d.I.“
P. Franz wurde nach dem Tod von Sr. Majestät mit dem Ritterkreuz des Franz-Josef-Ordens mit der Kriegsdekoration ausgezeichnet.
Was P. Franz in diesen zehn Kriegsmonaten inmitten des Kampfgebietes mit unermüdlicher Ausdauer, Geduld und Tatkraft geleistet hat, übersteigt hundertfach das, was andere durch viele Jahre getan haben. Sein Name bleibt für alle Zeiten mit dem Heiligen Berg verbunden. Und wenn das geliebte Heiligtum aus seinen Trümmern wieder neu erstehen wird, werden die frommen Pilger voll Dankbarkeit und Verehrung auch das Grab des seligen P. Franz aufsuchen und noch nach vielen Generationen wird man voll heiliger Ehrfurcht von den Taten dieses heldenhaften Mönches erzählen.
Er starb in verhältnismäßig noch jungen Jahren, war am 2. Dezember 1874 in St. Martin bei Krainburg (Krain) geboren, trat am 25. August 1894 in den Orden des heiligen Franziskus und empfing am 30. Oktober 1898 die Priesterweihe. Seine Mitbrüder bestätigen, dass der Selige das Muster eines guten Ordensmannes war. Er war ein beliebter Prediger und Beichtvater und tüchtiger Katechet. Auch besaß er eine umfassende Sprachenkenntnis, die in den Gegenden seiner Ordensprovinz so notwendig ist. So war er überall an seinem Platz, am meisten aber in der jetzigen Kriegszeit, wo er sich als ganzer Held bewies.
Du trugst deine Herrin durch Flammen und Glut,
Hast die heilige Feste gehalten
Und siegeltest treulich mit deinem Blut
Des barmherzigen Heldentums Walten.
Du bist gestorben fürs Vaterland
Als Held auf der Liebe Felde.
Nun kröne dich, Ritter im Priestergewand,
Deiner Königin himmlische Sälde!
(Adele Billitzer)
In der schönen Franziskanerkirche in Laibach hat Unsere Liebe Frau vom Heiligen Berg während der Kriegsdauer eine schützende Heimstätte gefunden. Dort wurde das Gnadenbild am Altar des heiligen Deodatus zur öffentlichen Verehrung ausgestellt und seitdem kommen ungezählte Menschenkinder, um die Mutter Gottes vom Heiligen Berg aufzusuchen. Besonders sind es die Flüchtlinge aus dem Görzer Land, die ihr vieles Leid ihrer teuren Mutter klagen und die zu ihren Füßen ein Stück Heimat wiederfanden.
Die Madonna, die auf dem prachtvollen Hochaltar am Heiligen Berg als liebreizende Königin, mit kostbarem Geschmeide geschmückt, thronte, ist gegenwärtig allen Schmuckes entblößt. Auch die Kronen wurden dem Gnadenbild abgenommen, da die Mutter Gottes als Flüchtende in Laibach weilt und man auf der Flucht alle Kostbarkeiten ablegt.
Das Bildnis ist auf Zedernholz von Künstlerhand gemalt und wurde im Jahr 1544 vom Patriarchen Markus Grimani von Aquileja dem 1539 entstandenen und bereits in wenigen Jahren zu hohem Ansehen gelangten Wallfahrtsort geschenkt. Am 6. Juni 1717 hat man das Gnadenbild feierlich gekrönt und soll daher 1917 das 200jährige Krönungsjubiläum begangen werden. Möge uns der Allmächtige zu diesem Fest wieder friedliche Tage verleihen und die Liebe Frau am Heiligen Berg bald wieder ihren Thron aufschlagen, denn die Worte aus der Heiligen Schrift, die am Eingang ihres Heiligtums zu lesen waren: „Ego autem steti in monte sicurt prius“ – „Ich aber blieb am Berg stehen wie früher“ – werden ihre Bedeutung auf immerwährende Zeiten behalten.
________________________________________________________________________

100. Die Wallerkapelle im Mühlbachgraben
Von Josef Harter
Dort, wo das Mühlbachtal erbreitend endet, saftige Berghalden je zum murmelnden Bach niedersteigen, steht auf wild zerklüftetem Felsblock malerisch und stimmungsvoll eine Kapelle, wie sie nur des Dichters Traum und des Malers Phantasie ersinnen kann – die Wallerkapelle, wie Schiller jenes Kirchlein im Gedicht „Der Kampf mit dem Drachen“ schildert:
„Das Kirchlein kennst du, Herr, das hoch
Auf eines Felsenberges Joch,
Der weit die Insel überschauet,
Des Meisters kühner Geist erbauet.
Verächtlich scheint es, arm und klein
Doch ein Mirakel schließt es ein,
Die Mutter mit dem Jesusknaben,
Den die drei Könige begaben.
Auf dreimal dreißig Stufen steigt
Der Pilgrim nach der steilen Höhe,
Doch hat er schwindelnd sie erreicht,
Erquickt ihn seines Heilands Nähe.“
Noch kühner ist die Höhe der Wallerkapelle, denn zu ihr führen den Pilgrim 230 Stufen. Auch sie beherbergt ein Bild der gnadenreichen Mutter mit dem göttlichen Kind. Längs steinerner, halsbrecherischer Stufen, deren Steinmetz die Wucht des Mühlbaches war, reihen sich die vierzehn Kreuzwegstationen an, gemauerte Marterl, bedeckt von Satteldächern und versehen mit tiefen Nischen, die gemalte Bilder bergen, die in liebevoller und eindringlicher Sprache erzählen, wie vom schöngesäulten Gerichtshof des Pilatus das Gotteslamm den Todesweg zu Golgathas Höhe machte, wie es unter der Last des Sündenholzes zusammensank, wie ihm Nägel ins Fleisch drangen, wie es verblutete, vom Opferstamm abgenommen und ins Felsgrab Josef von Ramathaims gebettet wurde. Dort schaut man eine kleine, natürliche Felshöhle, in der Christi Leiche gelegt, dargestellt ist. Eine steingemeißelte Treppe von wenigen Stufen führt zur Kapelle, deren Schlüssel der jeweilige Besitzer des Wallergutes hat und selben gern dem Besucher ausfolgt. Stark verwitterte Holztür, gehängt an rostigen Angeln, knarrt und der Pilger sieht rückwärts schlichten Eisengitters das Bild der Gnadenvollen mit dem Kind.
Vor dem Kirchlein sind beidseits holzgezimmerte Bänke, um von schwindelnder Höhe ins träumende, schlangengewundene Mühlbachtal zu schauen und zum Schauer dringen der frohen Kinderschar liebliche Weisen, der sich Uhlands stimmungsvollen Gedichtes erinnert:
„Droben stehet die Kapelle,
Schauet still ins Tal hinab,
Drunten singt bei Wies und Quelle
Froh und hell der Hirtenknab!“
Am Fuß der steilen Höhe beschatten Obstbäume das Wallergut, dessen Eigentum die Kapelle ist und ihr den Namen gab, nachdem dessen Besitzer, Leopold Brandecker, um die Mitte vorigen Jahrhunderts selbe aus französischem Kriegsgeld erbaute, das einer seiner Vorgänger im Besitz des Gutes, namens Georg Eizenberger, 1805 nach dem Abzug der Franzosen auf dem Heimweg an der Eisenstraße in der sogenannten „Freising“, unterhalb des schmucken Dorfes Sankt Ulrich, in einem eisenbeschlagenen Kästchen fand, das eine zurückgelassene Regimentskasse war, die beim Rückzugsgefecht verloren oder vergessen wurde. Er trug es in sein Gehöft und plante mit dem Geld zu Ehren der Himmelskönigin eine Kapelle zu bauen. Doch sowohl er als sein Nachfolger führten den Plan nicht aus. Erst Leopold Brandecker um die Mitte des 19. Jahrhunderts begann mit dem Bau und schleppte durch vier Jahre den Großteil des Materials zur schwindelnden Höhe. Ob Eizenberger bereits den Fels als Bauplatz der Kapelle ausersah oder ob die Idee von Brandecker stammte, ist ebenso unbekannt als der Umstand, weshalb nicht Eizenberger die Kapelle erbaute. Nach vierjähriger, emsiger Arbeit war die Kapelle vollendet, so dass sie 1854 geweiht werden konnte. Fünf Jahre später wurde der Kreuzweg fertiggestellt, der vom Fuß des Felsens bis zur Kapelle geleitet.
Von der Kapelle zieht sich gegen die Lausa die wildzerklüftete, stellenweise 30 bis 40 Meter hohe, steile Wallermauer, die zum Schellhammergehöft (Mühlbachgraben Nr. 23, Gemeinde und Pfarre Garsten) gehört, ein stattliches Haus mit Sgraffitos aus 1630, wie die Jahrzahl an einer Außenmauer besagt. Der Tram der großen Stube weist die Jahrzahl 1690 auf. Am Fuß der Wallermauer wurden vor zirka 30 Jahren gleich deren Umgebung Werkzeuge aus Serpentin gefunden, welche Funde auf prähistorische Ansiedelungen schließen.
Urkundlich scheint der Mühlbachgraben erstmals auf, als 1360 der reiche Steyrer Bürger Jakob Kündler starb und dem Benediktinerstift Garsten „dem gotshaus ze Gaersten daz guet in dem graben im Muelpach da der Weber auffsitzt, ist viertzig phenning geltz zwen metzen chorns ain schaf habern segchs huener zwen ches dreizzig ayer also, daz ein abbt daselbz dem pharrer ze Steyer davon ierlich schol raihen sybentzichg phenning, daz mir der darvmb bege einen iartag nach seiner gewizzen.“ Der Pfarre „Sand Gyligen ze Styer“ verschaffte er „daz guetel im Muelpach da fridel der Muellner auffsitzt, daz dient zwen und achtzig phenning zehen metzen habern zwen metzen chorns ain lamp acht huener vier ches sechtzich ayer, daz schol der zehmaister daselbz inne haben.“
Bis in die Tage, als „der Großvater die Großmutter nahm“, pochten in einförmigem Takt die Hämmer der Nagelschmiede. Berußte Meister und Gesellen sangen trotz harter Arbeit lustige weisen. Fortschreitender Kulturgeist und fabrikmäßige Erzeugung der Nägel verstummten meist Hämmerschlag und fröhlichen Gesang. Müde schwerer Arbeit und harten Loses, enteilten die meisten dem lieblichen Tal und fluteten zur Stadt, wo ihnen günstigere Aussichten winkten, welche selbe wohl geldlich befriedigten, doch das Herz unzufrieden machten. „Viele sind berufen, wenige auserwählt“ zur Zufriedenheit, die ihrem angestammten Gewerbe trotz hohler Mammonslockungen treu blieben, Seelenfrieden und Zufriedenheit inmitten hastigen Drängens moderner, zerfallender Zeit retteten. So tönt dem Wanderer, der das einsame, friedenatmende Tal durchzieht, nur mehr aus wenigen Häuschen der einförmige Klang der Hämmer ans Ohr und durch die berußten, breiten und niedlichen Fenster schimmert Essenfeuer. Leider hat die Zeit, in der „Volk wider Volk, Reich wider Reich“ (Mt 24,7) aufstand und Europa ins Flammenzeichen des Krieges setzte, selbst den letzten Hauch des Friedens und der Zufriedenheit geraubt und ins träumende Tal wie in manche Hütte Wehklagen und Trauer getragen.
Erwähnt sei, dass das Wallergut ebenfalls Nagelschmiede war und diese Gewerbler in freien Stunden schnitzten und Krippen anfertigten, die vollendete Werke unverfälschter Volkskunst sind.
Nur mit bitterem Weh vertieft man sich in längst verrauschte, glückliche und zufriedene Tage und gleich einem Märchen aus sonnigen Kindertagen dünkt es einem, denn leider gilt es auch hier zu sagen: „Es war einmal . . .“
________________________________________________________________________

101. Die Mutter Gottes vom guten Rat von Albanien
Es war im Jahr 1467. Die türkischen Horden überschwemmten den Balkan, überall zerstörend, mordend und sengend. Ihrem wilden Ungestüm vermochte niemand mehr zu widerstehen. Der tapfere Albaner, Georg Skanderbeg, „das Schwert der Christenheit“, „der christliche Gedeon“ genannt, hatte in der Zitadelle von Alessio schon seine Augen zur ewigen Ruhe geschlossen. Gegen die Türken hatte sich nur noch die Stadt Skutari zu halten vermocht. Lange trotzten die tapferen Einwohner der feindlichen Übermacht. Doch ihre Zahl war schließlich zu gering, um gegen die stets neu heranflutenden Türken standhalten zu können.
In dieser Stadt befand sich nun das Heiligtum Unserer Lieben Frau vom guten Rat, am Fuß der alten Festung gelegen. Hier bei Maria hatten die bedrängten Christen Hilfe gesucht in ihrer Not und Bedrängnis. Doch die göttliche Vorsehung hatte harte Schicksale über das bedrängte Albanien beschlossen.
Es war am 25. April, am St. Markustag. Das Gnadenbild Maria vom guten Rat sollte vor Verunehrung von Seiten der Türken bewahrt bleiben, und siehe da, das Gnadenbild löste sich wie von Engelshand wunderbar von der Mauer, auf die es gemalt war, und entschwebte westwärts gegen das adriatische Meer. Zwei Männer, die gerade vor dem Gnadenbild beteten und seinen wunderbaren Abzug von Kirche und Stadt mit Staunen gewahrten, folgten ihm und kamen trockenen Fußes über das Meer bis nach Genazzano, nahe bei Rom, wo es sich in einer kleinen Kapelle niederließ. Hier hat in der Folgezeit die Verehrung des heiligen Bildnisses durch auffällige Gebetserhörung immer mehr zugenommen. Die höchsten Kirchenfürsten wetteiferten in der eifrigen Verehrung Mariens in diesem ihrem heiligen Bild, so besonders Pius IX. und Leo XIII.
Für die fromme Überlieferung des wunderbaren Abzugs des heiligen Bildes von Skutari nach Genazzano sprechen die Worte Benedikts XIV. in der Bulle „Iniunctae nobis“. Darin heißt es also: „In der Stadt Genazzano befindet sich in der Marienkirche Unserer Lieben Frau vom guten Rat eine Kapelle, in der ein Bildnis Mariens vom guten Rat verehrt wird, das einst nach frommer Überlieferung von Skutari durch Engelshand dorthin gebracht worden ist.
Da die Türken Skutari erobert hatten, begannen sie alles zu verwüsten und verwandelten die katholischen Kirchen in türkische Moscheen. Ähnliches versuchten sie zweimal auch mit der Gnadenkirche Unserer Lieben Frau vom guten Rat, wurden aber jedes Mal von einer geheimnisvollen Macht davon abgehalten. Voll Ärger darüber, hielten sie die Katholiken von weiterem Besuch der Kirche ab. Und als diese mit der Zeit baufällig geworden war, hinderten die Türken jede Ausbesserung des Gebäudes.
Nun sind an die 450 Jahre (550) verflossen und vom Heiligtum sind nur noch die nackten Mauern übriggeblieben, die mit von weißem Kalk gemachten Kreuzen bezeichnet sind.
Zum altehrwürdigen Gemäuer pilgert die Stadt in Prozession alljährlich am 25. April, wobei innerhalb der alten Kirchenmauern auf einem improvisierten Altar das heilige Messopfer gefeiert wird. Die katholischen Albaner haben bis heute eine große Andacht zu Unserer Lieben Frau vom guten Rat bewahrt. Ergreifend ist ihre Klage über den Abzug ihres heiligen Bildes in dem Lied, das sie zu Ehren Mariens singen. Groß sind die Gnaden, die sie ihrer himmlischen Mutter verdanken.
Groß war aber auch allzeit das Verlangen, auf dem alten Gemäuer das frühere Heiligtum wiederherzustellen, doch ist es unter der bisherigen Türkenherrschaft unmöglich gewesen.
Da nun jetzt neue, bessere Zeiten angebrochen sind, haben die katholischen Albaner sofort an die Ausführung ihres alten Lieblingswunsches gedacht und die kaiserliche österreichische Regierung hat dazu ihre Zustimmung gegeben, und man geht bereits mit allem Eifer an die Ausführung. Die Skutariner, der Erzbischof an der Spitze, haben ein Komitee gegründet, das eifrig an die Arbeit geht. Die Stadt Skutari hat in wenigen Tagen bei 80.000 Kronen zusammengesteuert und alle Albaner helfen bei aller Not der Zeit nach bestem Vermögen zur baldigen Vollendung des gottgefälligen Werkes.
(aus „Ave Maria“, XXIV. Jahrgang, Heft 6, S. 125)
________________________________________________________________________

102. Bogenberg
Pfarr- und Wallfahrtskirche in Niederbayern
Der Bogenberg, am Vorsaum der Bergkette des Bayerischen Waldes, am linken Ufer des majestätischen Donau-Stroms, trägt auf seiner erhabenen Spitze eine schöne, im gotischen Stil erbaute Kirche, die der heiligen Jungfrau Maria geweiht ist und alljährlich von Tausenden frommer Wallfahrer besucht wird.
Er erhebt, drei geometrische Stunden östlich von Straubing entfernt, 1606 bayerische Fuße über der Meeresfläche sein aus Granit bestehendes Haupt und kehrt seine steile, nur noch spärlich mit Buschwerk bewachsene, meist kahle Front dem linken Donauufer zu, in das seine Granitfelsen sich senken. Überraschend ist das Panorama, das auf seiner Kuppe sich darbietet. Zwar ist der Norden durch eine Bergreihe verschlossen, nach den übrigen Weltgegenden aber liegt das Land völlig offen da. Gegen Süden streift das Auge über die Hälfte Altbayerns hin und erschaut Salzburgs, Tirols und Steiermarks mit ewigem Schnee bedeckte Alpengipfel. Ostwärts reicht der Blick den Abhängen der Bergkette entlang bis zu den Umgebungen von Passau; gegen Westen über die weite Ebene jenseits Straubing bis Regensburg.
Da wo jetzt die Wallfahrtskirche mit den Pfarr- und Schul-gebäuden in friedlicher Stille sich erhebt, stand in grauer Vorzeit die feste Stammburg der mächtigen und gefürchteten Grafen von Bogen, die von der Böhmischen Grenze bis an die Donau hin feste Schlösser besaßen, in ihrer Streitlust selbst den Herzogen von Bayern Trotz boten, und durch ihre Raubsucht und Fehden weithin das Land in Angst und Schrecken hielten. Sie geboten beinahe über den ganzen Bayerischen Wald. Zu Falkenstein, Mitterfels, Windberg, Weissenstein, Flinsberg hatten sie Schlösser. Auch Natternberg und Plattling waren ihnen zugehörig. Über mehrere Stifter besaßen sie die Schirmvogtei.
Die Erbauung der Burg, so wie das Entstehen der Grafschaft Bogen verliert sich im Dunkel der ältesten Zeiten. Als der erste bekannte Besitzer der Burg wird gewöhnlich Hartwich aufgeführt, den eine alte Sage von den Grafen von Abensberg abstammen ließ. Laut dieser Sage habe Graf Babo von Abensberg mit seinen beiden Gemahlinnen Judith und Irmengard zweiunddreißig Söhne und acht Töchter erzeugt und sie alle beim Leben erhalten und sorgfältig erzogen. Als Kaiser Heinrich II. der Heilige (als Bayerns Herzog Heinrich IV.), zu Regensburg Hof hielt, und im Jahr 1015 an alle Ritter in Bayern ein Aufgebot erließ: „sich zu einer großen Jagd einzufinden, jedoch nicht mehr als zwei Knappen zur Begleitung mitzubringen“, habe Babo alle seine Söhne standesgemäß zur Jagd gerüstet und sei an ihrer Spitze an den kaiserlichen Hof gezogen. Beim Anblick dieses zahlreichen Gefolges habe der Kaiser, aufgebracht über die Übertretung seines Gebotes, den Grafen mit strengen Worten getadelt, dieser aber habe sich ehrfurchtsvoll dem Thron genähert, mit den Worten: „Gnädigster Kaiser! Eure Befehle sind mir heilig; - diese alle“ – auf seine Söhne zeigend – „sind Eure Diener, meine Söhne; ich habe sie mit größter Sorgfalt erzogen, und gebe sie Euch zu eigen, damit sie im Frieden zu Eurer Zierde, und im Krieg zu Eurem Schutz sein mögen: ich weiß, sie werden Eurer Gnade würdig sein!“ Freudig überrascht habe sie der Kaiser zu sich gerufen, seiner Huld versichert und in der Folge reichlich mit Gütern begabt. – Hartwich soll einer dieser 32 Söhne des Grafen Babo von Abensberg gewesen und vom Kaiser mit der Grafschaft Bogen beschenkt worden sein. Bis zu ihm führt die gewöhnliche Geschlechtstafel dieser Grafen ihre bekannte Stammreihe zurück. (Einige Geschichtsforscher nehmen als den ältesten bekannten Grafen von Bogen – Hohenbogen - Radepot, der um das Jahr 938 gelebt zu haben scheine, zu welcher Zeit er mit Herzog Berchthold von Bayern auf dem ersten Tournier zu Magdeburg gewesen sein soll, und setzten vor obigen Hartwich noch Aswin I., der als der in der Sage verminte Sohn Babos des Abensbergers und demnach als Hartwichs I. Vater anzunehmen wäre.) Er hatte seinen Wohnsitz zu Bogen und starb um das Jahr 1074. Seine Söhne Friedrich und Aswin (Aswein), aus seiner zweiten Ehe mit Bertha, des Königs Bela I. von Ungarn Tochter, teilten das väterliche Erbgut.
Friedrich blieb im Besitz von Bogen, und behielt die Schirmvogtei über das Hochstift Regensburg. Mit Zustimmung seiner Gemahlin Adelheid, des Herzogs Magnus von Sachsen Tochter, und seines Bruders Aswin erhob er das eine halbe Stunde von Bogen entfernte, im Hunnenkrieg zerstörte Benediktinerkloster zu Oberalteich am linken Ufer der Donau wieder aus den Ruinen, in denen es 195 Jahre gelegen war, stattete es mit reichlichen Schenkungen aus, und legte sich das Schirmrecht über dasselbe bei. Er starb auf einem Zug mit dem Bayerischen Herzog Welf ins gelobte Land im Jahr 1104 zu Jerusalem. Sein Sohn Friedrich II., ein heftiger, kühner Krieger, endete sein Leben bei der Belagerung von Pavia 1136; - sein Enkel Friedrich III., Sohn Luitgardens, des Herzogs Wladislaus von Böhmen Tochter, starb auf dem Kreuzzug in Palästina 1149, - und mit seinem Urenkel Albert, Sohn Judithens, des Markgrafen Thiemo II. von Vohburg, verschwand dessen Stammlinie von Bogen. Die Grafschaft kam ganz in die Hände der Nachkommen Aswins, wahrscheinlich durch freiwillige Abtretung. Die Geschichte bietet darüber keine Aufschlüsse.
Aswin, der Stammvater der zweiten Geschlechterlinie der Grafen von Bogen, empfing vom väterlichen Erbe unter anderem die Güter im Nordgau und nannte sich Graf von Zeidlarn-Bogen. Von seinen Söhnen aus der Ehe mit Luitgard, Gräfin von Windberg, wählte Berchthold I. das Klosterleben zu St. Blasien im Schwarzwald, wo er als Abt starb; Albert aber, der das Geschlecht fortpflanzte, schuf das Schloss Windberg, unweit Bogen, im Jahr 1125 in ein Kloster des Prämonstratenser-Ordens um, und erbaute einen Wohnsitz auf dem Schlossberg zu Bogen, wahrscheinlich auf dem Platz, den jetzt eine Maulbeer-Pflanzung schmückt. Er starb 1147 und hinterließ aus der Ehe mit Hedwig, Gräfin von Zilly, drei Söhne, wovon der ältere, Albert II., bei der Belagerung von Phaley im Jahr 1140 von einem Pfeil getroffen, starb, und Hartwig II., der Natternberg zu seinem Sitz gewählt hatte, in Wahnsinn verfiel; es folgte ihm daher Berchthold II. in der Grafschaft, der aus seiner Ehe mit Luitgarde, Tochter des Markgrafen Poppo von Kärnten, bei seinem Ableben im Jahr 1168 den einzigen Sohn Albert III. hinterließ. Er, kühn und kampflustig, trat im Jahr 1192 in heftige Fehde gegen die Grafen von Ortenburg, denen Herzog Ludwig von Bayern beistand, die in solch heillosen Krieg losbrach, dass ein großer Teil von Bayern mit Raub, Mord und Brand erfüllt wurde, bis Kaiser Heinrich VI. Ruhe gebot, des Grafen Alberts Bundesgenossen, den Herzog Ottokar von Böhmen absetzte, und Alberten nach Apulien verwies, wo er jedoch bald wieder des Kaisers volle Gnade und Gewogenheit erwarb und auch für Ottokar Vergebung erwirkte. Im Jahr 1197 zog er mit dem Heer der Kreuzfahrer nach Asien. Nach seiner Rückkehr bekriegte er erneut die Ortenburger, gegen die sein alter Groll nicht erloschen war, bis ein frühzeitiger Tod im Jahr 1198 seinem Leben in einem Alter von 33 Jahren ein Ende machte. Alberts Gemahlin war Ludmilla, des Böhmischen Königs Wladislaus II. Tochter. Sie gebar ihm drei Söhne, Leopold, Berchthold III. und Albert IV. Der erste trat in den Priesterstand und starb als Probst des Stifts zur alten Kapelle zu Regensburg 1221. Berchthold zog im Jahr 1217 mit dem Kreuzheer nach Palästina und ertrank vor Damiate in Ägypten. Albert IV. begleitete nicht nur ebenfalls diesen Kreuzzug, sondern auch den folgenden im Jahr 1220 und kam aus beiden wohlbehalten zurück; als er zum dritten Mal im Jahr 1234 ins Gelobten Land ziehen wollte, geriet er bei Venedig unter Seeräuber, und kehrte, nachdem er so glücklich war, sich von ihnen frei zu machen, wieder zurück. Nach vielen kriegerischen Waffentaten und Fehden verlebte er noch ein paar Jahre in Ruhe und starb 1242 kinderlos. Nun fiel die Grafschaft Bogen, die den Markt Bogen, Windberg, Falkenstein, Mitterfels, Weißenstein, Flinsberg, Plattling, Natternberg, Isarhofen und den ganzen oberen Wald begriff, - an das Bayerische Fürstenhaus.
Ludmilla, Alberts III. Witwe, des letzten Bogeners Mutter, wurde im Jahr 1204, sechs Jahre nach ihres ersten Gatten Tod, die Gemahlin des Herzogs von Bayern, Ludwigs I., des Kehlheimers. Wie dieser neue Ehebund geschlossen wurde, meldet in den alten Chroniken eine liebliche Sage. Oft besuchte der Herzog, - so lautet sie, - von Landau aus, während seines vielmaligen Aufenthalts daselbst die schöne, geistreiche, junge Witwe zu Bogen, und fand sich bald von leidenschaftlicher Liebe zu der holdseligen Königstochter angezogen. Züchtiglich widerstand die reizende Frau ungeziemendem Zudringen; nur als Gemahlin wollte sie sein Verlangen erfüllen. Als Ludwig nun eines Tages dringender und heißer als je um die Gunst ihrer Liebe warb, bestimmte sie ihm einen Tag zum Besuch, an dem sie der Gewährung seiner Sehnsucht nicht weiter widerstreben wolle. Inzwischen ließ sie nach dem Rat der Ihrigen drei Ritter auf einen Teppich malen, und, wie sie am bestimmten Tag den Herzog herbeireiten sah, drei Ritter als Zeugen sich wohl hinter dem Teppich verbergen. Da Ludwig alsbald sein Verlangen wiederholte, wies die schöne Frau auf das Bild mit den Worten: „Gelobt mir fröhlich die Ehe vor diesen Rittern, so will ich Eure Wünsche gewähren.“ Ludwig versprach es ungesäumt ohne Bedenken. Nun traten die Zeugen hinter dem Vorhang hervor. Darüber wurde der Herzog voll Unmut, dass sie ihm nicht allein glaubte; eilte von Bogen hinweg und kehrte ein ganzes Jahr nicht wieder. Doch Liebe siegte über den Zorn und führte ihn zur schönen Frau zurück. Er brachte Ludmilla als seine Gemahlin nach Kehlheim und lebte in glücklicher Ehe mit ihr, bis er im Jahr 1231 unter dem Dolch eines Meuchelmörders auf der Brücke zu Kehlheim fiel.
Otto der Erlauchte, sein Nachfolger, entspross dieser Ehe.
Ludmilla vertrauerte noch neun Jahre im Schmerz über den herben Verlust ihres geliebten Gatten und gründete das ansehnliche Kloster der Zisterzienserinnen zu Seligenthal vor den Toren von Landshut, in dem sie im Jahr 1240 ihre Ruhestätte fand.
Der Dichter Heinrich Döring besingt diese liebliche Sage wie folgt:
Die Blume der Frauen, des Landes Zier,
War Gräfin Ludmilla von Bogen,
Längst fühlte durch Neigung und Liebe zu ihr
Sich Ludwig der Bayer gezogen.
Ihr Gatte, Graf Albrecht, in Fehden gewandt,
Und rings als ein männlicher Ritter bekannt,
War jüngst mit dem tapfern Degen
Freund Hain, im Zweikampf erlegen.
Dem Herzog schien`s, als die Nachricht erklang,
Nicht länger daheim zu behagen;
Es trieb ihn, die Ufer der Donau entlang,
Zum Schlosse der Gräfin zu jagen.
Er pries auf des Berges waldigen Höh`n
Die Lage der Burg als bezaubernd und schön,
Und bat, ihm als Huld zu gewähren,
Bisweilen hier wiederzukehren.
Bestürzt stand Ludmilla, voll sittiger Scham,
Und ließ nur mit Müh sich erbitten.
Doch als er ihr Jawort errungen, da kam
Nun Ludwig fast täglich geritten,
Und fiel als ein loser und tändelnder Gast
Der Gräfin mitunter recht herzlich zur Last.
Die, weil sie im Stillen ihn liebte,
Sein Wesen verdross und betrübte.
„Fürwahr“, sprach sie einst, „ein vergebliches Spiel,
Mit leerem Geschwätz mich zu quälen.
Ihr werdet so, glaubt`s mir, auf immer das Ziel,
Wonach euch gelüstet, verfehlen.
Bekräftiget redlich, durch Trauring und Hand,
Gefühle, die längst euer Mund mir gestand!“
„Lass beides“, rief Ludwig, „als Zeichen
Der innigsten Liebe dir reichen.“
„Mit Gunsten, Herr Herzog, so weit sind wir nicht!“
Sprach lächelnd die Gräfin: „lasst hören,
Geliebt es euch morgen den Treueid der Pflicht
Vor diesen drei Zeugen zu schwören?“
Sie sprach es, und deutete links mit der Hand.
Dort wies sich, als Zierde der gotischen Wand,
Geschmückt mit Wappen und Fahnen,
Ein Kleeblatt von tapferen Ahnen.
„Ho, ho!“ rief der Herzog, und lachte fast laut:
„Welch wunderliches Begehren!
Ihr scheint mir bei Laune, holdselige Braut,
Und Unrecht wohl wär`s, sie zu stören;
Drum füg ich in seltsame Bitte mich gern,
Und leiste vor diesen gewappneten Herrn,
Euch morgen den Eidschwur der Treue,
Durch den ich mich ewig euch weihe!“
Drauf reicht er am Morgen Ludmillen die Hand,
Und sagte: „Ihr Ritter, seid Zeugen“,
Da dünkt`s ihm, als tönte dicht hinter der Wand
Ein hallendes Echo: „Wir zeugen!“
Sie rollte sich, leicht wie ein Vorhang empor;
Es traten drei stattliche Ritter hervor,
Und neigten mit ernster Gebärde
Sich vor dem Erstaunten zur Erde.
Der Herzog warf starr, mit geöffnetem Mund,
Den Blick auf die lebenden Büsten;
Es schien ihm, als hab er wohl reichlichen Grund,
Sich über den Schwank zu entrüsten.
Doch hielt von Ludmillen ein zärtlicher Blick
Gewaltsam den Ausbruch des Unmuts zurück;
Auch schien`s vor den peinlichen Zeugen
Gerat`ner, sein Leid zu verschweigen.
„Fürwahr!“ rief er lächelnd, „der Einfall gereicht
Dem weiblichen Scharfsinn zum Lobe;
Doch glänzt er in anderer Hinsicht vielleicht
Nicht eben als rühmliche Probe!
Dem sei wie ihm wolle! Hier reich ich die Hand
Der Holden, die längst ich mein eigen genannt,
Und schmück auf erhabenem Throne
Ihr Haupt mit der bayerischen Krone.“
Otto der Erlauchte, Bayerns Herzog, nahm nach dem Tod des Grafen Albert IV. von Bogen, seines Bruders von Mutter Seite, im Jahre 1242 als nächster Erbe von dem gesamten reichen Gut und Lehen des erloschenen mächtigen Geschlechts dieser Grafen Besitz. So kam die Grafschaft Bogen an das Bayerische Haus.
Die Stammburg Bogen war nun ihrem Verfall preisgegeben: davon retteten nur einen Teil die folgenreichen Wirkungen religiösen frommen Sinnes eines ihrer Besitzer. Im Jahr 1104 soll nach alter, auf einer in dem ehemaligen Benediktinerkloster Oberalteich und der ganzen Umgegend erhaltenen Überlieferung gegründeter Sage das Wunder geschehen sein, dass das noch gegenwärtig auf dem Bogenberg verehrte Marien-Bild aus schwerem Stein von den Wellen der Donau unbekannt von woher „von unten herauf“ stromaufwärts bis zu einem Felsen getragen worden sei, auf welchem es so lange verblieb, bis es vom Grafen Aswin in Empfang genommen und auf seine Burg gebracht wurde. Die Chronik des Klosters Oberalteich gibt die Sage mit den Worten:
„Im Jahre nach Christi Geburt 1104, als Graf Aswinus, ein Bruder unsers hochgräflichen Stifters Friedrich I., auf seiner festen Burg Bogenberg Hof hielt, ist das wundertätige Bildnis der Mutter Gottes auf der Donau dem Fluss zuwider heraufschwimmend ankommen, und hat auf einem Steinfelsen so lang Stand gehalten, bis es von den Inwohnern ersehen und dem Grafen aller Verlauf mit Verwunderung angedeutet worden. Aswin verordnete alsobald, dass das Wunderbild aus dem Wasser an das Land gebracht, dann mit höchster Ehr und Andacht in sein Residenzschloss getragen, und in dessen Kapelle eingesetzt wurde.“ (Siehe die Schrift: der Bogenberg berühmt als Grafschaft und Wallfahrt geschichtlich nachgewiesen von Augustin Kiefl, Pfarrer zu Haarbach, Passau 1819)
Der beim Spital außer Bogen an der Donau in beträchtlicher Höhe sich erhebende Fels ist es, von dem die Marien-Statue in Empfang genommen worden sein soll. Graf Aswin hat ihre Übersetzung in die Burg-Kapelle mit großer Feierlichkeit vollziehen lassen.
Diese in neuerer Zeit vielseitig angefochtene Sage wurde nach geläuterter Ansicht am besten in der Art erklärt, auf dem bezeichneten Felsen, der wegen seiner Höhe von der Donau nie überflutet worden sein soll, sei in der Vorzeit das steinerne Bild der heiligen Jungfrau aufgestellt gewesen, damit die Vorbeischiffenden an dieser gefährlichen Stelle zur Andacht erinnert wurden, oder in Lebensgefahren die Hilfe der Mutter des Heilandes anriefen. Durch den veränderten Lauf der Donau habe sich jedoch auch die Schifffahrt verändert und da die Gefahr beseitigt war, so sei die Statue vom Grafen von Bogen in seine Schlosskapelle versetzt worden.
Das Bildnis, aus einer weißen Steinart ausgehauen, stellt Mariä Heimsuchung vor, nämlich die heilige Jungfrau, wie sie über das Gebirge zum Besuch ihrer Base geht. Es ist gegen fünf Schuh hoch, wohlgebildet, mit einer Krone auf dem Haupt und bemalter, noch ganz gut erhaltener Kleidung. Die über den Mantel herabhängenden Haare sind goldgelb, der Rock blau mit Rosen besetzt, der Mantel rot mit eingewirkten Weizen-Ähren und die Aufschläge purpurschillernd, die von dem Mantel halbbedeckten Hände liegen auf dem gesegneten Leib. Unter dem Herzen ist eine mit Strahlen umgebene, länglich viereckige Öffnung, in der das fleischgewordene Wort in Kindesgestalt aufrechtstehend mit beigesetzter Bezeichnung des Namens Gottes in elf Sprachen, z.B. Eloa, Alla, Deus, Gott usw. dargestellt ist. In früherer Zeit scheint es, wie die älteren Votivtafeln erzählen, ohne Verhüllung zur Verehrung ausgestellt gewesen zu sein. Jetzt aber ist die Statue mit einem goldgestickten Kleid und Mantel bekleidet, und die anschauliche Vorstellung der Frucht des gesegneten Leibes dem Auge der Andächtigen verhüllt.
Als sich die Kunde von der Überbringung des Marien-Bildnisses in die Burg-Kapelle auf dem Bogenberg verbreitete, kamen bald fromme Verehrer Mariens herbei, um dort ihre Andacht zu pflegen. Mit jedem Jahr wuchs die Zahl der Besucher, die vor dem Bild die Fürbitte und den Schutz der göttlichen Mutter anriefen. Die Marien-Kapelle auf dem Bogenberg bekam nach und nach den Ruf eines ausgezeichneten Gnadenortes, an dem fromme Gläubige Trost und Hilfe in ihren Nöten gefunden haben. Das Kloster zu Oberalteich, dem die Kapelle zugehörig war, versäumte nichts, die Andacht auf dem Bogenberg zu befördern. Schon in den Jahren 1286 und 1294 verliehen die Bischöfe von Passau und Freising den Wallfahrern nach Bogenberg Ablässe, desgleichen vor ihnen schon die Bischöfe von Salzburg und Regensburg. Im Jahr 1295 bewirkte der Abt Conrad II. von Oberalteich auch einen Päpstlichen Ablass für diese Kapelle. Der Gottesdienst in der Kapelle wurde stets durch Religiosen der Benediktiner-Abtei Oberalteich versehen. Die bedeutende Zunahme der Wallfahrt machte eine Erweiterung der Kapelle notwendig. Die unbewohnte gräfliche Burg war in Verfall geraten. Aus ihren Ruinen wurde unter dem genannten Abt Conrad im Jahr 1295 eine herrliche Kirche und daneben ein Wohngebäude für Geistliche geschaffen. Reichliche Beiträge und Geschenke flossen zu diesem Unternehmen aus den Bezirken der umliegenden Dekanate des Regensburger Bistums-Sprengels auf die von dem Bischof ergangene Einladung. Schon im Jahr 1298 errichtete das Kloster daselbst ein Priorat für Ordenspriester, die die Wallfahrt und zugleich die dortige, zum Kloster gehörige ausgedehnte Pfarrei besorgten.
Durch die vielen Nachrichten von wundervoller Gnade und Erhörung, die den frommen Pilgern zuteilwurden, wuchs ihre Zahl fortwährend selbst aus fernen Gegenden und Ländern. Zur Aneiferung wirkte auch das Beispiel vieler hoher fürstlicher Personen, die den Bogenberg besuchten und mit ansehnlichen Geschenken bedachten, besonders aus dem bayerischen Regentenhaus. Im Jahr 1430 kam auch Kaiser Sigmund, im Jahr 1459 Kaiser Friedrich III., im Jahr 1630 Kaiser Ferdinand II. mit seiner Gemahlin Eleonore und seinem Sohn Ferdinand III., König in Ungarn, auf den Bogenberg. So erhob sich der Flor der Wallfahrt. Bogenberg galt vielen als das zweite Altötting in Bayern. Ganze Gemeinden zogen in Prozessionen dahin. Oft konnte man auf ihm an einem Tag gegen 15.000 Andächtige zählen.
Die Kirche zu Bogenberg besitzt neben dem wundertätigen Bildnis der seligsten Jungfrau noch ein anderes hochverehrtes Kleinod, nämlich einen sehr beträchtlichen Partikel des heiligen Kreuzes, der in der Größe außer Rom und Jerusalem wohl kaum irgendwo seines Gleichen hat, neun Zoll bayerischen Maßes lang, anderthalb breit, und ein Zoll tief, mit einem Querbalken sechs und einen halben Zoll lang, in Kreuzesform gefasst, der vom Fest der Kreuz-Auffindung – 3. Mai – bis zum Fest Kreuz-Erhöhung – 14. September – zur öffentlichen Verehrung ausgesetzt ist. Mit diesem großen Stück beschenkte Papst Honorius III. den Grafen Albert IV. von Bogen für seine vielen treuen Dienste gegen die Ungläubigen. Graf Albert brachte es mit anderen heiligen Reliquien von Rom nach Hause, und gab es im Jahr 1235 dem Kloster Oberalteich zum Geschenk, wo es als das köstlichste Kleinod aufbewahrt und nur zu gewissen Zeiten des Jahres auf dem Bogenberg zur öffentlichen Verehrung gebracht wurde. In der Folge wurde ungeachtet der Tatgeschichte der erwähnten Schenkung wegen der besonderen Größe dieses Kreuzpartikels Verdacht gegen seine Echtheit erregt. Um allen Zweifeln zu begegnen, beschloss man daher, den Partikel zur Prüfung nach Rom zu senden. Befürchtend, dass er nicht wieder in seiner ganzen Größe zurückkommen dürfte, wurde der beträchtliche Teil in Mitte der Kreuzung ausgeschnitten und an die Päpstliche Behörde gesandt. Er wurde bei der vorgenommenen Untersuchung als echt befunden und zurückgesendet. So hatte man dann vom Jahr 1700 an zwei Kreuz-Partikel. Der kleinere wurde kostbar gefasst und im Kloster Oberalteich behalten. Der größere aber verblieb der Kirche auf dem Bogenberg fortwährend bis jetzt als Gegenstand besonderer Verehrung, weshalb auch der Tag der heiligen Kreuz-Auffindung als ein dortiges Hauptfest begangen wird.
Die Wallfahrtskirche, zugleich die Hauptkirche der Pfarrei, ist ein ehrwürdiges Denkmal frommen Eifers und erfüllt den Eintretenden geheimnisvoll mit Ehrfurcht und Andacht. Das Gebäude hat im Innern bis zum Choraltar eine Länge von 163 Schuh, die Breite beträgt 78, die Höhe 56 Schuhe. Zwei Säulenreihen, die das Gebäude halten, teilen es in drei Teile, die in der vorderen Hälfte zusammenlaufen. Auf der Westseite steht ein sehr fester, aus Quadersteinen aufgeführter, 185 Schuh hoher Turm, dessen harmonisches Glockengeläute lieblich in die weite Ferne ertönt. Außer dem ringsum ganz freistehenden Choraltar, auf dem das Gnadenbild Mariä Heimsuchung ruht, schmücken die Kirche acht Nebenaltäre, wovon zwei gegen den Hochaltar, die übrigen je drei an den Seitenwänden stehen. Die Altarblätter stellen auf der Evangelienseite den heiligen Benedikt und Dominikus dar, denen die Mutter des Herrn den Rosenkranz reicht, den heiligen Joseph, die 14 Nothelfer und die büßende Magdalena, auf der Epistelseite die heiligen Erzleviten Stephan und Laurentius, die heilige Mutter Anna, die 7 Zufluchten und den weinenden Petrus. Hinter dem Choraltar ruhten einst in einer Gruft die Gebeine der Grafen Friedrich und Aswin von Bogen und andere Glieder der gräflichen Familie. Abt Poppo von Oberalteich ließ sie aber im Jahr 1279 in das Kloster versetzen. – Im Portal befindet sich das Grabmal eines geharnischten Ritters Wolf von Kampfstein vom Jahr 1488. Diesem Grabmal gegenüber ist in die Mauer eine Steinplatte befestigt mit der Inschrift:
H a e C s e D e s D e l p a r a e I n s I g n I s.
(Deutsch: Dieses hier der Sitz der erhabenen Gottesgebärerin.)
Schon trug im Jahr eilfhundert vier
Der Donau Fluth mit Gottes Segen
Dein Bild, Maria! uns entgegen.
In seiner Schloßkapelle hier
Hat Aswin, Bogens frommer Held,
Es dir zur Ehre aufgestellt.
Über dem Haupteingang liest man die Zeilen:
Gottmensch! Hör an Deinem Gnadenort
Durch Maria unser flehend Wort!
Die jetzige Gestalt im Inneren erhielt die Kirche hauptsächlich unter dem Abt Benedict II. von Oberalteich. Er ließ im Jahr 1722 an die Stelle des alten steinernen Chores neue Oratorien errichten; im folgenden Jahr den alten Choraltar, der die Kreuzigung Christi vorstellte, hinwegschaffen, den jetzigen Hauptaltar errichten, und auf ihm das wundertätige Marienbild, das vorher auf dem ersten Altar an der Donau-Seite stand, aufstellen. Die Altarblätter, zwei Orgeln, die Fenster, Speisgitter, Kirchen- und Beichtstühle und das Pflaster wurden neu hergestellt und die Kirche von den Gebrüdern Anton und Andreas März von Straubing durch Freskogemälde verziert.
Rings um die Kirche zieht sich der Gottesacker, den eine mit Quaderstücken belegte Mauer umgibt.
Die Hauptfesttage dieser Kirche, an denen der Andrang ihrer Besucher besonders stark ist, sind das Kreuz-Erfindungsfest am 3. Mai, das Fest Mariä Heimsuchung, das Fest Mariä Himmelfahrt, dann alle übrigen Frauentage und die Feste der dortigen beiden Bruderschaften am Rosenkranz- und Isidorfest.
Bei den meisten, der in Prozession herziehenden Gemeinden ist es üblich, als Opfer große schöne Wachskerzen darzubringen. Darunter zeichnet sich die Gemeinde Holzkirchen bei Ortenburg aus. In Folge eines alten Gelübdes opfert sie alljährlich eine über fünfzig Schuh hohe, mit rotem Wachs überwundene Stange, die aufrecht gehalten am Pfingst-Sonntag nachmittags bei der Prozession von einem starken geübten Mann durch den ganzen Markt Bogen und über den steilen Berg hinaufgetragen wird, und auf kurze Zeit in der Kirche aufgestellt bleibt. Zu diesem Ende wird in der genannten Gemeinde stets eine solche Stange das ganze Jahr hindurch zum Austrocknen bereitgehalten. Dieses Geschäft ist wie A. Kiefl in seiner oben angeführten Beschreibung des Bogenberges sagt, „in einer Familie der Gemeinde Holzkirchen gleichsam erblich geworden, jedoch versuchen sich auch andere junge Leute darin abwechselnd, und jeder rechnet es sich zur Ehre, sagen zu können, die lange Stange getragen zu haben. Während dem Zug ist der Träger von einigen Gefährten umgeben, um das mögliche Fallen zu verhindern.“
Im Jahr 1816 wurde das siebente Jubiläum der Wallfahrtskirche mit glänzender Pracht gefeiert. Es hätte schon 1804 begangen werden sollen, blieb aber wegen der damaligen kriegerischen Zeitumstände bis dahin verschoben. Ununterbrochen vom Entstehen der Wallfahrt an (1104) bis zur Auflösung des Klosters Oberalteich (1803) wurden die kirchlichen Dienste auf dem Bogenberg von Religiosen aus demselben besorgt. In dem Priorat daselbst befanden sich fünf Benediktiner, der Prior und noch vier Priester, die die dortige, zum Kloster gehörige Pfarrei versahen und erforderlichen Falls jedes Mal die nötige Aushilfe vom Kloster erhielten. An den Hauptfesten kam der Abt selbst mit dem ganzen Convent auf den Bogenberg, um die Vesper am Vorabend und das feierliche Hochamt am Festtag zu halten. Nach Aufhebung des Stiftes Oberalteich wurde die Kirche auf dem Bogenberg als Pfarrkirche beibehalten, das Priorat zur Pfarrei umgeschaffen, welche mit Einschluss der Gemeinde des Marktes Bogen dermal 1900 Seelen umfasst und mit einem Pfarrer und mit einem Hilfspriester bestellt ist. Das Pfarrgebäude steht neben der Kirche gegen Mitternacht und an demselben das Schulhaus. Das Häuschen gegen Osten bewohnt der Totengräber. Vor dem Eingang in den Kirchhof sind mehrere Buden von Stein erbaut, in denen an Tagen, an welchen Kreuzzüge kommen, Käufern verschiedene Waren feilgeboten werden. Dieses sind die Gebäude, welche nebst der Kirche die Fläche der Bergspitze einnehmen.
Viele harte Unglücksfälle hatte die Wallfahrtsstätte Bogenberg im Laufe der Zeiten zu erdulden. Durch die hohe Lage allen Unbilden des Wetters ausgesetzt, litt sie oft und viel durch Stürme und Gewitter. – Im Jahr 1373 am 21sten März schlug der Blitz in den Turm, zerschmelzte alle Glocken, verwandelte altes Balkenwerk in Asche, beschädigte die Kirchenwände und verbrannte die Ornate, Vier Jahre danach verzehrte ein in der Scheuer ausgebrochenes Feuer das ganze Priorat mit allen Fahrnissen. Im Jahr 1412 am 25sten November riss ein wütender Sturm die Dächer der Kirche, des Turmes, des Priorates und aller Nebengebäude ab. Drei Jahre danach am ersten Sonntag im Monat August gegen Mitternacht fuhr der Blitz in den Turm, zerschmelzte zwei Glocken, schleuderte die große Glocke in die Tiefe hinab, dass sie in 12 Trümmer zersprang, und brannte den Turm ganz aus. – Im Jahr 1507 war das Priorat durch Stürme und Gewitter so übel zugerichtet, dass es der Abt Georg von Oberalteich von Grund aus neu aufbauen lassen musste. Im Jahr 1518 riss der Sturm abermals die Scheune zusammen. Im Jahr 1592 zerstörte ein Gewitterschlag das ganze Glockengeläut. Am Pfingstmontag 1618 lagerten zahlreiche Wallfahrer nachts im Freien um die Kirche herum, als ein furchtbares Wetter heranbrach, vor dem dann sich alles in die Kirche drängte. Auf einmal erschütterte ein Schlag das Gebäude, der Blitz sprang aus dem Turm durch die von der Volksmenge vollgepfropfte Kirche, tötete zwei Personen und verletzte mehrere. Voll Schreckens wälzten sich die Haufen den Kirchentüren zu. Im Gedränge wurden vierzehn Personen erdrückt. – Unglücke anderer Art erlitt die Kirche in der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Rohe, feindliche Krieger des schwedischen Heeres plünderten die Kirche rein aus, zerschmetterten die Altäre, beraubten das Marienbild seiner Zierde, stürzten es vom Altar und schleuderten es den Berg hinab. – Dazu kam noch, dass im Jahr 1652 ein Blitzschlag den Turm wieder in Brand setzte und die Glocken zerstörte. – Bei dem Einfall feindlicher Truppen im Jahr 1704, zur Zeit des Spanischen Successionskrieges wurde das Gnadenbild in die Karmeliter-Kirche nach Straubing geflüchtet, bis die größte Gefahr vorüber war. – Im Jahr 1776 am 10ten Mai schlug der Blitz abermals in den Turm, streckte die Person, die eben das Glockenzeichen zur Vesper gab, betäubt darnieder, und brach durch die Wand in die Kirche, jedoch ohne große Beschädigung; auch im Jahr 1783 fiel der Blitz auf den Turm, zerschmetterte zwei Säulen in der Kirche und verlor sich im Priorat. Blitzschläge auf diese Gebäude, mehr oder weniger nachteilig, ereigneten sich noch öfter und wiederholten sich nicht selten sogar in einem Jahr. Am 20sten April 1803, einem sehr stürmischen Tag, geriet kurz vor der Mittagsstunde das Priorat auf einmal in volle Flammen und in einer Stunde war es mit allen Nebengebäuden ein Raub derselben. Die Kirche blieb jedoch durch die Anstrengung der herbeigeeilten Hilfeleistenden und den Schutz des Himmels verschont, verlor aber alle ihre Ornate und Paramente, die im Priorat aufbewahrt waren. Das Marienbild wurde an diesem Schreckenstag in die Kirche im Markt Bogen geflüchtet, und am 24sten April wieder feierlich an seine Stelle zurückgebracht. Der Pfarrhof wurde in seiner jetzigen Gestalt auf Kosen des Staatsärars hergestellt. Ein Orkan zerriss in der Nacht auf den 1sten Juli 1813 alle Dächer. – Im Jahr 1817 wurden sämtliche Gebäude mit Blitzableitern bewaffnet.
Ehemals standen in den Umgebungen der Wallfahrtskirche an verschiedenen Punkten des Bogenberges fünf Kapellen. Östlich von der Kirche in der Nähe des Schulhauses war die im Jahr 1445 erbaute St. Alexius-Kapelle, deren Wände mit einer Vorstellung des Totentanzes bemalt gewesen sein sollen, und worin sich auch ein Grabstein des 1719 verstorbenen kurfürstlichen Pfleg-Verwalters von Mitterfels, Lict. Johann Gabriel Ertl befand, mit der Umschrift:
„Juri hin, Juri her,
Tod Recht gilt doch mehr!“
Die St. Michaels-Kapelle war ebenfalls in der Nähe der Hauptkirche. Diese beiden Kapellen wurden durch den Brand im Jahr 1803 zerstört. – Auf der Mitte des Bogenberges, am Hochweg bei den dermaligen Maulbeerpflanzungen, stand sie St. Jakobs-Kapelle, einst die Pfarrkirche des Marktes Bogen, die in neuerer Zeit ganz demoliert wurde. – Die St. Ulrichs-Kapelle am südöstlichen Abhang ist jetzt Privatgebäude des nächsten Hofbesitzers. Nur noch die im Jahr 1463 vom Kloster Oberalteich an der Stelle eines vormals hölzernen Kapellchens erbaute schöne freundliche St. Salvator-Kirche im Gehölz, am nordöstlichen Abhang des Berges, jetzt Eigentum der Gemeinde Bogen, ist neben der Wohnung eines Eremiten in gutem Zustand unversehrt erhalten. –
Mit Ausnahme der steilsten Abhänge ist der Berg kultiviert und bebaut. Einzelne Häuschen finden sich auf ihm an verschiedenen Punkten zerstreut. Ehemals zierten den Weg vom Markt Bogen aus auf den Bogenberg die gewöhnlichen Kreuzweg-Stationen, und schöne Linden boten dem Besteiger des Berges schattige Ruhepunkte. Davon ist jetzt nichts mehr sichtbar. In neuerer Zeit wurde der Kreuzweg demoliert, die schönen Linden schonungslos niedergehauen, bis auf eine, die noch, in der Nähe des Kalvarienberges stehend, an die frühere Verschönerung dieses Fußweges auf den Bogenberg erinnert.
Der Markt Bogen umgürtet den Fuß des Bogenberges in nordwestlicher Richtung, der hier mit den gegen Hunderdorf und Lintach sich erhebenden Ton- und Lehmhügeln ein Tal bildet, das ein Bach durchfließt, die Bogen genannt, der aus den Gebirgswässern bei Mühlbogen und Bürgl gesammelt, hart am Markt von Nordost nach Südwest vorbeifließt und sich in die Donau ergießt. Der Ort bestand schon zur Zeit der Grafen von Bogen und hatte sich schon im Jahr 1338 zum Markt erhoben, indem er vom Herzog Heinrich in Bayern durch eine in diesem Jahr am Tag der heiligen Scholastika gefertigte Urkunde mit einem Jahrmarkt begabt wurde. Des Marktes Wappen bildet ein silberner Schild, worin oben ein goldener Bogen und unten ein sechseckiger goldener Stern sich befinden.
Die Bewohner nähren sich zunächst von Feldbau und Viehzucht. Aber auch der Erwerb aus vielfachen bürgerlichen Gewerben ist beträchtlich, und es bestehen daselbst nicht weniger als zwölf Bierbrauereien. Ehemals wurde viel Bogener Bier wegen seiner Güte, die es vorzüglich den Granitfelsenkellern verdankte, auf der Donau verführt. Die Zahl der Häuser ist 182, die der Einwohner 1150. Das dortige Kranken-Spital, besonders auch zugleich der Pflege kranker Dienstboten und Handwerksgesellen gewidmet, verdankt seine Gründung dem Wohltätigkeitssinn der Markt-Bewohner. Die Kirche im Markt, dem heiligen Florian geweiht, ist ein Filial von Bogenberg. Im Jahr 1719 wurde sie mit der ganzen Seite des Marktes, auf der sie steht, durch Brand eingeäschert, aber nach drei Jahren aus den Mitteln des Klosters Oberalteich wiederhergestellt. Im Jahr 1836 verlor ihr Turm durch eine Feuersbrunst neuerdings seine hübsche Kuppel. Der Markt Bogen, der bis zum Jahr 1839 dem Landgericht Mitterfels einverleibt war, ist jetzt der Sitz eines neu errichteten Landgerichts, und hat sich seit einigen Jahren um vieles verschönert und in gewerblicher Hinsicht gehoben.
In der Nähe des Krankenhauses erblickt man in der Mitte des sogenannten Altwassers der Donau jenen nackten Granitfelsen, auf dem das Gnadenbild, das jetzt in der Kirche auf dem Bogenberg verehrt wird, gestanden haben soll. Die Sage erzählt von diesem Felsen, der den Namen Frauenstein führt, dass ihn das Wasser noch nie überflutet habe, daher die Dichtung Friedrich Müllers:
Schauet dort in Stromes Mitte
Jenen nackten Felsen an!
Der ist´s, dem mit milder Sitte
All die Wasser schweigend nah´n,
Den wir von der Berge Höh´n
Überflutet nie geseh´n.
Heilig hat ihn jede Welle
Für und immer anerkannt,
Weil auf der geweihten Stelle
Unser Berges Mutter stand,
Und so ehrt ihn ohne End
Selbst das kalte Element.
(aus: Kalender für katholische Christen auf das Jahr 1847, Sulzbach i. d. Oberpfalz)
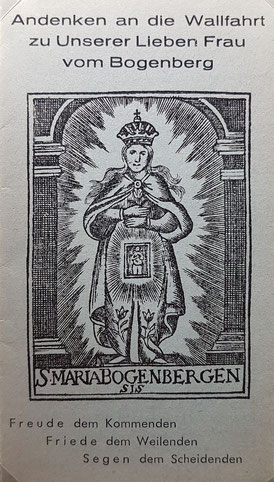
103. Der Herz-Jesu-Berg bei Velburg i. d. Oberpfalz
(aus: Kalender für katholische Christen auf das Jahr 1847, Sulzbach i. d. Oberpfalz)
Auf der Westseite der Stadt Velburg, im Landgerichtsbezirk Parsberg, erhebt sich freundlich ein ansehnlicher Berg, östlich und nördlich von Buchen, Fichten und Kiefern bewachsen, auf dessen Höhe der fromme Wallfahrer die liebliche Kirche erblickt, die der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu geweiht ist; daher dessen Name Herz-Jesu-Berg.
Auf diesem Berg, der in der Vorzeit Hohensberg genannt wurde, und in der Folge wegen des daselbst angelegten Kreuzweges und der Vorstellungen der Leidensgeschichte des Heilandes Kreuzberg, dann Kalvarienberg hieß, wohnten ehemals Einsiedler. Ihnen verdankt die dortige Wallfahrt hauptsächlich ihren Ursprung. Darunter zeichneten sich die zu Erbach, ehemals Churmainzischen Gebiets im Rheingau, gebürtigen Brüder Arsenius und Andreas Müller aus, die im vorigen (18.) Jahrhundert vom Jahr 1723 bis 1769 sich als Eremiten in der dortigen Klause befanden, und wovon der erstere den 23. November 1756, der zweite aber am 24. Januar 1769 gestorben ist. Andreas kaufte die Klause im Jahr 1723 von seinem Vorfahrer, dem Waldbruder Constantin, bewirkte mit seinem Bruder Arsenius meistens aus ihren eigenen Mitteln die Anlage des Kalvarienberges und die Auferbauung der kleinen Kapelle zum heiligen Grab, ehedem auch Kreuzkirchlein genannt, daselbst, und widmete zu deren Unterhaltung ein Vermächtnis von dreihundert Gulden, wie dies die nachstehende Inschrift auf einem von ihm selbst bearbeiteten Denksteine beurkundet:
„Ein hochlöblich Geistlicheß Commisariat in Velburg wolle Nachfolgente Vermogtnuß deren treyhundert Gulden zu unterhaltung ihres selbst Eigenen Calvariberg best mögligst versichert erhalten und damit nach meinem Absterben alles volzogen werde.
Zur Größerer Ehr Unserß liebsten heylandß Jesu Christi und seiner Werdesten Mutter Maria auch zu lieb unsereß lieben Calvaribergß welchen wir mit unserm bestendigem fleiß und Mitelen in solchen guthen stand gebracht und auch in die 40 Jahr erhalten Vermachen wir beede Gebrüder. F. Andreaß Müller und F. Arsenius Müller. Zu einer beständigen unterhaltung 300 Gulden. eß sol aber gleich nach unserer beeden absterben von obesagtem Capital eindunderd gulden zu einer Capelen oder kirchlein zum grab Christi gebaut werden der güthige und barmherzige Gott wolle unserer armen seelen Gnädig und barmherzig sein.
Vatter unser. ave Maria. Amen.
F. andreaß müller fecit.“
Dieser Eremit Andreas Müller vermachte auch zum Armen-Fond der Stadt Velburg ein Kapital von 110 fl., deren Zinsen an 12 Haus-Arme von Velburg ausgeteilt werden sollen.
Von Andreas Müllers Hand sind mehrere Bildhauer-Arbeiten daselbst vorhanden, besonders mehrere noch in seinem hohen Alter verfertigte Denksteine mit bildlichen Vorstellungen und religiösen Reimen. In der heil. Grab-Kapelle befindet sich das Bildnis des im Grab liegenden Heilandes in Lebensgröße von Holz. Daneben zwei Steine mit den Brustbildnissen Jesus und Maria, dann Jesus im Schoß Mariens unter dem Kreuz, und zwei andere mit Inschriften. – Im Presbyterium der Herz-Jesu-Kirche ist der Kanzel gegenüber eine in Müllers 72. Lebensjahr verfertigte Steintafel eingemauert, darstellend Jesus am Kreuz, unter demselben Marien in Magdalenens Schoß sinkend und Johannes, dann unter diesem Bild die Vorstellung der Geburt Jesu und der Anbetung der Hirten mit sehr gelungenem Ausdruck des Affektes der Freude, der Herzenseinfalt und Andacht. – In der Wand der Epistel-Seite des Hochaltares ist eine, in dessen 77. Lebensjahr verfertigte Steintafel eingemauert, welche die Vermählung Mariens vorstellt. Auf der Evangelien-Seite sieht man eine Steintafel, auf der der heilige Einsiedler und Abt Antonius als Prediger an einem abgelegenen Ort und die durch ihn entstandenen Ordensleute als Zuhörer abgebildet sind, mit folgender Inschrift:
Die wißenschaft nit bloß allein
kann große Männer machen.
Die Andacht muß der Meister sein
in allen Großen sachen.
der große Abt Andonius
hat nie kein schul betreten.
so gar nit schreiben noch lesen kont
alß nur allein daß betten.
und doch daß geistlich einsidler leben.
Von Andoni her ist komen.
wouon schier alle ordenstiffter
ihren anfang haben genomen.
Sein h. wandel und himmlisch sprüch.
und sein vollkomeneß leben.
waren blumen und tugendgerüch
allen Geistlich zum exempel geben.
Diese hier benente h. h. orden ihre Anfänger seint alle Einsidler gewesen.
Carmeliter Benedic. Carteus. Franzis. Celestin. gramontens. Calmaduens. paulauen.
Zu ehren deß h. Andoni hab ich Diesen stein verfertigt meines alterß im 74ten auf meinem Calvariberg nechst der statt Velburg 1764.
Noch ein von ihm ausgehauener Stein mit der Darstellung der zwei Jünger auf dem Gang nach Emmaus ist neben der Tür des Pfarrhauses zu Velburg eingemauert.
Die beiden frommen Eremiten beförderten nach Kräften den Besuch ihrer Kapelle. Die Versammlungen der Andächtigen zu ihr wurden immer zahlreicher. Da aber das Kirchlein seines zu engen Raumes wegen gar wenige Menschen fasste, so wurde im Jahr 1770 unter der Leitung des damaligen Stadtpfarrers Xaver Bertlin ein Anbau veranstaltet, zu dessen Ausführung die häufiger fallenden Opfer der Wallfahrer die Mittel darboten, und wozu auch das oben erwähnte Vermächtnis des Andreas Müller mitwirkte.
Bei dieser Erweiterung der heiligen Grabes-Kapelle, oder vielmehr Erbauung des neuen Kirchleins wurde ein neuer Altar verfertigt, und auf ihm das vom Kunstmaler zu Amberg Conrad Wild gemalte Bildnis des Herrn Jesus Christus, der sein Herz öffnet, aufgestellt. Das Kirchlein erhielt nun den Namen „zum heiligsten Herzen Jesu“.
Dieses neue Kirchlein und dessen Benennung zogen ungemein viele Menschen von sehr weit entlegenen Gegenden zur Andacht her, und schon kam die Wallfahrt so in Blüte, dass das Gebäude für die immer anwesende Volksmenge bei weitem nicht mehr groß genug war. Es fielen daher beträchtliche Summen, Opfer aller Art, und nach einem Zeitraum von 22 Jahren, da der Besuch dieser Wallfahrt von Tag zu Tag zunahm, kam man notwendiger Weise auf den Gedanken, die Kirche um vieles zu vergrößern und auch zu verschönern. Es fehlte hierzu nicht an Mitteln, und im Jahr 1792 stand schon wirklich das Gotteshaus, wie es dermalen zu sehen ist. Das Gebäude stellt ein Achteck vor, und beträgt in seiner Höhe, nebst dem darauf befindlichen 18 Fuß hohen Turm ungefähr 98 Fuß, in seinem Umkreis 194 Fuß. Die Kirche hat nebst dem Hoch- (Gnaden-) Altar noch zwei Seiten-Altäre mit sehenswerten Gemälden, deren eines das Bild Mariens in Lebensgröße, das andere das Bild des heiligen Sebastian darstellt. Die Bildhauerarbeiten an ihnen, so wie an der Kanzel sind von Joseph Dantl zu Velburg. Im Jahr 1817 wurde durch das Vermächtnis des im Jahr 1810 verstorbenen Stadtpfarrers zu Velburg, Michael Hayder, ein ganz neuer, von Adam Bittner aus Freystadt verfertigter Hochaltar aufgestellt.
Im Jahr 1795 wurde die Kirche mit Freskogemälden von Liborius Joseph Forster versehen, von denen das eine im Presbyterium das Abendmahl Jesu Christi mit seinen Jüngern vorstellt. Die übrigen bestehen aus Darstellungen von Wundern des göttlichen Menschenfreundes und Lehrmeisters. Das Bild über der Mitte des Schiffes der Kirche stellt Jesus dar, liebreich sein Herz öffnend, - um ihn herum Menschen aus allen Ständen versammelt, um Gnade und Barmherzigkeit flehend. – Im Jahr 1811 wurde auf dem Musikchor, zu dem auf beiden Seiten Wendeltreppen führen, eine neue Orgel mit zwölf Registern von Wilhelm Hepp, Instrumenten- und Orgelmacher in Amberg, aufgesetzt. – Am Sonntag nach Mariä-Heimsuchung 1826 wurde die Kirche von dem Bischof zu Eichstätt, Friedrich Oesterreicher, feierlich eingeweiht.
Als Hauptfesttage werden in dieser Wallfahrtskirche feierlich begangen: das Herz-Jesu-Fest am Freitag nach der Fronleichnams-Oktav, das Kirchweihfest am vorhin erwähnten Tag, das Titularfest der Bruderschaft zum heil. Herzen Jesu am Pfingstmontag. – Auch hier wird am dritten Freitag des Monats März feierlicher Gottesdienst gehalten, und außer der Fastenzeit monatlich Sonntag-Nachmittag Versammlung der Mitglieder der Bruderschaft zum heil. Herzen Jesu mit Predigt, Gesang und Gebeten. Zahlreich ist der Besuch des Herz-Jesu-Berges auch von Wallfahrern aus weiter Ferne, und bei den erwähnten feierlichen Andachten vermag sie die Kirche nicht zu fassen.
Das Häuschen des Eremiten enthält ein Wohnzimmer, eine Kammer und eine Kapelle, und hat über dem Dach ein Türmchen mit einem Glöcklein. Es ist mit einem Garten umgeben, der mit Obstbäumen bepflanzt und mit einer Zisterne versehen ist. Den Platz um die Kirche zieren kräftige Kastanienbäume, die erquickenden Schatten gewähren. Auf dem Weg von der Seite der Stadt den Berg hinauf zur Kirche sind die vierzehn Stationen des Kreuzwegs errichtet.
Die Stadt Velburg mit 187 Häusern und 1100 Einwohnern, der Sitz des königl. Rentamtes Parsberg, führt in ihrem Wappen einen roten, mit Gold gekrönten aufrechtstehenden zurücksehenden Löwen im goldenen Feld, und liegt in gebirgiger Gegend eine halbe Stunde nordöstlich von dem Fluss Laaber, der sich bei der Sinzing in die Donau ergießt, 3 Stunden vom Landgerichtssitz Parsberg und 5 Stunden von Amberg, zwischen zwei Bergen, dem Herz-Jesu-Berg und dem Schlossberg, auf dem man die Ruinen der ehemaligen Ritterburg erblickt. Das zum Bistum Eichstätt gehörige Rural-Dekanat des dortigen Sprengels trägt den Namen Velburg, und erstreckt sich über zehn Pfarreien. Die Seelenzahl der Pfarrei Velburg beläuft sich auf 1180. Der Pfarrer versieht die Seelsorge mit zwei Kooperatoren, und hat noch einen Frühmess-Benefiziaten neben sich. Die Pfarrkirche befindet sich in der Stadt. Nebenkirchen außer der Stadt sind die Wallfahrtskirche auf dem Herz-Jesu-Berg, dann die St. Annakirche auf dem Gottesacker, die Spitalkirche zu St. Leonhard, die Filialkirche zu St. Wolfgang an dem Dörfchen Hollenstein, eine Viertelstunde von Velburg, nordöstlich hinter dem Schlossberg, und die Filialkirche zu St. Colomann in dem Dorf Walkerswinn (Walkhertswünd), eine halbe Stunde von Velburg.
Velburgs Umgebungen sind mannigfaltig abwechselnd mit Berg und Tal, Wald und Feld. Ein angenehmer Weg führt zu dem ¾ Stunden entlegenen Dorf Lengenfeld bei Helfenberg.
Von den vielen vorhandenen Steinbrüchen liefern mehrere eine bedeutende Ausbeute. Reichlich finden sich manchfache Versteinerungen daselbst. Sehenswert sind die zwei großen Felsen-Berghöhlen zunächst an Hollenstein, die vordere vor Velburg am Weg nach St. Wolfgang, und die andere oberhalb dieser Kirche. Links von der ersteren, in der Mitte des Colomanni-Berges auf der Seite der Stadt unweit der Burgruinen, ziehen drei in Mannsgröße nebeneinander hochaufgestützte Felsen den Blick auf sich, - genannt die drei steinernen Jungfrauen (Ein halbzerrissenes Blatt im Stadtarchiv auf dem Rathaus zu Velburg meldet das Märchen: Die drey Töchter eines Ritters uff Velburg seynd von etlich flichtigen Buem davon geführt worten. Der Vater, als er den Raub von weitem noch zuegesehen, ist entbrunnen, und hat über die Metzen gefluegt, so, das die Weibsperson seynd zu stain geworten, und haben Müessen sten bleim.). So mühsam auch auf den vielen steinigen Plätzen und felsigen Anhöhen der Feldbau in der Markung von Velburg ist, so wird er doch mit unermüdlichem Fleiß und ausharrender Unverdrossenheit so vorteilhaft betrieben, dass er neben dem Erwerb der zahlreichen Gewerbetreibenden einen Hauptnahrungszweig der Bewohner bildet. Selbst der Hopfenbau ist von mehreren mit sehr gutem Erfolg unternommen worden. Das alte mutwillig scherzhafte Sprüchlein aus der Vorzeit: „Velburg, ein Städtlein im Nordgau, - nährt sich vom Bettel und Feldbau“ hat die erste Hälfte seiner Bedeutung längst ganz verloren.
Der Schlossberg, an dessen Fuß Velburg liegt, überragt mächtig alle anderen benachbarten Berge, und besteht beinahe ganz aus Felsenmassen. Auf der südlichen Seite ist eine riesenhafte und unbesteigbare Felsenwand. In der Vorzeit soll die Burg ganz mit Buchenwald umgeben gewesen sein. Heutzutage erblickt man nur noch am östlichen Abhang einiges Gebüsch. Dort befindet sich auch eine Felsenhöhlung, die jetzt zur Aufbewahrung des Bieres dient. Auf der süd- und westlichen Seite erkennt man die Spuren von Gartenanlagen und Zisternen. Von der festen Burg, die sich ehemals auf des Berges Spitze erhob, und einst kühn jedem feindlichen Anfall trotzte, ist nichts mehr übrig, als eine 6 bis 8 Schuh dicke Ringmauer mit zwei großen Toren, innerhalb derselben einige Überreste von Gewölben, Kellern, Backofen usw. Erst vor ein paar Jahren stieß man auf ein Gewölbe, und nachdem dies durchbrochen war, erkannte man die Kapelle. An der östlichen Ringmauer fand man ein menschliches Skelett in sitzender Stellung. Auf der Nordseite der Ringmauer steht noch ein 19 Fuß breiter und bei 152 Fuß hoher, ins Viereck gebauter Turm, einst Wachturm. Die Figur des Hauptgebäudes hat ein gegen Süden spitzig zulaufendes Dreieck gebildet. So weit dessen Umfang aus den Ringmauern zu bemessen sein mag, dürfte die Länge auf 190 und die Breite auf 150 Schuh anzunehmen gewesen sein. Die weite Aussicht, die sich von der Burgruine nach allen Richtungen darbietet, ist genussreich. Gegen Osten erblickt man die höchsten Punkte oder Berge des Bayerischen und Böhmer Waldes. Gegen Westen Sulzbürg, Wolfstein und Helfenberg. Gegen Süden Parsberg, Daßwang, Adlburg und Petersberg, und gegen Norden den Habsberg, die Kirche in Trautmannshofen und die Berge bei Sulzbach und Amberg.
Die Entstehung der Burg zu Velburg verliert sich in das Dunkel des grauesten Altertums. Als der älteste bekannte Besitzer der Herrschaft Velburg wird im Jahr 1117 Chuno von Velburg genannt. Im Zeitraum von 1125 bis 1154 kommen die Grafen Walchau, Hermann und Otto von Velburg, im Jahr 1188 Otto II., Graf von Kalmünz und Velburg, endlich in den Jahren 1198 bis 1217 Ulrich ebenso als Graf von Kalmünz und Velburg vor. Letzterer wallte im Jahr 1217 nach Jerusalem. Mit ihm erlosch das Geschlecht. Nun gedieh Velburg unter Herzog Otto dem Erlauchten an Bayern. – Nach dem Krieg wegen der Erbfolge in den Länderteilen Georg des Reichen zu Landshut kam Velburg kraft des Kölner Friedensschlusses von 1505 zum Herzogtum der Neu-Pfalz oder Pfalz-Neuburg. Der pfälzische Feldhauptmann Ritter Georg Wispeckh hatte sich in diesem Krieg für die Sache seines Fürsten, des Pfalzgrafen Rupert, - so wie nach dessen Tod (20. August 1504) für dessen Söhne Otto Heinrich und Philipp so verdient gemacht, dass ihn der Vormund der letzteren, Pfalzgraf Friedrich, im Jahr 1507 mit der Herrschaft Velburg belehnte. Georg Wispeckh brachte den Rest seiner Lebenstage in Ruhe als Wohltäter der Armen auf dem Schloss Velburg zu, wo er starb, und seine Grabstätte in der Stadtpfarrkirche empfing, die an ihrer äußeren Wand seinen Denkstein andeutet. Ihm folgte als Besitzer der Burg sein Sohn Ritter Hanns Adam Wispeckh. Sein Geschlecht erlosch in seinem Enkel Georg Hektor Wispeckh, den 30. September 1574. Das Lehen Velburg fiel nun an die Landesherrschaft des Herzogtums Pfalz-Neuburg zurück. Zwar erhob der Gemahl der Schwester Georg Hektors, Ameley (Amalia), Hanns Heinrich von Notthafft, namens dieser Ansprüche auf die Herrschaft Velburg, begab sich aber derselben im Jahr 1584 gegen Abfindung im baren Geld völlig im Weg des Vergleiches. Der Gerichtsbezirk der Herrschaft Velburg umfasste 49 Ortschaften; in diesem Umfang verblieb er unter der Benennung „Pflegamt“ bis zur Umgestaltung in das „Landgericht Velburg“ im Jahr 1802. Der letzte Pfleger war Wilhelm Straßer, der im Jahr 1802 als Landrichter, Kastner, Ungeld- und Steuereinnehmer genannt ist, als letzter Nebenbeamte unter der Benennung Landgerichtsschreiber, Leheninspektor, dann Kasten- und Ungeldamts-Gegenschreiber kam damals vor Joseph Röckl, als Amts-Physicus Thaddäus Link. In der Folge wurde jedoch das Gericht zu Velburg aufgelöst und dem Landgericht zu Parsberg einverleibt, jedoch blieb der Sitz des Rentamts zu Velburg.
Ritter Hanns Adam Wispeckh bekannte sich im Jahr 1546 zur Lehre Luthers. Die Einwohner der Stadt Velburg und der ganzen Gegend folgten dem Beispiel ihres Herrn. Hanns Adams Sohn, Ritter Georg Hektor, trat jedoch zur Kalvinischen Konfession über. Der erste protestantische Pfarrer zu Velburg war im Jahr 1546 Georg Groll. Als im Jahr 1596 daselbst eine Superintendentur errichtet wurde, waren die dortigen Pastoren zugleich auch Superintendenten. Nachdem im Jahr 1614 Herzog Wolfgang Wilhelm zu Neuburg zur katholischen Religion übergetreten war, taten die Einwohner von Velburg vom Jahr 1618 an nach und nach ein Gleiches. In diesem Jahr erschien wieder ein katholischer Pfarrer daselbst – Matthäus Fleischmann.
Die Ritterburg wurde nach dem Erlöschen des Wispeckhischen Manns-Stammes nur noch einige Jahre von des letzten Lehensbesitzers Schwager, Heinrich von Notthafft, bis zum Ausgang der Erbsansprüche seiner Gemahlin bewohnt. Seit seinem Abzug blieb sie unbewohnt, und alterte ihrem Verfall entgegen. Im dreißigjährigen Krieg machten die Schweden einen Angriff auf sie. Im Jahr 1634 bemächtigte sich der schwedische Oberst Claus Haßner des Schlosses und der Stadt Velburg. Doch war die Beschädigung der Schlossgebäude durch das feindliche Geschütz nicht bedeutend, und wäre, wie der Pflegscommissär und Kastner zu Velburg in den Jahren 1724-1730 – Johann Rudolph von Windisch – berichtet, leicht mit einem Aufwand von 150 fl. wieder zu reparieren gewesen. „Allein,“ so schreibt Windisch in seinem Grundbuch, „ein pflichtvergessener Pflegsbeamte dahier, namens Valentin Praun (Pfleger und Kastner in den Jahren 1644-50), ließ eigenmächtig die Dächer abtragen, verkaufte die Ziegel und Taschen, und behielt das Geld für sich. Es wurde zwar dieser Dieb seines Vergehens wegen kassiert, jedoch an der Burg nichts mehr repariert, sondern selbe dem völligen Untergang überlassen. Damit verfiel auch die Schlosskapelle (dem hl. Pancraz geweiht), zu der noch das an dem Helfenbergischen Holzberg – Eichelberg genannt – gelegene Pancrazen-Hölzl gehört. Nicht minder wurden auch die Grabstätten der dortliegenden fürstlichen und anderer adeligen Personen, unter andern auch jenes des Heribert – Grafen von Lengenfeld (Burglengenfeld), nebst den dazu gehörigen Monumenten und Epitaphien verschüttet. Nachmals wurden mit gnädigster Consens viele Steine zur Reparation der Velburger Pfarrkirche 1720 verwendet.“ Späterhin nahm von den Schlossruinen jedermann Steine, wer ihrer bedurfte. So geschah es, dass von der stattlichen Burg nichts mehr übrigt, als die oben beschriebene Ruine.
________________________________________________________________________

104. Dorfen
(aus: Kalender für katholische Christen auf das Jahr 1847, Sulzbach i. d. Oberpfalz)
In einer der fruchtbarsten Gegenden Oberbayerns, zwischen den gesegneten Hügeln von Erding und Ampfing zieht sich ein freundliches Tal von Osten nach Westen, das Isental genannt. In einer Länge von sieben Stunden und fast durchgehend eine halbe Stunde breit, ist es begrenzt von üppigen Fruchtfeldern, während seinen Wiesgrund das Flüsschen Isen durchschlängelt und reichlich bewässert. Fast im Mittelpunkt dieser Tallänge befindet sich der freundliche Markt Dorfen (Maria-Dorfen) mit 207 Häusern und 1260 Einwohnern (heute ca. 14.000), im Bezirk des Landgerichts Erding und in der erzbischöflichen Diözese München-Freising, 3 Stunden von Erding, 11 von München und 7 von Landshut. Gegen Osten und Westen dehnt sich dort das Tal in eine schöne, lange Ebene aus. Gegen Süden und Norden ist die Gegend bergig, doch sehr fruchtbar. Ein tiefer, mit Wasser gefüllter Graben umgibt den Markt. Die ursprüngliche Ansiedelung bestand in drei Häusern, dem Eigentum dreier, mit großem Besitztum im Isental begüterter Brüder, woher noch das Bild von drei Häusern im blauen Feld im Schild des Markt-Wappens. Nach und nach bauten sich wegen der angenehmen Lage und Fruchtbarkeit der Gegend mehrere Familien an. So entstand allmählich der jetzige gewerbsame Markt Dorfen mit seinen Straßen in Kreuzform und vier, je zwei gegeneinander überstehenden Toren.
Unmittelbar außer dem Markt am nördlichen Hügelrand erhebt sich der Ruprechtsberg, auf dessen Rücken eine große, herrlich ausgestattete Kirche emporragt, erbaut zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria, und weithin bekannt als ehrwürdiger Gnadenort. Westlich vom Gotteshaus ziert den Ruprechtsberg ein großes Quadratgebäude, das Priesterhaus, das wie ein ansehnliches Schloss das Tal beherrscht, und dem Auge einen lieblichen Überblick über dasselbe gewährt. Leicht und bequem steigt man den Berg über 148, mehrmals mit Ruheplätzen unterbrochene, rotmarmorne Stufen hinan.
Nach alter Sage soll der heilige Rupert (Ruprecht) bei seinen apostolischen Wanderungen durch Bayern auf diesem Berg gewohnt und gepredigt haben, daher dessen Name „Ruprechts- oder Ruperts-Berg“. Rupert soll daselbst die Kapelle erbaut und eingeweiht haben, die heutzutage die heilige Josephs-Kapelle genannt wird. In ihr soll auf Anraten und Geheiß dieses Heiligen, der um das Jahr 718 oder 723 selig im Herrn entschlief, schon zu seiner Lebenszeit, oder bald nachher das wundertätige Marienbild aufgestellt worden sein, das bis jetzt mehr als 1100 Jahre hindurch der Gegenstand der allgemeinen öffentlichen Verehrung ist.
Im Jahr 1350 wurde neben der kleinen Kapelle auf dem Ruprechtsberg eine neue schöne geräumige Kirche, 153 Fuß lang und 54 Fuß breit, mit einem hohen Turm erbaut. Nun wurde das Marienbild auf den Hochaltar dieser neuen Kirche übersetzt, wo es noch gegenwärtig seine Stelle einnimmt. Dieses Bildnis erscheint, wenn es von dem ihm beigelegten Schmuck der gold- und silbergestickten Kleider und der Krone entblößt ist, als ein meisterliches Werk alter Bildhauerkunst. Es ist aus einem ganzen Stück Lindenholz geschnitzt, und hält (in sitzender Stellung) in der Höhe 5 Schuh 4 Zoll, in der Breite 4 und in der Tiefe 2 Schuhe. Das Haupt neigt sich ein wenig zur Rechten, und ist umwallt von langen blonden Haaren; die Züge des länglichen Angesichts zeichnen die heilige Jungfrau als eine mächtige, aber liebevolle Himmelskönigin; das Auge strahlt hell und lieblich. Die Rechte hält das Jesuskind auf dem Schoß, die Linke eine Rose. Das lange Kleid ist von roter Farbe mit vergoldeter Verbrämung. Die Mitte des Leibes umgibt ein Gürtel, den eine vergoldete Schnalle zusammenhält. Auf dem Herzen sind die Worte eingeschnitten: „Mutter der Gnaden.“
Die Verehrung des Marienbildes in der neuen Kirche zog viele Andächtige dahin, und bald erblühte der Ruprechtsberg zu einem sehr besuchten Wallfahrtsort. Schon um das Jahr 1400 wurde er häufig von Fremden besucht. Der Ruf der Wundertätigkeit verbreitete sich immer mehr, und in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde Maria-Dorfen unter die blühendsten Wallfahrten in Oberbayern gezählt. Dieses beurkundet das uralte Mirakelbuch aus dem Archiv des 1 ½ Stunden von Dorfen entlegenen ehemaligen Kollegiatstiftes zu St. Wolfgang, in dem auch spezielle Wunderwerke von der Wallfahrt Dorfen aufgezeichnet sind. Um jene Zeit entstanden mehrere Gasthäuser auf dem Berg in der Nähe der Kirche zur Aufnahme der zahlreichen Wallfahrer, die häufig in ganzen Zügen einzelner oder mehrerer Pfarrgemeinden zusammen dahin kamen. Das letzte von ihnen, ein bedeutend großes, wurde erst im Jahr 1664 abgebrochen und dessen Material zum Kirchenbau in Zeilhofen verwendet. Im Markt sollen zur Beherbergung und Verpflegung der Pilger neun Weinwirte bei gutem Nährstand gewesen sein. Laut eines alten Saalbuches waren 8 oder 9 Priester zu Dorfen anwesend, um die Dienste bei der Wallfahrtskirche zu versehen. Unter solchen Umständen nahm die Vergrößerung des Marktes zu, und mehrte sich der Wohlstand seiner Bewohner.
Aber die unheilvolle Zeit des dreißigjährigen Krieges brachte dem Wallfahrtsort großes Verderben. Beim Einfall der schwedischen Truppen wurde die Kirche von den rohen feindlichen Kriegern entheiligt. Sie musste als Pferdestall und Schlachthaus dienen, der Choraltar als Feuerherd. Die Altarzierden, Votivtafeln, Urkunden, die alten Mirakelbücher wurden den Flammen preisgegeben, das Gnadenbild wurde vom Altar gerissen, verunehrt und mit Kot beworfen, blieb jedoch ohne Verletzung und Verstümmelung unversehrt erhalten. Die Wallfahrtspriester hatten die Flucht ergriffen. Bei diesen Verwüstungen, und unter den schweren Leiden durch Teuerung, Hunger, Krankheiten und Elend aller Art, als unseligen Folgen des Krieges, womit das Volk zu kämpfen hatte, geriet die Wallfahrt in Verfall. Der Eifer der Einwohner von Dorfen und ihrer geistlichen Vorsteher verhinderten jedoch, dass sie nicht ganz in Vergessenheit kam; sie boten alles auf, den entheiligten und beraubten Gnadenort so viel als möglich bald wieder herzustellen. Besonders tätig wirkten der Pfarrer Georg Eberl und der Prediger Georg Reisacher, dessen Nachfolger, das Vertrauen zur Gottesmutter unter den Gläubigen wieder rege zu machen und den Ruhm der Wallfahrt aufs Neue zu begründen verstanden. Neben vielen anderen Andachten führte Pfarrer Georg Eberl im Jahr 1657 die Erzbruderschaft des heiligen Rosenkranzes ein; dann späterhin die Fastenpredigten und Roratemessen oder Engelämter im Advent, ließ eine neue Orgel bauen, und stellte neben dem Organisten noch einen eigenen Kantor an. Im Jahr 1695 wurde von der Bürgerschaft zu Dorfen das Frühmess-Benefizium in der Markt-Kirche zu St. Veit gestiftet.
Als vorzüglicher Beförderer der Wallfahrt zu Dorfen wird der dortige Pfarrer Joseph Sailer gepriesen. Sogleich beim Antritt seines Pfarramtes, im Jahr 1705, verwendete er 3000 fl. seines eigenen Vermögens zur Ausstattung des Gotteshauses auf dem Ruprechtsberg. Die Orgel und der Choraltar wurden neu gefasst, die Seitenaltäre neu gebaut und die ganze Kirche geschmückt. An der östlichen Seite der Kirche wurde das Presbyterium durch einen Anbau vergrößert, ebenso wurde die Kirche rückwärts erweitert, der Kirchturm und das Dach ausgebessert, die Kirchhofmauer vergrößert. Es wurde eine neue Glocke, eine neue Kirchenuhr angeschafft, desgleichen neue Baldachine über das Marienbild und viele andere wertvolle Ornate, die Totenkapelle südlich neben der Kirche neu ausgemalt und mit einem Altar versehen. Vom Päpstlichen Stuhl wurde im Jahr 1711 ein vollkommener Ablass für alle erwirkt, die den Gnadenort mit Ablegung reumütiger Beichte und Empfang der heiligen Kommunion besuchten. Sailers Predigten flossen über von Andacht und Vertrauen zu Maria, und er besaß die Macht, jene Liebe, die er zur Gottesmutter hegte, auch andern einzupflanzen. Er mehrte und beförderte die kirchlichen Andachten nach Kräften. Das Vertrauen zum Gnadenbild nahm in jenen Tagen bewunderungswürdig zu. Er ließ metallene, silberne und vergoldete Gnadenpfennige prägen, und teilte sie unter die Wallfahrer aus, damit sie das Andenken an Maria erhalten und bei anderen erwecken möchten.
So wirkte Sailer mehr als dreißig Jahre für das Gedeihen der Wallfahrt, bis er im 82. Jahr seines Alters, am 16. Januar 1737 sein tätiges Leben endete.
Der Ruf der in Menge gepriesenen Wunder von der hilfreichen göttlichen Mutter zu Dorfen verbreitete sich allenthalben. Auf Sailers Bericht wurde im Jahr 1707 vom Fürstbischof zu Freising eine Kommission zur Untersuchung und Prüfung der aufgezeichneten vorzüglichsten Wundertaten niedergesetzt. 130 Beteiligte wurden eidlich über die ihnen erzeigte Wunderhilfe (meistens unerklärliche Heilungen) abgehört, verschiedene medizinische und polizeiliche Zeugnisse abgenommen, und die 10 ältesten Personen in und um Dorfen, ebenfalls beeidigt, über den früheren Ruf und Bestand der Wallfahrt vernommen; die älteren und neueren Dokumente geprüft, und hierauf nach Erwägung aller Umstände durch bischöflichen Ausspruch das Marienbild erwiesen als gnadenreich und wundertätig erklärt, und hierauf am Fest der heiligsten Dreieinigkeit, den 19. Juni, unter dem Jubel einer ungemeinen Volksmenge von der Priesterschaft in feierlicher Prozession im Markt herumgetragen. Nun wurde der Zulauf der Andächtigen zum Gnadenbild zu Maria-Dorfen von Jahr zu Jahr immer größer: auch aus fernen Ländern kamen Pilger zahlreich herbei. Im Jahr 1716 belief sich die Zahl der Kommunikanten daselbst über 48.000, und in manchem der nächstfolgenden Jahre über 100.000.
Dem Bedürfnis eines bequemen gemeinschaftlichen Wohnhauses für die Wallfahrtspriester wurde durch Erbauung des großartigen Priesterhauses zunächst der Kirche auf dem Ruprechtsberg auf Anordnung des Fürstbischofs Johann Franziskus (Freiherrn v. Egther) von Freising und durch die eifrige Bemühung seines geistlichen Rates Kanonikus Philipp Lindmayer abgeholfen. Am 9. September 1717 wurde der Grundstein dazu gelegt, und nach zwei Jahren war der Bau mit einem Aufwand von 16.000 fl. so weit vollendet, dass er von den Priestern bezogen werden konnte. Er erhielt auch eine schöne Hauskapelle, die zu Ehren der heiligen Apostel Peter und Paul eingeweiht ist. Diese Anstalt bezweckt zugleich, dass vorzüglich neu ordinierte Priester daselbst neben dem Dienst für die Wallfahrt auch praktisch in die Seelsorge eingeübt werden sollten. Ein Priesterhaus-Direktor führte die Leitung des ganzen Instituts. Die Zahl dieser Kuratgeistlichen belief sich in der ersten Zeit auf vierzig; da sie in der Folge noch höher stieg, wurden mehrere von ihnen im Markt untergebracht. Der Sitz der Pfarrei war nicht im Markt Dorfen, sondern in dem eine viertel Stunde davon entfernten Dorf Oberdorfen, wo der Pfarrer mit drei Hilfspriestern wohnte. Im Markt befand sich nebst dem Frühmess-Benefiziaten nur der Prediger als exponierter Pfarr-Kooperator. Erst im Jahr 1813 erhielt Maria-Dorfen eine eigene selbstständige Pfarrei. Doch war die sehr beträchtliche Pfarrei Oberdorfen mit ihren 11 Filialen schon vom Jahr 1737 am Priesterhaus auf dem Wallfahrtsberg als Einkommens-Zugabe einverleibt. Der erste Pfarrvikar Vitus Kreitmayer hatte ein jährliches Absent von beiläufig 200 fl. zu entrichten. Nach seinem Tod aber, im Jahr 1761, war der jeweilige Priesterhaus-Direktor selbst Pfarrvikar von Oberdorfen, wo im Pfarrhof der erste Kooperator als Ökonomie-Verwalter aufgestellt war.
Im Jahr 1775 erhielt das Priesterhaus eine wesentliche Umgestaltung. Ludwig Joseph (Freiherr v. Welden), Fürstbischof von Freising, beschloss, mit dem Priesterhaus eine geistliche Pflanzschule für angehende Weltpriester der Diözese Freising zu verbinden. Zur Ausführung dieses Unternehmens boten die zwei Brüder Anton und Peter von Oberwexer, Wechselherren zu Augsburg, großmütig ihre Hand. Auf ihre Kosten ließen sie das erforderliche Gebäude in seiner gegenwärtigen Gestalt herstellen und mit der nötigen Hauseinrichtung versehen. Das ursprüngliche Priesterhaus bildete einen rechten Winkel, die eine Seite gegen Süden, die andere gegen Osten. Nunmehr schuf ein gleicher Anbau gegen West und Nord das Ganze zu einem regelmäßigen und schönen Quadratgebäude um. Die eine Hälfte blieb für das Priesterhaus bestimmt, die andere, neugebaute aber sollte zum Seminar der Alumnen dienen. Am 1. Juni 1778 stand der Bau in seiner Vollendung da. Jährlich wurden zwanzig Kandidaten der Theologie für jeden der beiden Kurse aufgenommen. Mit dem Beginn des ersten Jahres empfingen sie die vier niederen Weihen, um Pfingsten des zweiten Jahres das Subdiakonat, und bis Ende September das Diakonat und Presbyterat. Als Priester verweilten sie dann noch ein Jahr zur praktischen Ausbildung im Priesterhaus, bis sie zu einer Hilfspriester-Stelle abgerufen wurden. Arme Zöglinge des Seminars fanden daselbst unentgeldlichen Unterhalt, die vermöglicheren bezahlten einen ihren Umständen angemessenen Beitrag.
Die Haupt-Wohltäter des Seminars, - die Brüder von Oberwexer – fuhren fort, dasselbe auch nachher noch kräftig zu unterstützen. Außerdem empfing das Institut auch bedeutende Gaben vom Kanonikus und Dechant des Stiftes zu St. Andreä in Freising, geistl. Rat Joh. Georg Kaiser, dem Pfarrer zu Hohenbrunn, geistl. Rat Martin Augustin von Hofstetten und dem Kuratpriester Joseph Ignaz Daser zu Oberammergau. Auch wurde demselben die 1 ½ Stunden entfernte Pfarrei Hofkirchen einverleibt (was sie bis zum Jahr 1803 verblieb), und späterhin, im Jahr 1784, das Benefizium im benachbarten Dörfchen Zeilhofen.
Die oberste Leitung des Seminars und Priesterhauses wurde dem Domkapitular Graf von Lehrbach als Regens primarius übergeben, der auch oft einige Zeit in Dorfen verweilte. An die Stelle des Direktors trat ein Regens, zugleich Pfarrvikar, welchem zwei oder drei Professoren beigegeben waren. – Nach 26jährigem Bestehen wurde aber dieses Diözesan-Seminar wieder aufgelöst und mit dem Gregorianischen Klerikal-Seminar an der Universität zu Landshut vereinigt. In Dorfen verblieb nur das Priesterhaus. Diesem wurde, außer seiner bleibenden Haupteigenschaft als Wohnung der Wallfahrtspriester, nun auch eine andere neue Bestimmung beigelegt, nämlich zum Aufenthaltsort für Geistliche, die unter besonderer Aufsicht gehalten, oder zur Korrektion und Pönitenz dahin verwiesen werden sollen, zugleich aber auch als zum ruhigen Asyl für emeritierte Priester nach freier Wahl, so wie auch als Verpflegungs-Anstalt für unglückliche Geisteskranke dieses Standes. Zu diesem Ende wurden die ganze weite Front eines Seitenflügels entlang, an der Stelle der Dormitorien (Schlafsäle) und Museen (Studiersäle), zehn Gemächer eingerichtet.
Die letzte Hauptveränderung in den Verhältnissen des Priesterhauses erfolgte endlich im Jahr 1813. In diesem Jahr wurde die umfangreiche Pfarrei Oberdorfen in zwei selbstständige Pfarreien geteilt. Der Markt Dorfen erhielt nun seine eigene Pfarrei mit dem größten Teil des vormaligen weitläufigen Pfarrsprengels, welcher die Marktgemeinde und die Filiale Angerskirchen, Hampersdorf, Kleinkatzbach, Jaibing, Kienraching, Vils, Rettenbach, Stafing und Rinning mit einer Anzahl von 2374 Seelen umfasst, und von dem Pfarrer mit drei Kooperatoren, wovon der erste als Prediger bestellt ist, pastoriert wird, woneben noch der Frühmess-Benefiziat im Markt Dorfen besteht. – Das Pfarramt wurde mit der Stelle des Priesterhaus-Direktors vereinigt, und die Wallfahrtskirche zu U. L. Frau auf dem Ruprechtsberg zur Pfarrkirche erhoben (Die Kirche im Markt Dorfen ist dem heiligen Vitus gewidmet, und mit dem oben erwähnten, von der Ortsgemeinde im Jahr 1695 gestifteten Frühmess-Benefizium versehen. Nebstdem sind daselbst noch zwei Nebenkirchen außer dem Markt, die St. Sebastianskirche und die Altöttinger Kapelle. Das Rural-Dekanat, das den Namen „Dorfen“ führt, umfasst dermal acht Pfarreien. Ehemals, vor Bildung eines eigenen Dekanats zu Velden, erstreckte es sich über sechzehn Pfarreien.). Der Pfarrei zu Oberdorfen verblieb der kleinere, westliche Teil ihres vorigen Umfangs mit dem Pfarrsitz Oberdorfen und den Filialen Landersdorf, Esterndorf, Niedergeiselbach, Zeilhofen und Lindum mit einer Anzahl von 1064 Seelen, die der Pfarrer mit einem Kooperator und dem Benefiziaten zu Zeilhofen versieht. Als erster Pfarrer zu Maria-Dorfen wurde der Priesterhaus-Direktor Joseph Hilz ernannt, nunmehriger Stadtpfarrer zu Kehlheim. Gegenwärtig ist daselbst Pfarrer und Priesterhaus-Direktor, zugleich auch Distrikts-Schul-Inspektor, der vormalige Professor der Theologie am Lyzeum in Freising, Herr Anton Schmitter.
Indessen hatte die Wallfahrt Dorfens in dem Flor und Glanz, zu dem sie im Anfang des 18. Jahrhunderts emporgestiegen war, im Laufe dieses Jahrhunderts sich fortwährend erhalten. Zur Beförderung des zahlreichen Besuches der Andächtigen hatten mächtig die Beispiele erlauchter Fürsten mitgewirkt, so Kurfürst Max Emanuel, der im Jahr 1719 zu Fuß dahin wallfahrtete; desgleichen Kurfürst Carl Albert, - nachher deutscher Kaiser, - im Jahr 1721 und mit seiner Gemahlin Maria Amalia im Jahr 1736; - und so viele andere fürstliche und hohe Personen. Der Fürstbischof Johann Franz hatte im Jahr 1718 die Prozession der Bürgerschaft von Freysing in eigener Person dahin geführt; desgleichen wallfahrtete er im Jahr 1719 am 2. Oktober zu Fuß nach Dorfen. – Eins der glänzendsten Feste feierte die Wallfahrtskirche im Jahr 1757 vom 2. Oktober an acht Tage hindurch. Es war die Jubelfeier der vor einem Jahrhundert in derselben errichteten Rosenkranz-Bruderschaft, die mit außerordentlicher Pracht begangen wurde. Von allen Seiten strömten Andächtige herbei. Jeder Tag wurde mit feierlichen Kanzelreden von den vorzüglichsten Predigern der Umgegend, mit solennen Hochämtern von den vornehmsten Gästen aus der hohen Geistlichkeit, mit Prozessionen und anderen kirchlichen Andachten verherrlicht. Es erschienen bei sechzig entfernte Pfarrgemeinden. Der Zudrang der Wallfahrer war so groß, dass täglich mehr als dreißig Beichtväter vom frühen Morgen bis zum späten Abend beschäftigt waren. Mehr als 20.000 empfingen die heilige Kommunion: - während der Oktav wurden wenigstens 460 heilige Messen in der Marienkirche gelesen.
Am 4. Januar 1782 ereignete sich um 9 Uhr am Abend in der Wallfahrtskirche das Unglück, dass ein Hauptpfeiler zusammenstürzte, und mit ihm ein großer Teil des Gewölbes. Da auch der Dachstuhl ruinös war, so musste der größte Teil des Gebäudes abgebrochen und so die Kirche ganz neu hergestellt werden, so dass der Bau in einer Art byzantinischen Stils ohne Pfeiler in gegenwärtiger Gestalt im Jahr 1786 vollendet wurde. Bis dahin beliefen sich die Baukosten auf 15.529 fl. Die Kasse des Gotteshauses war erschöpft. Da boten fromme Wohltäter hilfreiche Hand. Die Herren von Oberwexer in Augsburg ließen im Jahr 1786 die herrliche Freskomalerei der Kirche durch den Kunstmaler Huber von Augsburg ausführen; die Pfarrgemeinde Dorfen bestritt die Kosten für Fassung und Vergoldung; Graf Johann Theodor von Morawitzky ließ 1790 die herrliche Kanzel von Gips-Marmor verfertigen; der Landrichter in Erding, Freiherr von Widmann, den Johann-Nepomuk-Altar. Der Domkapitular Graf von Lehrbach ließ die Josephs-Kapelle ausmalen und den Altar darin bilden und fassen. So erfolgte dann am 24. Oktober 1790 auch die neue Einweihung der Kirche durch den Fürstbischof zu Freising und Regensburg, Fürstpropsten zu Berchtesgaden, Joseph Konrad (Freiherr v. Schroffenberg), der auch vor seiner Konsekration die geistlichen Exerzitien vom 2. bis 5. August 1790 im dortigen Priesterhaus gemacht, und täglich die hl. Messe in der Marienkirche gelesen hatte.
In dieser Kirche, deren auf breite und vorspringende Mauern gestützte Gewölbe ohne Säulen sind, fesselt die majestätische Zierde des Hochaltars, auf dem das Gnadenbild thront, am meisten die Aufmerksamkeit des Besuchers.
Der Tabernakel ist von feuervergoldetem Kupfer, mit zierlich gearbeitetem silbernen Laubwerk reichlich geschmückt. Der nach der Zeichnung des berühmten Kunstmalers Egid Quirin Asam zu München gebaute Altar nimmt die ganze Breite des Chores ein; das Postament ist von rötlichem, mit weißen Adern durchzogenen Marmor über sechs Fuß hoch; zu beiden Seiten erheben sich zwei gewundene, schön marmorierte Säulen mit zierlichen Kapitälen, auf denen marmorierte Gesimse mit antiken Verzierungen ruhen. Vor den Säulen knien zur Rechten des heiligen Dominikus, zur Linken die heilige Katharina von Senis, - die beiden Haupt-Patrone des heiligen Rosenkranzes, - beide, gut vergoldet, in Lebensgröße und in anbetender Stellung gegen das Marienbild gerichtet. Neben den Säulen stehen ebenfalls in Lebensgröße, schön gearbeitet und gut vergoldet, auf der Evangelien-Seite die Statue des hl. Papstes Silvester, auf der Epistel-Seite die Statue des hl. Rupert. In der Mitte des Altars ruht auf einem feuervergoldeten, mit silbernen Laubwerken gezierten Thron das Gnadenbild der wundertätigen Maria. Der Thron selbst schwebt auf einem silbernen, 3 Fuß hohen Gewölk, das Engelsköpfe umgeben und vergoldete Strahlen durchschimmern. Zwei große schwebende Engel mit ausgespannten vergoldeten Flügeln halten den Thron. Etwas weiter unten befinden sich zwei kleinere fliegende Engel von Silber, die ein Füllhorn mit zwei Leuchtern tragen, die zur Erleuchtung des Bildes dienen. Hinter dem Thron aufwärts schimmert ein feuervergoldeter Strahlenschein mit glühender Sonne in der Mitte und um den Lichtkranz herum blinken wie die Sterne, in Form eines Kranzes, aus Silber gearbeitet, die fünfzehn Geheimnisse des heiligen Rosenkranzes auf künstlich gefertigten Schilden.
Den obersten Teil des Altars schmückt ein feuervergoldeter Baldachin mit silbernen Quasten. In dessen Mitte erhebt sich das Bild der heiligsten Dreifaltigkeit von Silber, mit einer Krone geziert. Zwei große versilberte Engel, auf den Kapitälen der Säulen ruhend, halten den Baldachin. Im Hintergrund fällt ein großer vergoldeter Vorhang zu beiden Seiten bis auf den Thron hernieder. Die Kosten der Fassung dieses Hochaltars wurden durch Beiträge der Pfarrgemeinden und anderer Wohltäter, dann aus den Mitteln der Rosenkranzbruderschaft bestritten.
Ein neues Unglück traf die Kirche auf dem Ruprechtsberg am 3. Juli 1794. An diesem Tag abends schlug der Blitz zweimal nacheinander in den Turm ein. Ehe nur Hilfe möglich war, brannte der Turm aus. Die Glocken zerschmolzen. Am 16. September desselben Jahres gerieten vier große Kirchenstühle in Brand, dessen Rauch den Fresken am Plafond großen Nachteil brachte. Im nächsten Jahr (1795) wurde der Turm zur notdürftigen Benützung hergestellt, und mit 6 Glocken versehen, ausgebaut aber erst im Jahr 1805. Als im Jahr 1801 zur Bestreitung der Bayern auferlegten Kriegs-Kontribution allenthalben das Kirchensilber in Anspruch genommen wurde, traf diese Kirche ein großer finanzieller Verlust von etwa 10.000 fl. In jüngster Zeit wurde im Jahr 1844 das Innere der Kirche verschönert, die Plafondgemälde gereinigt, die Girlanden, die Kapitäle der Mauerpfeiler, die Fassung der Kanzel usw. vergoldet, der Baldachin des Marienbildes restauriert, die Tumben der Seitenaltäre renoviert, der Kreuzaltar neu hergestellt, auch die beiden Nebenkapellen, die St. Josephs- und die Armen-Seelen- oder Toten-Kapelle repariert. Mehrere wertvolle Ornatstücke, Andachtsbilder, Gerätschaften, Musikinstrumente usw. angeschafft. All dies in einem Kostenbetrag von mehr als 3000 fl., durch Mittel aus Beiträgen von den Pfarrgenossen und freigebigen Wohltätern, worunter ein Legat zu 800 fl. von dem im Jahr 1843 verstorbenen Färbermeister Weitzenböck erwähnt zu werden verdient.
So steht nun das erhabene Gotteshaus auf dem Ruprechtsberg in erneuter Pracht da. Wenn auch unter den Ereignissen der neueren Zeit ein paar Jahrzehnte hindurch die Wallfahrt Maria-Dorfens eine bedeutende Abnahme erlitten hatte, so blieb doch das Vertrauen zu diesem Gnadenort stets unerschüttert, und ist dermal wieder im vollen Aufschwung, wie es das Herbeiströmen Andächtiger aus nahen und fernen Gegenden bei jeder Gelegenheit bewährt, so dass an der Erfüllung der Hoffnung nicht zu zweifeln ist, er werde sich bald wieder zu seinem vorigen Glanz erheben.
pilgerwegvonlengdorfnachmariadorfen
________________________________________________________________________

105. Das Bistum Eichstätt 1845
(aus: Kalender für katholische Christen auf das Jahr 1847, Sulzbach i. d. Oberpfalz)
I. Entstehen und Stifter des Bistums Eichstätt
Seit die heilbringende Lehre Jesu bald nach seinem Tod und seiner glorreichen Himmelfahrt sich nach allen Richtungen zu verbreiten angefangen hatte, blieb auch Europa nicht mehr unbekannt mit dieser Lehre, nicht ausgeschlossen von ihren Segnungen. Durch die Machthaber des größten Teils der damals bekannten Welt, die Römer, wurden die ersten Samenkörner des Evangeliums ausgestreut, und sprossten allmählich im Verlauf von 4 Jahrhunderten zur lieblichen Saat empor. Sogar die Stürme der wütendsten Verfolgungen und der verheerendsten Kriege waren nicht mehr imstande, die Pflanzung einer höheren Hand in Italien, Frankreich, Spanien, Britannien etc. zu vertilgen oder auszurotten.
Selbst auch in einen großen Teil unseres deutschen Vaterlandes war das Licht des Evangeliums gedrungen, und von Italien her bis an und über die Donau, von Gallien bis an den Rhein und Main fanden sich einzelne Bekenner oder ganze Gemeinden, die inmitten der Heiden dem Christentum huldigten. Freilich waren dies nur schwache Anfänge, und Jahrhunderte waren erforderlich, bis sich hier die Kirche Christi zu einer festen, bleibenden Anstalt ausbilden konnte. Erst im 7. und 8. Jahrhundert gelang es christlich gewordenen Fürsten und eifrigen Glaubenspredigern, dem Christentum in einem großen Teil deutscher Lande allgemeine Geltung zu verschaffen, und die zur Sicherung und Erhaltung desselben nötigen Einrichtungen zu treffen.
Unter den Missionaren oder jenen unermüdlichen Glaubenspredigern, die das Christentum entweder zuerst bekannt machten, oder es durch ihren Eifer neuerdings belebten und befestigten, verdienen ganz vorzüglich angelsächsische (engländische) Mönche aus St. Benedikts Orden unsere Aufmerksamkeit und Dankbarkeit. Doch unter ihnen und über sie alle ragt hervor – Bonifazius, oder wie er früher hieß, Winfried. Ihm gebührt mit vollstem Recht der Name – Apostel Deutschlands.
Bonifaz war der Sohn hochangesehener, mit Königen verwandter Eltern, geboren um das Jahr 680 zu Crediton oder Kirton im angelsächsischen Königreich Westsex. Schon im zartesten Knabenalter überließ ihn sein Vater, durch sein unausgesetztes Bitten besiegt, der Leitung und Erziehung ausgezeichneter Äbte in den Klöstern Exeter und Nuthescelle. Der junge Mönch machte hier in den Wissenschaften und in der Frömmigkeit bewunderungswürdige Fortschritte, und, zum Priester geweiht, wurde er zu bedeutenderen Ämtern verwendet und mit wichtigen Aufträgen betraut. Allein ein glühendes Verlangen, auswärtigen heidnischen Völkern das Evangelium zu verkünden, trieb ihn an, diese beschwerliche Laufbahn anzutreten. Im Jahr 716 unternahm er in Begleitung zweier Gefährten die Reise, landete in Friesland, und wollte sein Bekehrungs-Geschäft beginnen. Allein Radbod, der Beherrscher des Landes, eben in Krieg mit den Franken verwickelt, gestattete dem Christentum keinen Eingang: er verweigerte den christlichen Lehrern die Erlaubnis zu Predigen und längeren Aufenthalt.
Bonifaz kehrte wieder in die klösterliche Einsamkeit zurück, ohne jedoch sein heiliges Vorhaben aufzugeben. Schon im Jahr 718 verließ er sein Vaterland wieder, und begab sich diesmal zuerst nach Rom. Von Papst Gregor II. gütig und freundlich aufgenommen, begehrte und erhielt er die Vollmacht und den Auftrag, wo immer er könne und wolle, heidnische Völker zu unterweisen und zu taufen. Aus Italien kam er durch Bayern und über die Donau nach Thüringen. Daselbst begann er sein Apostelamt mit allem Eifer, und ließ es sich angelegen sein, die seit einiger Zeit schon Bekehrten im Glauben zu stärken, und der Kirche Christi auch neue Mitglieder zu gewinnen.
Doch bald eröffnete sich seinem Eifer ein neues Feld: Radbod, der Fürst Frieslands, war bald darauf im Jahr 719 gestorben. Sogleich machte sich Bonifaz auf, und durch dreijähriges Zusammenwirken mit Willibrord, der schon früher daselbst gepredigt hatte, und auf einige Zeit vertrieben worden war, brachte er den größeren Teil des Volkes zur Erkenntnis der christlichen Wahrheit.
Nach dieser glücklichen Ernte begab er sich mit einigen Gefährten wieder in die ostfränkischen Provinzen, durchzog in den Jahren 722 und 723 Hessen, einen Teil Sachsens, predigte, taufte, zerstörte Götzenbilder, und pflanzte dafür das Kreuz.
Von diesen glücklichen Fortschritten des Bekehrungs-Geschäftes glaubte er dem allgemeinen Vater der Christenheit einen Rechenschaftsbericht erstatten zu müssen. Der heilige Vater, über den Inhalt dieser Nachrichten hocherfreut, berief Bonifazius nach Rom, um weiteres über diese wichtige Angelegenheit mit ihm zu besprechen und zu verhandeln. Der Papst weihte ihn – am 30. November 723 – zum Bischof, und übertrug ihm die Obsorge und Leitung über alle bereits bekehrte, oder noch zu Bekehrende in sämtlichen deutschen Ländern. Auch empfahl er ihn nachdrücklichst dem Schutz und der Unterstützung der über den größten Teil Deutschlands herrschenden fränkischen Regenten.
Bonifaz, nunmehr mit der bischöflichen Würde bekleidet, setzte seinen Eifer mit Anstrengung seiner geistigen und körperlichen Kräfte unermüdlich fort – für Bekehrung der Heiden in Hessen, Ostfranken Thüringen, und, obgleich in seinem heiligen Unternehmen vielfach beengt und gehindert, ließ er sich doch nicht schrecken, das unter Gottes Segen so glücklich begonnene und fortschreitende Bekehrungs-Geschäft in immer erweiterten Kreisen auszudehnen. Vor allem trachtete er, sich brauchbare Gehilfen zu verschaffen, indem er sie teils aus seinem Vaterland, Angelsachsen, herbeirief, teils nach und nach deutsche junge Männer heranbildete, Klöster und Schulen errichtete, Kirchen erbaute, - und so im wahren Sinn der Begründer sowohl der geistigen Bildung, als auch des zeitlichen Wohlstandes deutscher Völker, ihr größter und eigentlichster Wohltäter wurde.
Solch ungemeine Verdienste anerkennend und würdigend, schickte ihm Papst Gregor III. im Jahr 732 das Pallium (oder erzbischöfliche Ehrenzeichen), und ernannte ihn somit zum Erzbischof mit ausgedehnten Vollmachten zur Einrichtung des Kirchenwesens und vollkommenen Herstellung notwendiger Disziplin. Bonifaz richtete nunmehr ein besonderes Augenmerk auf Bayern, wo die Herzoge und viele Vornehme nebst dem größeren Teil des Volkes bereits die Lehre Jesu angenommen hatten, auch an einigen Orten Bischöfe ihren Sitz hatten, wo aber auch noch so viele Unordnungen, Irrlehren und heidnischer Aberglaube herrschte, dass das Christentum an seiner Ausbreitung oder seinem Fortbestand bedroht war. Das veranlasste den sorgsamen Glaubensprediger, dass er sich um das Jahr 736 persönlich nach Bayern begab, das Land durchreiste, die Missbräuche, so viel möglich, beschränkte oder vertilgte, und bessere Ordnung allenthalben herstellte. Durch wohltätige Beihilfe der Herzoge und Edelleute errichtete er auch einige Klöster als Pflanzschulen brauchbarer Religionsdiener.
Aus Bayern wieder zurückgekehrt, hielt er sich noch einige Zeit in Thüringen auf, - und reiste dann zum dritten Mal nach Rom im Jahr 738, begleitet von vielen jungen Leuten, die sich aus Andacht als Pilger angeschlossen hatten und deren mehrere in Rom die Priesterweihe erhielten. Papst Gregor III. besprach oft lange mit ihm die deutschen Kirchenangelegenheiten, und wohl hauptsächlich die bleibende Errichtung ordentlicher Bistümer in Bayern. Denn als Bonifaz im Jahr 739 Rom wieder verließ, begab er sich unmittelbar nach Bayern zu Herzog Odilo, und nach den erforderlichen Beratungen und Voranstalten errichtete er für das ganze Land vier ordentliche Bistümer: Regensburg, Freising, Salzburg und Passau, setzte die Bischöfe ein, und ordnete die übrigen Angelegenheiten der neuen Kirchen. All diese wichtigen Geschäfte und die damit verbundenen häufigen Reisen verlängerten seinen Aufenthalt in Bayern bis in das Jahr 741.
Erst in diesem Jahr konnte er in den übrigen bekehrten Provinzen mit neuer Sorgfalt seine Bemühungen für Feststellung kirchlicher Einrichtungen fortsetzen und vollenden. Das erste, was er unumgänglich notwendig fand, war, dass auch hier neue Bischofssitze zustande kämen. Die Zahl der Gläubigen war allmählich so angewachsen, dass Bonifaz als einziger Bischof für die vielen seelsorglichen Geschäfte und die zum Teil verwickelten Kirchenangelegenheiten nicht mehr genügen konnte. Er setzte also nach eingeholter Bewilligung des Papstes drei neue Bischöfe ein: zu Büraburg (Fritzlar) für Hessen, zu Erfurt für Thüringen und zu Würzburg für das eigentliche Ostfranken. (Von dem etwas später errichtete Bistum Eichstätt wird weiter unten die Rede sein.)
Die folgenden Jahre setzte Bonifaz seine Bekehrungen fort, und bemühte sich rastlos, in den neuen Bistümern die Kirchenzucht herzustellen, oder einzuführen, nach innen und außen heilsam und kräftig zu wirken hauptsächlich durch Einführung und Haltung öfterer Synoden und Concilien, und durch Errichtung von Schulen in den Klöstern nicht nur des männlichen, sondern auch des weiblichen Geschlechtes.
Im Jahr 784 übernahm er die besondere Leitung des zu einem Erzbistum erhobenen Kirchensprengels Mainz. Aber nur beiläufig 4 Jahre lang behielt er dieses Amt, und übergab es dann einem seiner getreuesten und zuverlässigsten Schüler, - Lullus. Er selbst wollte die noch übrigen Tage seines tatenreichen Lebens dort beschließen, wo er einst seine apostolische Laufbahn angefangen hatte, - in Friesland. Dort, so beschloss es die Vorsehung, sollte ihm zur Würde eines Apostels auch die Krone eines Märtyrers zuteilwerden. Es war am 5. Juni des Jahres 754, als er einer Anzahl Neugetaufter die heilige Firmung erteilen wollte. Da stürzte eine Rotte fanatischer Heiden auf ihn und seine Gefährten los, und ermordeten sie grausam.
Der Leichnam des heiligen Bonifaz wurde nach dem von ihm gestifteten Kloster Fulda gebracht, wo die heiligen Gebeine noch jetzt ein Gegenstand dankbarer Verehrung sind.
Die heiligen Verwandten des heiligen Bonifazius verdienen eben auch unsere besondere Aufmerksamkeit.
St. Bonifaz hatte eine Schwester, Wuna genannt, die an einen vornehmen Angelsachsen, Richard, verehelicht war, dem man insgemein den Königstitel beilegt, sei es nun, dass er wirklich über eines der mehreren angelsächsischen Königreiche herrschte, oder dass er mit Königen nur nahe verwandt war. Unter den Kindern dieser frommen Eheleute sind uns namentlich bekannt Willibald, geboren im Jahr 700, Wunibald, geboren 701, und Walburga, geboren ums Jahr 710. Willibald hatte eine unwiderstehliche Sehnsucht, gleich vielen andern seiner Landsleute eine Wallfahrt nach Rom zu den Gräbern der heiligen Apostel zu unternehmen. Leicht machte er in seinem gleichgesinnten Bruder Wunibald dasselbe Verlangen rege. Aber mehr Mühe kostete es, den Vater Richard zu gleichem Entschluss zu bewegen. Endlich verstand auch dieser sich zur Pilgerreise. Die noch junge, zarte Walburg wurde entweder schon gleich damals, oder doch bald danach der Obsorge der frommen und verständigen Äbtissin des Klosters Winburn übergeben.
So traten nun im Jahr 720 Richard und seine beiden Söhne, mit zahlreichen Begleitern, ihre Pilgerreise an, und kamen glücklich bis Lucca. Aber hier überfiel den Vater eine schwere Krankheit, die ihm das Leben gekostet hat. Gleichwohl setzten die Söhne ihre Reise fort, und erreichten ihr Ziel, - Rom mit seinen Merkwürdigkeiten und Heiligtümern. Auch sie wurden hier von einer Krankheit befallen, wodurch ihr Aufenthalt in der Hauptstadt der Christenheit sehr verlängert wurde.
Willibald genas zuerst, und ungeachtet der bis daher so ungünstigen Ereignisse ließ er sich nicht schrecken, eine weitere Wallfahrt in diejenigen Länder zu unternehmen, wo einst der Gottmensch geboren wurde, die Heilslehre verkündet, und uns allen am Kreuz die Seligkeit erworben hat. Bald nach Ostern, im Jahr 722, verließ Willibald Rom und seinen Bruder Wunibald, und sieben ganze Jahre brachte er auf dieser Wanderschaft zu, währenddessen er alle merkwürdigen Orte des Heiligen Landes, manche auch öfter, mit begeisterter Andacht besuchte. Nach vielen ausgestandenen Mühseligkeiten und Gefahren landete er im Herbst 729 glücklich an den Ufern Italiens, begab sich nach Monte Cassino, erhielt dort die Aufnahme in das Kloster und den Orden St. Benedikts, und verharrte 10 Jahre daselbst – als Beispiel der Ordnungsliebe, Berufstreue und Frömmigkeit für alle Mitbrüder, bis ihn die Vorsehung zu Höherem berief.
Wunibald war indessen, weil noch nicht ganz genesen, in Rom zurückgeblieben, reiste aber nach einiger Zeit wieder nach England, - nicht, um dort bleibenden Aufenthalt zu wählen, sondern vielmehr, um mehrere Bekannte und Verwandte zu einem Pilgerzug nach Rom zu bereden. In ihrer Gesellschaft kam er neuerdings zur christlichen Hauptstadt, und befand sich daselbst, eben als St. Bonifaz im Jahr 738 zum dritten Mal gleichfalls dort eingetroffen war. Da dieser ohnehin beabsichtigte, bei dieser Gelegenheit neue Mitarbeiter für die Missions-Geschäfte in Deutschland zu gewinnen, so musste es ihm höchst willkommen sein, hier einen Neffen zu finden, der für den genannten Zweck tauglich und brauchbar erschien. Er erwirkte von Papst Gregor den Befehl, dass sich Wunibald unverzüglich nach Deutschland begebe. Willig folgte er diesem Auftrag, wurde von St. Bonifaz nach Thüringen abgeordnet, wo er auch die Priesterweihe empfing, und die Leitung mehrerer Kirchen übernahm, später aber in der heutigen Oberpfalz (namentlich an der Vils) für Verbreitung des Christentums tätigst mitwirkte.
Auch St. Willibald, den im Jahr 739 ein zufälliges Geschäft von Monte Cassino nach Rom geführt hatte, erhielt vom Papst die Weisung, nach Deutschland abzugehen, und sich unter der Leitung seines Oheims Bonifaz dem Bekehrungsgeschäft und der Seelsorge zu widmen.
Von St. Walburg wissen wir aus dieser Zeit weiter nichts, als dass sie in klösterlicher Verborgenheit lebte, ohne jedoch den Schleier genommen und die Ordensgelübde abgelegt zu haben.
Schon gleich im folgenden Jahr 740 war Willibald in Bayern eingetroffen, wo sich St. Bonifaz noch immer befand, und eben eine reichliche Schankung an Ländereien von einem gewissen Graf Suitger (Schweicker) im Nordgau in der Gegend um Eichstätt erhalten hatte. Eichstätt selbst war ein zerstörter Ort, wo aber noch eine Kapelle zu Ehren Mariä übrig geblieben war. Suitger, Bonifaz und Willibald begaben sich dahin, und da sie den Platz zur Anlegung einer christlichen Colonie geeignet fanden, wurde derselbe Willibald und seinen Gefährten alsbald eingeräumt, ein Kloster zu bauen angefangen, und die verödete Gegend urbar gemacht. St. Willibald wurde als Vorsteher oder Abt dieser klösterlichen Gemeinde ernannt, und in der Kapelle zu Eichstätt durch Erzbischof Bonifaz zum Priester geweiht am 22. Juli 740. Im folgenden Jahr 741 aber berief ihn Bonifaz zu sich nach der Salzburg (jetzt Schlossruine in Unterfranken, Landgerichts Neustadt a. d. Saale), und erteilte ihm die Weihe und Würde eines Bischofs.
Die Umgegend Eichstätts war von den Bistümern Augsburg, Regensburg und Würzburg umschlossen, aber von jedem dieser Bischofssitze ziemlich fern. Und Bonifaz fühlte wohl die Notwendigkeit, dass für die geistlichen Bedürfnisse der bereits christlich gewordenen Bewohner besser gesorgt werden müsse, so wie für die Bekehrung der noch häufigen Heiden vieles zu tun übrig sei. Darum fand er es sehr zuträglich, wenn er dem Abt des Klosters zugleich das Amt eines Hülfsbischofs übertrüge, bis etwa günstigere und friedlichere Zeitverhältnisse es möglich machen würden, in Eichstätt einen eigenen, förmlichen Bischofssitz zu errichten und eine neue Diözese zu bilden.
Dieser Zeitpunkt trat auch bald ein. Nachdem ein zwischen den Franken und Bayern im Jahr 743 ausgebrochener Krieg beendet, und durch den darauf erfolgten Frieden eine Territorial-Veränderung vor sich gegangen war, wurden von den drei umgebenden Diözesen Augsburg, Regensburg und Würzburg einige Distrikte abgetrümmert, und aus ihnen die neue Diözese Eichstätt gebildet, und St. Willibald als erster, ordentlicher Bischof durch den heiligen Bonifaz daselbst eingesetzt – im Jahr 745.
Von nun an war Willibald besorgt, durch persönlichen Eifer und durch Vermehrung neuer Mitarbeiter nicht nur das Seelenheil der ihm anvertrauten Diözesanen, sondern auch den physischen Wohlstand derselben auf alle mögliche Weise zu fördern. So wie das Christentum immer mehr ausgebreitet wurde durch Unterricht, Taufe, gottesdienstliche Einrichtungen, in eben dem Maße gewannen auch Ackerbau, Handwerke und Künste ihren ersten Anfang oder neuen Aufschwung. Neue Ansiedlungen entstanden, neue Ortschaften wurden aufgebaut, und Eichstätt, erst kürzlich noch eine Ruine, erwuchs in wenigen Jahren zu einem ansehnlichen Ort. Bei allen diesen Bemühungen hatte Willibald an Bonifaz einen treuen Ratgeber und tätigen Mithelfer. Einzelne kleinere Gaben oder beträchtlichere Schenkungen machten es nach und nach möglich, immer mehrere Kirchen aufzubauen, und die nötigen Anstalten für die Förderung religiöser Zwecke zu erweitern. So hatte Willibald eine bedeutende Schenkung an liegenden Gründen auf dem sogenannten Hahnenkamm um Heidenheim erhalten, und zur Vergrößerung dieser ursprünglichen Besitzung kaufte er aus den Almosen der Gläubigen noch manche Länderei hinzu. Weil es dort noch viele Heiden gab, so hatte Willibald den Plan, durch Errichtung eines Klosters die Bekehrung der Umgegend leichter zu bewirken. Nach deshalb gepflogener Beratung mit St. Bonifaz wurde Wunibald bestimmt, das heilsame Werk der Veredlung des Bodens und der Bewohner auf sich zu nehmen. Dieser baute um das Jahr 751 für sich und einige Mitbrüder Mönchszellen und ein Bethaus, und gewann in kurzer Zeit auch diesen Strich Landes für Christus und die katholische Kirche.
Um dieselbe Zeit sammelte auch Walburg, Willibalds und Wunibalds Schwester, die, dem Ruf ihres Oheims Bonifaz folgend, schon um das Jahr 748 nach Deutschland gekommen war, und seitdem als Nonne in einem thüringischen Kloster gelebt hatte, mehrere Gefährtinnen um sich, und übernahm die Leitung des neuen weiblichen Klosters in Heidenheim als Äbtissin – in heiliger Wirksamkeit durch Lehre und Beispiel, besonders für das weibliche Geschlecht.
So fügte es die anbetungswürdige Vorsehung, dass diese drei heiligen Geschwister, nach langer Trennung und vieljährigem Aufenthalt in den entferntesten Ländern, endlich wieder, obgleich außer ihrem Vaterland, vereinigt werden sollten, - zum Streben und Wirken für ein gemeinschaftliches, für das erhabenste Ziel. Mit vollem Recht und aus schuldigster Dankbarkeit verehrt sie die Diözese Eichstätt als ihre größten Wohltäter und als ihre besonderen Fürbitter bei Gott.
Ihr Hingang aus dem irdischen Leben zur ewigen Herrlichkeit wird in folgenden Zeitbestimmungen angegeben:
St. Wunibald entschlief am 18. Dezember im Jahr 761, im 61. Jahr seines Alters. Er wurde in der von ihm erbauten Kapelle zu Heidenheim begraben, und nachmals im Jahr 1483 wurde in der neuen, größeren Kirche ihm jenes Grabmal errichtet, das noch jetzt dort zu sehen ist. Ob sich unter demselben noch Überreste seiner heiligen Gebeine befinden, ist sehr zu bezweifeln.
Ihm folgte in die selige Ewigkeit seine Schwester Walburga am 25. Februar (höchst wahrscheinlich) im Jahr 779. Ein Monument, das sich noch in der Kirche zu Heidenheim befindet, wurde im Jahr 1484 errichtet.
Die Gebeine der Heiligen sind jedoch nicht darunter aufbewahrt, sondern ein Teil befindet sich – seit etwa 870 – in dem nach ihr benannten Frauenkloster zu Eichstätt, wo aus ihnen eine wundervolle Flüssigkeit, St. Walburgis-Öl genannt, hervorquillt. Der andere, weit beträchtlichere Teil dieser Reliquien musste dem neu errichteten Frauenkloster in Monheim im Jahr 893 überlassen werden, wo sie bis zur daselbst im Jahr 1542 erfolgten Kirchentrennung verehrt wurden, aber seitdem verschwunden sind.
St. Willibald, der seine beiden Geschwister begraben hatte, folgte ihnen am 7. Juli 781, im 81. Jahr seines Alters, nachdem er die Würde eines ordentlichen (des ersten) Diözesan-Bischofs von Eichstätt 36 Jahre lang bekleidet hatte. Er wurde anfangs in der von ihm erbauten Domkirche begraben, seine heiligen Gebeine mehrmals erhoben und versetzt, zuletzt aber, seit 1269, in einer eigenen, an den westlichen Teil der Domkirche angebauten und mit ihr in Verbindung stehenden Kapelle (St. Willibalds-Chor) untergebracht, wo sie noch jetzt zur Verehrung der Gläubigen aufbewahrt sind.
II. Feier des Jubiläums 1845
Die bisher erzählten Ereignisse und die Entstehungsgeschichte des Bistums Eichstätt verdienen allerdings die dankbare Erinnerung der Nachkommen. Denn dadurch wurde ja der Grund gelegt zu allen jenen Wohltaten Gottes, wodurch eine öde oder verwilderte Gegend angebaut und eine große Volksmenge den Finsternissen des Heidentums entrissen und mit dem göttlichen Licht des Evangeliums erleuchtet wurde. Gottes erbarmender Güte und dem mühevollen Eifer der Glaubensprediger sind alle jene zeitlichen und geistlichen Segnungen zu verdanken, welche von den Ahnen auf die Enkel seit elfhundert Jahren vererbt worden sind.
Deshalb feiert die katholische Kirche im Verlauf jeden Jahres nicht nur eine Reihe Feste zur Erinnerung an die wichtigsten Geheimnisse der heiligen Religion, sondern widmet auch besondere Tage dem Andenken jener Heiligen, die zur Verbreitung und Förderung des Christentums besonders tätig beigewirkt haben.
Selbst auch nach Verlauf bestimmter längerer Zeiträume (nach je hundert Jahren gewöhnlich) werden Feste angeordnet, wodurch ein vorzügliches, kirchliches Ereignis den Gläubigen in das Gedächtnis gerufen wird – durch äußerliche Feierlichkeiten, und noch mehr durch Aufmunterung zur Andacht, Buße und Besserung, Empfang der heiligen Sakramente und durch Erteilung besonderer Ablässe. Dass die Kirche von der Ansicht ausgeht, auch durch äußerliche, würdevolle Eindrücke auf das Innere ihrer Angehörigen zu wirken, und dadurch höhere, heilige Zwecke zu erreichen strebt, ist seit ihrer Dauer mit segenreichstem Erfolg immer beobachtet worden, und liegt in ihrer wesentlichen Einrichtung.
Von diesen Ansichten geleitet und dem Beispiel voriger Jahrhunderte folgend, hat dann der dermalige Hochwürdigste Oberhirt Eichstätts Carl August für das Jahr 1845, - als das elfhundertste, seit St. Willibald zum ersten Bischof des neu errichteten Kirchensprengels eingesetzt worden ist, - die geeigneten Feierlichkeiten in Form eines kirchlichen Jubiläums anzuordnen beschlossen.
Der Umfang und die Großartigkeit des zu veranstaltenden Festes erheischte es, dass rechtzeitig diejenigen Vorbereitungen getroffen wurden, wodurch jeder Störung, Verwirrung und Verlegenheit vorgebeugt wäre.
Der Anfang und die Dauer der Jubiläumsfeier wurde festgesetzt – für die Stadt Eichstätt vom 6. bis 14. September, für die übrigen Pfarreien der Diözese vom 20. bis 28. September.
Der Heilige Vater wurde von dem Vorhaben dieser Feierlichkeit in Kenntnis gesetzt, und nicht nur um die Genehmigung derselben, sondern auch um Verleihung eines vollkommenen Ablasses und um besondere Vollmachten der Beichtväter für diese Gnadenzeit geziemend gebeten.
Eben so wurden auch die Königlichen Stellen und Polizei-Behörden um Bewilligung und allenfallsige Beihilfe ersucht.
Nach erhaltener beiderseitiger Gewährung und Zustimmung erfolgte unterm 7. Juli die oberhirtliche Einladung an sämtliche Bistums-Angehörige, und Tags darauf noch eine besondere Instruktion für den Curat-Clerus. Damit letzterer für diese wichtige Feierlichkeit sich selbst würdig vorbereite und desto heilsamer auf die ihm anvertrauten Pfarrgemeinden wirken möge, verschaffte der Hochwürdigste Oberhirt jenen Geistlichen, die sich freiwillig dazu einfinden wollten, eine bequeme Gelegenheit durch Anordnung sogenannter geistlicher Übungen. In 2 Abteilungen versammelten sich die Priester zur heiligen Einsamkeit und Betrachtung auf dem Königlichen Schloss Hirschberg bei Beilngries: - vom 3. bis 9. August nahmen 70, vom 17. bis 23. August 68 Priester Anteil.
In der Zwischenzeit erging auch an die Hochwürdigsten Erzbischöfe und Bischöfe Bayerns und einige benachbarte, - so wie auch an die Hochwürdigen Herren Äbte von Metten und Scheyern die geziemende Einladung, dass sie dieses Fest durch ihre Anwesenheit und Teilnahme mit verherrlichen möchten.
Weil leicht vorauszusehen war, dass eine ganz ungewöhnliche Menge Volkes herbeiströmen würde, so wurde noch besonders dafür gesorgt, dass während der 8tägigen Feier in Eichstätt nicht Mangel an Beichtvätern und Ausspendern der heiligen Kommunion einträte. Deshalb wurden alle nur einigermaßen entbehrliche Curatpriester vom Land einberufen, um die nötige Aushilfe zu leisten. Dadurch waren – bei wirklichem Eintritt des Festes – immer eine Anzahl von 85 bis 90 Priestern für die Bedürfnisse der Andächtigen bereit, - acht Redemptoristen mitgerechnet, die mit ihren Pater Rektor von Altötting hierher berufen erschienen, und nicht nur mit unermüdlichem Eifer im Beichtstuhl heilsam wirkten, sondern auch von der Kanzel täglich dreimal zur Buße und Besserung mahnten.
Über die Zeit, Form, Anzahl der Gottesdienste in der Domkirche wurden vorläufige Dispositionen getroffen, so wie auch die Zeit und Ordnung festgesetzt, an welchen Tagen die Prozessionen vom Lande eintreffen dürften.
Für den äußeren Glanz der Festlichkeit und für Handhabung der Ordnung und Sicherheit wurden die vorsorglichen Anstalten mit aller Umsicht und regester Tätigkeit getroffen.
Die Domkirche, als der Zentralpunkt der ganzen Feierlichkeit, als der Aufbewahrungsort der heiligen Überbleibsel ihres ersten Bischofs, wurde, so viel es die beschränkten Mittel nur immer gestatteten, zur würdigen Feier des Festes zubereitet. Außer der Reinigung und frischen Übertünchung wurden sämtliche Altäre mit neuen Verzierungen versehen, der Chor oder Vorderteil mit geschmackvollen Häng- und Fußteppichen geschmückt, der Hochaltar daselbst erneuert und verschönert, und in Mitte der Kirche der bisherige Altar abgebrochen, und durch einen ganz neuen, ebenso prächtigen, als kunstreichen ersetzt, um auf ihm die Reliquien St. Willibalds während der Oktav auszusetzen.
Auch in der Pfarr- und Klosterkirche zu St. Walburg und in den übrigen Kirchen Eichstätts wurden Zurüstungen für das kommende Fest getroffen.
In jedem Haus der Stadt wurde mit emsiger Sorgfalt gearbeitet, um beim wirklichen Eintritt der festlichen Tage alle Straßen und Gebäude mit Blumengehängen, Kränzen, Bäumen, Bildern, Tapeten, Inschriften etc. zu verzieren. Die Fahnen und Standarten der Bruderschaften und Handwerks-Innungen wurden teils besonders schön verziert, teils ganz neu angeschafft.
Die Ortsobrigkeit und städtische Kommune bot alles auf, und scheute beträchtliche Kosten nicht, an den Stadttoren und öffentlichen Plätzen Triumphbogen, mit Inschriften versehen, aufzurichten, und allenthalben ihren religiösen Sinn und die freudige Dankbarkeit gegen den wohltätigen Begründer der Stadt und den eifrigen Apostel der Diözese zu bezeugen. – Bei dem großen Andrang des Volkes, der von allen Seiten her zu erwarten stand, trafen sie auch die zweckmäßigsten Vorkehrungen für Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung, für Unterkunft und Wohnung so vieler Übernachtender, für hinreichenden Vorrat an guten Lebensmitteln, für Sicherung der Personen und des Eigentums gegen jede etwaige Gefahr. Das Landwehr-Bataillon übernahm freiwillig und uneigennützig das Amt, alle diese Maßregeln durch seine Dienste zu unterstützen.
Unter solchen vielseitigen Vorkehrungen und Anstalten waren auch mehrere der geladenen Gäste (Die Hochwürdigsten Herren Erzbischof von München, Bischöfe von Straßburg, Speier, Würzburg und Regensburg, und die beiden Hochwürdigen Herren Äbte von Metten und Scheyern waren teils die ganze Oktav, teils einige Tage hindurch anwesend.) eingetroffen, und der längst ersehnte Tag zur Eröffnung des Festes herangekommen.
Am Samstag, den 6. September, fing man schon mit anbrechendem Tag an, und fuhr den ganzen Vormittag fort, Straßen und Häuser zu schmücken.
Um 2 Uhr nachmittags verkündete das Geläute aller Glocken, 25 Kanonenschüsse und das Aushängen einer großen Fahne aus dem einen Turm der Domkirche – den Anfang der Jubelwoche. Darauf begaben sich in feierlichem Zug der Herr Bischof von Eichstätt und seine Hochw. bischöflichen Gäste, vom Domkapitel und dem Klerus begleitet, zur Domkirche, wo um 3 Uhr die solenne Vesper abgesungen wurde. – Die sämtlichen Beichtväter nahmen in den ihnen angewiesenen Kirchen die Beichtstühle ein, und begannen ihr beschwerliches, heilsames Amt.
Um 4 Uhr 30 hielt in der Schutzengel-Kirche der P. Rektor der Redemptoristen die erste (oder Vorbereitungs-) Predigt.
Um 7 Uhr war in der Domkirche Abendandacht mit Betrachtung und Gebet. – An diesem Tag traf die erste Prozession einer Landgemeinde ein, und die Teilnehmer wurden für die Nacht einquartiert.
Der Zulauf des Volkes war an diesem Vorabend schon so groß, dass wohl 5000 Fremde hierherkamen, und zum Teil übernachteten.
Sonntag, den 7. September, am frühesten Morgen waren bereits alle Kirchen, Häuser und Straßen in voller Regsamkeit, und neue Scharen strömten von allen Seiten herbei, so dass gegen 10.000 Fremde – einzeln oder in Prozessionen – zusammentrafen, wovon jedoch abends ein Teil wieder heimkehrte.
Morgens um 7 Uhr versammelte sich die Geistlichkeit im Chor der Domkirche, zog von da in den Willibalds-Chor, wo die Gebeine des heiligen Willibald, - seine Hirnschale, - ein Arm der heiligen Walburg, - und einige Reliquien des heiligen Deochar, reichlich verziert und zum Tragen hergerichtet, sich befanden. Nachdem daselbst einige Hymnen und Gebete verrichtet waren, setzte sich die Prozession durch die Hauptstraßen der Stadt in Bewegung.
Die ganze Ordnung und jede Einzelheit dieses Feierzuges zu beschreiben, liegt außer der Absicht dieses Aufsatzes, und es genüge zu bemerken, dass sich die verschiedenen Corporationen auf diese Weise folgten:
Die Schuljugend beiderlei Geschlechtes, - die bürgerlichen Zünfte mit Stäben, Standarten und Fahnen, - die Bruderschaften mit ihren Insignien, - Trompeten und Pauker, - die Kapuzinerpatres, - das bischöfliche Seminar, - zwei Priester mit St. Deochars Reliquien, - Land- und Stadtklerus, - Sängerchor, - Domvikare, - ein Priester mit der Hirnschale St. Willibalds, ein anderer mit dem Arm der heiligen Walburg, - das Domkapitel, - der Hochwürdigste Bischof Officiator, - Rauchfassträger, - die Reliquien des heiligen Willibald, von 4 Priestern auf einer Bahre getragen, - die Hochwürdigsten Herren Bischöfe, - die Königlichen Zivil- und Militärbehörden, - die Herzoglich Leuchtenbergischen Behörden, - der Stadtmagistrat und die Gemeinde-Bevollmächtigten, - das Volk männlichen und weiblichen Geschlechtes in unzählbarer Menge.
In der Kirche zu St. Walburg wurde einige Zeit Halt gemacht, und zu Ehre dieser Heiligen Hymnen gesungen und kurzes Gebet verrichtet.
Erst nach 2 ½ Stunden kam der Zug zur Domkirche zurück, woselbst die Reliquien St. Willibalds auf dem neuen (oben erwähnten) Altar, - die übrigen aber im Willibald-Chor abgesetzt wurden und die ganze Oktav hindurch blieben.
Hierauf hielt der Hochwürdigste Bischof von Eichstätt die erste Festpredigt und der Hochwürdigste Herr Erzbischof von München das Hochamt. Nachmittags um 3 Uhr war Vesper, um 7 Uhr Betstunde.
Die übrigen Tage dieser Jubel-Oktav, nämlich vom Montag, 8. September, bis Samstag, 13. September, wurden in der Domkirche auf ein und dieselbe Art begangen. Täglich fand der feierliche Einzug der Bischöfe und Äbte statt, einer von ihnen hielt die Predigt, ein anderer das Hochamt, ein dritter die Vesper. Abends um 7 Uhr war Betstunde.
In allen übrigen Kirchen wurde vom frühen Morgen bis in die späte Nacht zur Beicht gesessen, und viele empfingen – obgleich weiten Weges hergekommen und noch nüchtern, - die heilige Kommunion erst in den Nachmittagsstunden.
In der Schutzengelkirche hielten (nebst Ausspendung der heiligen Sakramente) die Patres der Redemptoristen eifrige und eindringliche Kanzelvorträge täglich dreimal, um 5 Uhr 30 morgens, und um 2 und 4 Uhr 30 nachmittags, bei so zahlreichen Zuhörern, dass die sehr geräumige Kirche sie nicht fassen konnte, und viele vor der Kirchentür, die Worte des Heils zu vernehmen, sich abmühten.
An jedem Tag trafen auch die (nach vorläufiger Anordnung) verteilten Prozessionen vom Land ein. Sie zogen mit Gesang und Gebet, mehrere auch mit besonderem Pomp ein, und mit Zurücklassung von Votivgeschenken wieder ab. Dergleichen Züge frommer Wallfahrer fanden 67 während der Jubelwoche statt.
Am letzten Tag, - Sonntag, 14. September, - wurde alles, wie bisher gehalten. Nach der Vesper aber wurde eine Prozession mit den heiligen Reliquien in ähnlicher Weise, wie die am 7. September, veranstaltet. Bei der Rückkehr in die Domkirche wurde das Te Deum angestimmt, und die Gebeine des heiligen Willibald wieder in ihren gewöhnlichen Aufbewahrungsort zurückgebracht und verwahrt.
Und somit war die achttägige Feierlichkeit in der Stadt Eichstätt beendigt. – Die zweite Woche danach begann die Feierlichkeit in den Landpfarreien – 20. bis 28. September.
________________________________________________________________________

106. Anaya – Ein Lourdes des Orients
(Aus „Digeste Catholique“, Löwen/Belgien, Nov 1950, von Robert Brassy „Das Wunder von Anaya“)
Das Folgende beruht auf einem Artikel einer arabischen Zeitschrift in Beirut, die bekannt ist für ihre genauen Informationen. Die Kirche hat sich zwar noch nicht zu diesen Außerordentlichen Geschehnissen geäußert (Stand März 1951), sie werden aber in Rom genauestens beobachtet. Ein Wunder wurde auch bereits im Vatikan im Zusammenhang mit dem Vorhaben, den Seligsprechungsprozess von Pater Charbel einzuleiten, registriert (Charbel Makhlūf wurde 1965 von Papst Paul VI. selig- und am 9. Oktober 1977 vom selben Papst heiliggesprochen)
Seit einigen Monaten häufen sich im Libanon in geradezu erstaunlichem Maß Fälle nicht erklärbarer Heilungen und erregen in christlichen und mohammedanischen Kreisen des Vorderen Orients Aufsehen und religiösen Eifer.
Unzählige Scharen strömen zum Grab eines einfachen maronitischen Mönches, der im Jahr 1898 starb, des Paters Charbel. Dort ereigneten sich Wunder, die aus dem kleinen Dorf Anaya bereits ein Lourdes des Orients machen. Wie in Lourdes können dort Gelähmte wieder gehen, Blinde sehen und Taube hören. Christen, Mohammedaner und Juden kommen jeden Tag zu Tausenden und suchen dort Heilung des Leibes oder Frieden der Seele durch die Vermittlung eines Mannes, den Rom zwar noch nicht heiliggesprochen hat, aber den der Glaube der Pilger und Zeugen des außerordentlichen Geschehens bereits als solchen betrachtet.
Heilig aber war dieser Mönch während seines irdischen Wandels. Im Jahr 1833 erblickte Charbel Makhlūf im Dorf Beka Kafra, etwa 100 Kilometer von Beirut entfernt, in der Nähe der legendenhaften Zedern das Licht der Welt. Seine Eltern waren einfache Bauern, sehr fromm, wie es die meisten Bergbewohner des Libanons noch in unseren Tagen sind, und pflanzten dem Kind von Jugend an die Gottesliebe ins Herz. Mit 18 Jahren trat Makhlūf in das Kloster St. Maron, das zum Dorf Anaya gehört, als Novize ein. Von diesem Zeitpunkt an war er der Welt abgestorben und hob seine Augen nur noch zum Himmel, nach dem er eine heiße Sehnsucht hatte. Durch seinen Gehorsam und seine Demut wurde er ein Beispiel für alle seine Mitbrüder. Nie kam die geringste Klage über seine Lippen, nie zeigte er den Anfall einer Laune. Wenn er nicht durch die schweren Arbeiten auf dem Feld abgehalten wurde – die Mönche sind dort arm und verdingen sich an die Bauern der Umgebung –, war sein Lieblingsaufenthalt Tag und Nacht in der Kapelle des Klosters, wo er kniend betete und Betrachtungen hielt.
Ganz zufrieden aber war Pater Charbel erst, als sein Wunsch in Erfüllung ging, als Einsiedler in der Zelle eines ehemaligen Gefängnisses leben zu dürfen. Schnell verbreitete sich sein Ruf als heiliger Einsiedler im ganzen Gebiet. Die Bauern kamen, um seinen Segen und Heilung von ihren Krankheiten zu erbitten. Aber nur auf ausdrückliche Weisung seines Obern empfing er sie.
Am 16. Dezember 1898 überfiel ihn im Augenblick der Wandlung, als er den Kelch in der Hand hatte, ein furchtbarer Schmerz am Herzen. In der Nacht des 24. Dezembers starb der fromme Einsiedler, als ob Gott gewollt hätte, dass er am Tage von Christi Geburt für den Himmel geboren würde.
Glaubwürdige Zeugen bestätigen, dass sich schon zu seinen Lebzeiten Wunder ereigneten. Als eines Abends seine Öllampe leer war, trug sie Pater Charbel in die Küche, um sie füllen zu lassen. Ein Hausdiener wollte sich einen Scherz erlauben und füllte sie mit bloßem Wasser. Die Lampe brannte jedoch die ganze Nacht. Als der Obere von diesem Vorfall erfuhr, stellte er fest, dass die Lampe tatsächlich Wasser enthielt. Ein Einwohner des Dorfes Ihmege wurde von Raserei befallen und verbreitete unter den Seinen und den Nachbarn Furcht und Schrecken. Pater Charbel begab sich zu dem Unglücklichen, legte ihm die Hand auf das Haupt und betete über ihn. Da wurde der Kranke alsbald gesund und blieb es. Eines Tages stürzte sich eine Heuschreckenwolke über den Libanon und hinterließ auf ihrem Zug nichts als Verwüstung. Als die Gegend von Anaya ebenfalls bedroht wurde, besprengte Pater Charbel die bereits bestellten Felder der Gemeinde mit Weihwasser, und sie blieben verschont.
Noch am Abend der Beerdigung des Paters ereignete sich das erste Wunder nach seinem Tod: Bauern, die erst in der Nacht non den Feldern heimkehrten, nahmen einen leuchtenden Heiligenschein wahr, der sich über den Grabhügel herabsenkte. Von da an ereignen sich nun schon 24 Jahre lang die außerordentlichsten Wunder (Stand März 1951). Daraufhin ließ der Obere des Klosters mit Erlaubnis des Patriarchen die Leiche Pater Charbels exhumieren. Zum Erstaunen aller Zeugen fand man sie nach so vielen Jahren vollständig erhalten. Frisches Blut, vermischt mit Wasser, entquoll der linken Seite. Der erste Bericht des anwesenden Arztes Dr. Elias Onaissi lautet:
„Ich habe im Kloster St. Maron in Anaya die Leiche des Dieners Gottes Pater Charbel gesehen. Als ich mich dem Sarg näherte, nahm ich einen Geruch war, wie ihn Lebende verbreiten. Ich nahm wahr, dass seine Poren einen Stoff ausschieden, der dem Schweiß entsprach. Das ist für einen so lange Jahre leblosen Körper merkwürdig und nach den Naturgesetzen nicht zu erklären. Ich habe danach noch mehrmals Gelegenheit gehabt, zu verschiedenen Zeiten die gleiche Untersuchung durchzuführen und habe dabei immer die nämlichen Erscheinungen festgestellt.
16. November 1921, gez. Dr. Elias El-Onaissi.“
Die arabische Zeitung „Al Bairak“ berichtet in ihrer Ausgabe vom 17.6.1950 ein besonders aufsehenerregendes Wunder. Ein zweijähriges Kind wurde von seiner Mutter in einem Wasserbehälter ertrunken aufgefunden. Es atmete nicht mehr, sein verzerrtes Gesicht ließ auf Erstickung schließen. Man trug es sofort zum Grab des Pater Charbel, und alsbald begann es zu atmen und zu leben.
Gewiss wenden sogenannte „aufgeklärte Geister“ ein, dass man diese Wunder mit Suggestion erklären könnte. Es soll nicht verkannt werden, dass die Einstellung und der Glaube des Kranken viel bewirken kann. Aber die christlichen und nichtchristlichen Zeugen der Wunder von Anaya antworten darauf mit Recht, dass bei einem ertrunkenen Kind und bei wiedererlangtem Augenlicht von Suggestion keine Rede mehr sein könne.
Es ist unmöglich, hier alle Fälle nachgewiesener Heilungen aufzuzählen. In Anaya selbst wie an den verschiedensten Orten der Welt haben kranke Christen, Juden oder Mohammedaner durch bloßes Gebet, durch Wasser aus Anaya oder ein einfaches Bildchen des Heiligen, das man auf die Kranke Stelle legte (wie erst kürzlich eine gelähmte Brasilianerin tat) ihre Gesundheit wiedererlangt.
________________________________________________________________________

107. Abtei Unserer Lieben Frau vom Wagnis
Ein wiedererstandenes Kloster lehrt die alte Lehre: LIEBE
(Von Anne Marrow Lindbergh, Time Inc., Rockefeller Center, New York City. 10. Juli 1950)
„Wie schön!“ sagte ich, als ich zu der steinernen Madonna aufblickte, die in ihrer geschützten Nische über dem niedrigen Torbogen am Klostereingang stand. Sie war aus dunkelrotem Stein gehauen. Die Augen waren in Betrachtung gesenkt, die in den herausgemeißelten Ärmeln verborgenen Arme über der Brust gekreuzt. Die Statue war offenbar eine moderne Arbeit, und doch glich sie in ihrer Einfachheit mehr jenen vom Wind und Wetter der Jahrhunderte mitgenommenen Figuren, die man über den Türen der alten bretonischen Kirchen findet.
Ich stand vor einem Flügel der wiederhergestellten Abtei Boquen in der Bretagne, die aus dem 12. Jahrhundert stammt. Das lange niedrige Gebäude aus bretonischem Granit sah wie eine Fischerhütte aus, die man in die Länge gezogen hat, damit sie einer größeren Zahl von Personen zur Unterkunft dienen könne. Die kahlen Mauern waren von romanischen Rundbögen unterbrochen. Sonst bildete diese Nische für die Madonna mit einem Kletterrosenstock auf jeder Seite die einzige Abwechslung.
Dom Alexis, der Gründer und Vorstand der Abtei, der selber einem Bretonen glich in seinen alten Schuhen und der rauen dunkelblauen Drillichkapuze, stand neben mir. Sein bärtiges Gesicht war voll Güte und froh wie das eines Kindes. Unter einem Büschel angegrauter Haare blitzten dunkle Augen.
„Diese Statue wurde von einem unserer Brüder geschaffen“, sagte er. „Es ist“, und dabei lächelte er still vor sich hin, „Unsere Liebe Frau vom Wagnis.“
„Sie wollen damit sagen, dass man sein Leben wagen muss – wagen, um es zu gewinnen?“
„Ja“, sagte der Mönch.
Ich wusste um das Wagnis, das er auf sich genommen hatte, als er allein und mittellos darangegangen war, eine Abtei wiederaufzubauen, die schließlich aber trotz ihrer verborgenen Lage auf dem Land in der Bretagne von überallher Leute anzog.
Im 12. Jahrhundert war eine kleine Gruppe von Zisterziensermönchen aus ihrer alten und blühenden Abtei Bégard hierhergekommen, um ein neues Kloster, inmitten der Wildnis zu gründen. Sie gehörten zu der großen Bewegung der mönchischen Reform- und Blütezeit des 11. und 12. Jahrhunderts, in welcher der heilige Bernhard eine so überragende Rolle gespielt hatte.
Bis zum 15. Jahrhundert zählte die Abtei über 100 Mönche. Zur Zeit der französischen Revolution waren es noch zwei oder drei, und schließlich waren auch diese verschwunden. Was blieb, waren ein paar verlassene Gebäude und die offenen Mauern der Kirche, Ruinen, die bald zum Steinbruch für die Nachbarschaft wurden. Boquen kehrte zur Wildnis zurück, die es einst gewesen war.
Die Geschichte wiederholte sich. Im Jahr 1936 kam ein einzelner Mönch in diese Wildnis. Die Stelle, so erzählte er mir, war gerade das, was er wünschte, denn er fand nur noch die verfallene Kirche. So konnte er neu beginnen.
Einige Monate lang war Dom Alexis ganz allein. Er schlief in dem verlassenen Gebäude auf ein paar morschen Brettern, während der Regen durch das Dach hereindrang. Zuweilen hatte er so wenig zu essen, dass er mit den sauren Früchten eines wilden Apfelbaumes vorliebnehmen musste. „Ich versuchte, sie zu essen“, sagte er und lachte dabei gutmütig über sich selbst, „aber sie waren so sauer, dass ich sie wieder ausspucken musste.“ Er riss den wilden Wein herunter, der die alten Mauern zerstörte, und legte die Steinplatten des Fußbodens des ursprünglichen Klosters wieder frei. Sorgfältig stellte er die Bruchstücke der behauenen Säulen und Fensterbögen beiseite, um sie später wieder zusammenzufügen. So arbeitete er wie ein bretonischer Bauer. Die Leute in der Nachbarschaft betrachteten ihn zuerst mit dem üblichen Argwohn, den sie gegenüber jedem Fremden hegen. Die Bretonen sind schweigsame Leute, die zurückgezogen leben. Mit ihren scharfen Bauernaugen merkten sie aber bald, dass dieser Fremde genauso hart arbeitete und noch ärmer war als sie selbst. Aber er sah gar nicht aus wie ein Fremder. Stammte er vielleicht aus ihrer Gegend? Er kannte ihre Nöte und klagte wie sie über den trockenen Sommer oder die schlechte Ernte.
Als ich Dom Alexis eines Morgens von seinem harten Bretterlager erhob, fand er einen Sack Kartoffeln vor seiner Tür, ein stummer Beweis dafür, dass die Leute ihn angenommen hatten. Er dankte Gott und nahm die Gabe an. Nach und nach fanden sich noch weitere Gaben, um die er nie gebeten hatte. Und eines Morgens – ein Monat war vergangen – fand Dom Alexis vor seiner Tür seinen ersten Gefolgsmann. Die Wiedergeburt Boquens hatte begonnen.
Langsam erstand nun das Kloster wieder. Erst waren es zwei, drei und vier, doch heute (1950) sind es bereits zehn Mönche, die nach der Regel des heiligen Benedikt leben. Da man noch nicht einmal ein Dach über dem Kopf hatte, war es nicht nur Pflicht, sondern eine absolute Notwendigkeit, dass die Mönche an die Arbeit gingen. So fingen sie an, wieder eine Kapelle zu bauen, um darin zu beten, und ein Haus mit Dach, um darin zu schlafen. Der Garten musste von Dornen und Unkraut gereinigt und wieder bebaut werden, damit er zum Unterhalt beitragen konnte.
Als die Bauern sahen, wie die Gebäude emporwuchsen, vermehrten sie ihre Gaben. Die Mönche kauften auch Land und eine Kuh und zogen noch sechs Stück Jungvieh auf. Der Bischof von St. Brieue nahm das neue Kloster unter seine Hut. Eine Kapelle, eine Werkstatt, Schlafsäle, ein Speisesaal und eine Küche erstanden. Zwei Seiten des Mauerviereckes, das den Klosterhof abschließen sollte, waren fertig. Die alte große Kirche, deren Umrisse die Mönche freilegten, ist heute offiziell als Nationaldenkmal anerkannt, das einer Wiederherstellung durch den Staat würdig ist.
Noch lebt auch der alte Geist. Die Bauern kommen, wie es ihre Vorfahren taten, und suchen die Hilfe der geschickten Mönche. Während des Krieges diente Boquen als Asyl. Hunderte von Flüchtlingen fanden Schutz in seinen Mauern, und in den Ruinen der alten Abtei ruht ein französischer Flieger neben einem alten Fürsten aus der Bretagne.
Heute kommen auch schon viele Laien nach Boquen, um dort Exerzitien zu machen und für kurze Zeit das Leben der Mönche zu teilen und mit Dom Alexis zu plaudern. Man kann nicht mit ihm sprechen, ohne an die Worte von Ernest Hello über die betrachtenden Mönche zu denken: „Reden ist für sie eine Reise zu den Wohnungen der anderen Menschen, die sie nur aus Barmherzigkeit unternehmen. Das Schweigen aber ist ihre Heimat.“ So spricht auch Dom Alexis nur, weil er mithelfen will, den Geist des Christentums in der Welt zu verbreiten.
Ich fragte ihn, ob auch junge Leute zu ihm kämen.
„Viele“, sagte er. „300 Pfadfinder waren diesen Sommer hier und zelteten auf unserem Boden. Sie halfen uns auch bei unserer Arbeit.“
„Ist es wirklich nur das Religiöse, das sie anzieht?“ fragte ich ziemlich skeptisch.
„Nein“, sagte er mit absoluter Aufrichtigkeit, „wenigstens nicht in erster Linie. Die soziale Seite ist es, die sie vor allem interessiert. Sie sind begierig, etwas über das Gemeinschaftsleben zu erfahren.“
Man kann heute tatsächlich überall ein neuerwachtes starkes Gemeinschaftsgefühl feststellen, das in der gemeinsamen Notzeit des Krieges entstanden ist. Ein französischer Kriegsgefangener erklärte dies näher. „Sehen Sie, über Nacht hatten wir unsere ganze Habe verloren, alles was uns mit unserem früheren Leben verband. Aber aus dieser äußersten Armut erwuchs ein wunderbares Gefühl der Brüderlichkeit. War einer krank, so verrichteten die anderen seine Arbeiten mit. Erhielt einer ein Lebensmittelpaket, so teilte er es mit den anderen. Es war ein neues Gefühl – das Gefühl des gemeinsamen Menschentums.“
Dom Alexis ist sich zutiefst bewusst, dass die Gottesliebe und die Menschenliebe nicht voneinander getrennt werden können. „Schaut auf die zwei Hauptgebote“, sagte er, „das erste lautet, den Herrn zu lieben aus unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit allen unseren Kräften. Das zweite aber gebietet uns, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Man kann beide nicht trennen, man kann das eine nicht ohne das andere erfüllen. Man kann Gott nicht aufrichtig lieben, wenn man nicht seinen Nächsten liebt und sich bemüht, ihm zu dienen.“
Die Trennung der Arbeit von Betrachtung und Gebet ist nach seiner Meinung eine der größten Krankheiten unserer Zeit. Das Kloster ist ihm das Symbol des Ausgleichs zwischen Arbeit und Gebet. „Viele“, so drückt er es aus, „sehen hier vor allem ein Beispiel dafür, wie der Glaube gelebt wird, wie er in Taten und nicht nur in Worten ausgedrückt wird.“
Spricht man mit ihm über den Atomkrieg, über neue Invasionen, die drohende Zerstörung Europas, so gibt Dom Alexis zwar zu, dass solche Katastrophen möglich sind, aber er glaubt nicht, dass sie das Ende unserer Kultur oder den Untergang des Christentums bedeuten würden. Es mag sein, dass ein neues finsteres Zeitalter anbrechen wird, aber die Kultur und das Christentum werden es überleben. Auch die Klöster, selbst wenn man sie zerstörte, würden wiedererstehen, wie dies auch jetzt in Boquen der Fall sei.
Dom Alexis unterbrach hier seine Worte und sah auf die Klostermauern vor uns: das unvollendete Dach, das offene Kirchenschiff und die Mönche, die in Arbeitskleidern hin und her gingen und Schubkarren voller Steine fuhren. „Man muss immer arbeiten“, fügte er dann hinzu.
Da blickte auch ich auf zu den schlichten Mauern, den schönen Steinen, die, vom Regen gewaschen, in der Sonne glänzten, so dass sie mir die Farben der Bretagne wiederzugeben schienen: das Grau der Granitfelsen, das Rotbraun der Fischersegel und das Schieferblau der stürmischen See. Dann aber ruhte mein Blick auf der Statue Unserer Lieben Frau vom Wagnis. Sie hat den richtigen Platz, dachte ich, und den richtigen Namen.
infobretagne.com/abbaye_de_boquen
________________________________________________________________________

108. Pompeji als Wallfahrtsort
Es gibt auch ein christliches Pompeji!
In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts begann sich die Verehrung der Rosenkranzmadonna von Valle di Pompeji zu verbreiten, eines damals kleinen, unbedeutenden Ortes unweit des durch den Vesuvausbruch im Jahr79 n. Chr. Zerstörten und vor gut 150 Jahren wieder ausgegrabenen antiken Pompeji.
Don Bartolo Longo, ein Rechtsanwalt, nahm sich der Sache besonders an und begann dort mit bescheidensten Mitteln den Bau einer Kirche für die Unterbringung des bekannten Wallfahrtsbildes der Rosenkranzmadonna. Die Rechnung für den Bau dieser Kirche ist noch erhalten. Der Grund und Boden, auf dem die Kirche errichtet wurde, kostete 1630 Lire. Eine von der Gattin Bartolo Longos veranstaltete Sammlung erbrachte 1732 Lire und 85 Centesimi. Dem Maurermeister Cirillo und seinen Arbeitern wurden monatlich 336 Lire bezahlt Auch freiwillige Helfer boten sich an.
Eines Tages besuchte Don Bartolo einen seiner Freunde und traf dort einen älteren Herrn, den er nicht kannte. Als er von der Erbauung der neuen Kirche zu erzählen begann, fragte der Fremde: „Wer ist der Architekt?“ „Wir haben keinen“, erhielt er zur Antwort. „Haben Sie wenigstens einen Plan, nach dem Sie arbeiten?“ „Gewiss“, erwiderte Don Bartolo stolz und zeigte den Plan, den er immer bei sich trug. „Ein junger Priester aus Pompeji, mit dem ich befreundet bin, hat ihn angefertigt.“ Der Fremde begann zu lächeln, als er die primitive Zeichnung erblickte. „Aber warum nehmen Sie sich zu einem solchen Bau keinen tüchtigen Architekten?“ „Weil wir kein Geld haben.“ „Geben Sie mir die Zeichnung! Ich werde Ihnen einen vollständigen, fachgerechten Plan liefern, ohne dass das, was bereits fertig ist, wertlos wird.“ Don Bartolo waren schon oft solche „Gratis-Angebote“ gemacht worden. Meist hatte er aber hinterher noch dafür zahlen müssen. Sein Freund begriff, was ihm durch den Kopf ging, und sagte: „Der Herr hier ist Professor Cua, der bekannte Mathematiker unserer Universität. Sei unbesorgt, du wirst einen ausgezeichneten Plan bekommen, ohne auch nur einen Soldo dafür bezahlen zu müssen.“ Don Bartolo vermochte kaum ein Wort des Dankes hervorzubringen. Der berühmte Mathematiker schnitt ihm jedes weitere Wort ab und sagte: „Ich werde nicht nur den Plan ausarbeiten, sondern Ihnen auch persönlich bei der Arbeit helfen.
So begann man den Bau der Basilika, die aus Vulkangestein erstellt wurde. Zwei als Aufseher in Pompeji Scavi (dem Ort der antiken Ausgrabungen) angestellte Männer hatten damals gerade begonnen, in der Nähe der Straße Neapel-Salerno Vulkangestein zu brechen. Don Bartolo bat um Überlassung von Steinen für den Bau seiner Kirche, und sechs Monate lang, von Januar bis Juni 1877, lieferten die beiden monatlich für 100 Lire Steine an. Bald erwies es sich als notwendig, eine Straße anzulegen, um mit Wagen an den Steinbruch heranfahren zu können. Prof. Cua leitete auch diese Arbeit.
Während so der Bau der Kirche trotz vieler Schwierigkeiten Fortschritte machte, wurde Don Bartolo eines Tages eine Besucherin gemeldet, die von einem Aufseher aus Pompeji Scavi begleitet war. Es war Lady Herbert, die Mutter Lord Pembrokes, des bekannten englischen Politikers. Die Dame, die kurz vorher zur katholischen Kirche übergetreten war, hatte das antike Pompeji besucht und dabei von weitem das auf der Baustelle errichtete Holzkreuz erblickt. „Ein Kreuz in Pompeji?“ hatte sie überrascht ausgerufen. Das Ergebnis ihres Besuches war, dass kurz darauf, zu einer Zeit, als noch kaum in Italien etwas von dem bekannt war, was in Pompeji vor sich ging, die bekannte englische katholische Zeitschrift „The Tablet“ einen Artikel darüber brachte. Daraufhin begannen von überallher, aus London, Dublin, Malta, den USA usw., ein Strom meist anonymer Spenden zu fließen, der heute noch (1950) anhält. Der größte Teil davon wurde in drei großen Wohltätigkeitswerken angelegt, die Don Bartolo Longo gründete.
Seitdem ist das neue Pompeji nicht nur ein berühmter Wallfahrtsort, sondern auch eine Stätte der Liebe und der Barmherzigkeit geworden. Im Schatten des großen Glockenturms aus Granit, der über 80 Meter hoch emporragt, finden mehr als tausend arme, bedauernswerte Menschen Hilfe. Das dort entstandene Waisenhaus nimmt heute (1950) allein über 300 Kinder zwischen 3 und 7 Jahren auf. Sie werden liebevoll erzogen und gründlich für das Leben geschult. Ein zweites Institut ist für die „Waisen des Gesetzes“ gegründet worden. Hier werden, ohne Rücksicht darauf, ob es sich um Italiener, Franzosen, Deutsche oder Engländer handelt, Jungen von 4 Jahren an aufgenommen, deren Väter oder Mütter zu längerer Kerkerhaft verurteilt sind. Das dritte Institut entspricht dem zweiten, nimmt aber nur Mädchen auf. Ihrer Art und ihrem Zweck nach sind diese Institute die einzigen in ganz Europa. Die Jugendlichen erlernen hier einen vollwertigen Beruf. Mit 20 Jahren verlassen sie das Institut.
Don Bartolo erlebte die Vollendung des letzten seiner Hilfswerke nicht mehr. Seit dem 5. Oktober 1926 ruht er in der Krypta der von ihm erbauten Kirche. Sein Seligsprechungsprozess steht kurz vor dem Abschluss. Dann werden Millionen Gläubige nicht mehr „für den Advokaten Don Bartolo Longo“, sondern „zum seligen Bartolo Longo“ beten, dem frommen Laien, der neben dem antiken heidnischen Pompeji ein christliches Pompeji schuf.
(Gekürzt aus „Sintesi“, Via S. Antonio 5, Mailand, Dezember 1950)
Anmerkung: Bartholomäus Longo wurde am 26. Oktober 1980 durch Papst Johannes Paul II. seliggesprochen. Sein Gedenktag ist der 5. Oktober.
________________________________________________________________________

109. Die Mariahilf-Kapelle zu Eggenbach bei Döringstadt in Oberfranken
In einer angenehmen Talebene, die sich am Ufer des Itz hinzieht, liegt gegen Coburg das Dorf Eggenbach. In einiger Entfernung erhebt sich auf der Anhöhe gegen Osten gar freundlich die schöne Wallfahrtskirche Mariahilf. Daselbst stand in der Vorzeit anfänglich eine Bretterhütte und nachher an deren Stelle eine ganz kleine Kapelle mit dem aus Holz geschnitzten Bildnis der schmerzhaften Mutter Gottes, die sich zur jetzigen Wallfahrtskirche ausgebildet hat.
Das Marienbild in der Bretterhütte scheint in den früheren Zeiten wenig beachtet worden zu sein. Um das Bild mehr zu schützen, wurde statt der Bretterhütte eine etwas dauerhaftere, kleine Kapelle erbaut. Von nun an wurde die heilige Gottesmutter an dieser Stelle immer häufiger verehrt. Im Jahr 1707 wurde der Grundstein zur jetzigen Kirche gelegt. Zur Vollendung gelangte sie im Jahr 1710. Am 9. August 1713 wurde sie durch den Weihbischof Dr. Johann Bernard von Würzburg eingeweiht.
Der Ruf dieses Wallfahrtsortes wurde unterdessen durch die Erzählung eines Wunders sehr erhöht. Folgendes sagt eine vorhandene Urkunde darüber:
„Es bekennet Jörg Geber von Gerach aus der Baunacher Pfarrei, daß sein söhnlein zehn Wochen stumm undt ein Elender grummer Grüppel gewesen, dazu sechzehn Wochen lang das freschlich gehabt habe, nun so hat Er Geber sammt seiner Hausfraw, weil kein menschliche Hülf vorhanden gewest, Ihre andacht undt gelübtnuß nach Egerbach zu Maria-Hülf genommen, undt daß Kindt dahin nit allein versprochen, sondtern auch dorthin getragen, Ihr andacht allda nach Gott zu Mariam zu verrichten. Als sie dann ihre andacht und Opffer verricht gehabt undt wieder aus der Mariä-Hülf-Cappeln gehen wollen, unter der Kirchthür sanget das Kindt ahn undt sagt zu seinen Vatter: „Vatter ich kann rethen“, undt alß sie das Kindt zu probiren nieder auf seine grumme Füß gesetzet, finge es auch ahn zu gehen undt ginge selbst nacher Hauß undt ist daß Kindt dato noch frisch undt gesundt. Daß bekennet undt bezeuget Peter Oth schuldheiß undt Haneß Zwinger, beede von Gerach 1714 den 12. May.“
Der zahlreichere Besuch der Kirche hatte natürlich eine Vermehrung der Gottesdienste zur Folge. Da das Gnadenbild, das auf dem Hochaltar seine Stelle fand, die schmerzhafte Mutter Gottes darstellt, so war von nun an das Fest Mariä-Schmerz das Patronatsfest der Kirche. Zur Erhöhung der Feier desselben wurde um Verleihung eines Ablasses nachgesucht und dieser auch im Jahr 1716 erteilt.
Welch große Verehrung man aus der Nähe und Ferne noch immer gegenüber der heiligen Mutter Gottes zu Mariahilf in Eggenbach trägt, beweisen die vielen Andächtigen, die fortwährend im Verlauf des Jahres sich dort einfinden. Der Hochaltar mit dem Gnadenbild ist eingeweiht zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria. Das Innere der Kirche zeigt, dass man sich in einer Wallfahrtskirche befindet, zu deren Ausstattung viele fromme Verehrer der heiligen Jungfrau Maria eine lange Reihe von Jahren hindurch das ihrige beitrugen.
(Aus: Marianischer Festkalender, Regensburg 1866)
________________________________________________________________________




110. Die Wallfahrtskirche auf dem Fahrenberg in der Oberpfalz
Auf dem hohen Fahrenberg bei Waldthurn im Landgerichtsbezirk Vohenstrauß steht eine schöne Marienkirche. Über den Ursprung geht folgende Sage:
„Dem Kaiser Heinrich dem Vogler wurde die Tochter Judith von einem Vornehmen seines Hofes – dem Grafen von Altenburg geraubt. Er trauerte lange um sie und ließ sich aus Schmerz den Bart wachsen. Endlich machte er eine Jagd von Regensburg herauf, bestieg, nachdem er sich verirrte, einen Berg, um sich zu orientieren, sah aber nichts als Wildnis. Nachts jedoch bemerkte er auf einem gegenüberstehenden Berg Licht. Er lenkte seine Schritte dahin, nahm Nachtherberge und fand unerkannt seine Tochter mit ihrem Entführer als deren Gemahl und sieben Kinder. In kurzer Zeit erschien er mit einer Schar Krieger, um die Burg einzunehmen, söhnte sich jedoch mit deren Bewohner aus. Von daher hat jener Berg, wo er auf die Spur seiner Tochter gekommen ist, den Namen Fahrenberg, jene Burg aber, wo er vom Licht geleitet eingekehrt war, hat den Namen Leuchtenberg erhalten.
Später kam die Burg Fahrenberg als Lehen an die Tempelritter, die in der Kapelle, die sie an die Burg gebaut hatten, die nämliche Statue der seligsten Jungfrau, die noch heute in der großen Kirche verehrt wird, aufstellten. Von ihnen kam sie jedoch bald an das Kloster Waldsassen unter dem Namen einer Propstei, wodurch die Verehrung Unserer Lieben Frau bedeutend erhöht worden ist. Im Jahr 1352 wurde die Propstei den Nonnen zugewiesen. Von den Hussiten aber wurden 1425 diese Nonnen zerstreut, das Klösterlein niedergerissen und das Bildnis der seligsten Jungfrau in einen tiefen Brunnen geworfen, jedoch einige Zeit danach auf die Anzeige einer alten Nonne, die unter einer halb eingerissenen Mauer den Stürmern zugesehen hatte, wieder herausgenommen und in dem Kirchlein, das unversehrt stehen geblieben war, wieder auf den Altar gesetzt.
Als zur Wiederherstellung der katholischen Religion einige Väter aus der Gesellschaft Jesu in die Oberpfalz gesandt wurden, denen von 1626 bis 1643 Waldsassen auch übergeben war, kamen sie ebenfalls auf den Fahrenberg. Allein bald darauf erschienen wieder böhmische Religionsneuerer, sprengten drei Patres in den von daher so genannten Münchsprüll bei Waldau und verbrannten das Kloster. Im Jahr 1656 wurde die Herrschaft Waldthurn mit dem Fahrenberg dem Fürsten von Lobkowitz, Herzog von Sagan, käuflich überlassen. Bald folgte eine glänzendere Epoche der Wallfahrtskirche auf dem Fahrenberg. Als das Kirchlein im Jahr 1775 bis auf den durch ein Gewölbe geschützten Hochaltar vom Blitz niedergebrannt worden war, entstand durch die Opfer der Gläubigen und Beiträge von Guttätern allein der jetzige großartige majestätische Tempel, der ungeachtet seines großen Umfanges an den Marienfesten kaum den dritten Teil der Wallfahrer fassen kann.
Am 11. August 1818 wurde von Sr. päpstlichen Heiligkeit Pius VII. für die Feier eines Jubiläums vollkommener Ablass verliehen. Diese nahm auch am 8. September selben Jahres ihren Anfang und dauerte acht Tage. Täglich wurde Amt und Predigt unter ungeheurem Zudrang des Volkes gehalten und mehr als 20.000 katholische Christen empfingen während dieser Tage die heiligen Sakramente. Seitdem blüht diese Wallfahrt fort. Besonders sind es die Marienfeste, an denen öfters die Bewohner der benachbarten Pfarreien in Prozession mit Fahnen und Musik unter Leitung ihrer Seelsorger, sowie des benachbarten Böhmens zahlreich hierher pilgern.
(Aus: Marianischer Festkalender, Regensburg 1866)
pfarrei-waldthurn/kirchen/kirche-fahrenberg/
_______________________________________________________________________

In der Nähe des im Regierungsbezirk Oberpfalz und Regensburg gelegenen Städtchens Freystadt, etwa 500 Schritte außerhalb der Mauern der Stadt, liegt das Franziskaner-Kloster mit der marianischen Wallfahrtskirche oder Tilly-Kapelle.
Über ihren Ursprung und ihre Erweiterung melden die Urkunden Folgendes:
Im Jahr 1644 haben Kinder, die in der Gegend Hutweide hielten, an dem Platz des gegenwärtigen Tempels eine äußerst kleine Kapelle aus Sand und Lehm errichtet, und als diese zusammengefallen war, eine etwas größere aus Lehm und Stein erbaut, und sie mit einem geschnitzten Marienbild geziert. Sie errichteten auch ein kleines Glockentürmchen und hängten ein winziges Glöckchen darin auf. Bald fiel auffallender Weise Opfer an, und sogar verschiedene Wundertaten erfolgten für Andächtige an dieser Stätte. Geistliche und weltliche Obrigkeit dachte indes könnte Täuschung und Leichtgläubigkeit im Spiel sein, und hielt für ratsam, die Hinwegschaffung der kleinen Kapelle zu befehlen, nachdem sie bereits acht Jahre gestanden hatte. Sie wurde eingestürzt. Im Jahr 1664 ließ der gottesfürchtige Drahtfabrikbesitzer und Bürgermeister von Freystadt, Friedrich Kreichwich, an dem Ort der zerstörten kleinen Kapelle zu Ehren der jungfräulichen Mutter Maria eine ganz neu gemauerte Kapelle herstellen, und darein das jetzige Gnadenbild setzen. Im Jahr 1669 entschloss sich benannter Friedrich Kreichwich, unter Mitwirkung der Gemahlin des damals regierenden Herrn, Ernst Emmerich Reichsgrafen von Tilly, Maria Anna Theresia, einer geborenen Freiin von Haslang, im Einverständnis mit der geistlichen Behörde, die Kapelle erweitern und zu einer förmlichen kleinen Kirche umgestalten zu lassen. Sie wurde mit vier Altären vom Hochwürdigsten Herrn Weihbischof in Eichstätt im Jahr 1670 den 28. September feierlich eingeweiht. Im Jahr 1680 erhielt die oben genannte gottesfürchtige Witwe des inzwischen gestorbenen Reichsgrafen Ernst Emmerich, Maria Anna Theresia von dem damaligen Fürstbischof von Eichstätt Marquard II. die Erlaubnis, drei Patres und einen Laien-Bruder der Franziskaner von Dietfurt näher zu berufen, und ihnen zur Wohnung ein Hospitium zu erbauen.
Da hat der Herr des Himmels zum Zeichen seines göttlichen Wohlgefallens an diesem Andachtsort ein wunderbares Merkmal seiner Allmacht dem Menschen kundgegeben. Als nämlich im Jahr 1681 den 21. November am Fest Mariä Opferung P. Zacharias Ginther, als damaliger Superior daselbst, beiläufig um 10 Uhr vormittags bei hellem Sonnenschein unter freiem Himmel neben der Kapelle in Gegenwart vieler Zuhörer von der hohen Himmelskönigin eine begeisterte Lobrede hielt, und sie unter anderem einem Meerstern verglich, der in dunkler Nacht auf sturmbewegter See den zagenden Schiffen Rettung kündet, sieh, da wurde ungeachtet der hellglänzenden Sonnenstrahlen von allen Gegenwärtigen ein über der Kapelle leuchtender, prachtvoller Stern gesehen, der sein wunderbares Licht ergoss, bis die Lobrede vollendet war, worauf im Angesicht alles Volkes das liebliche Sternbild alsobald verschwand. Zum Denkzeichen jener auffallenden Erscheinung wurden auf die vier oberen Gesimsen der Seitenfenster unterhalb der Kuppel der jetzigen Wallfahrtskirche vier aus vergoldetem Kupferblech geformte Sterne gesetzt, die noch heutzutage zu sehen sind.
Im Lauf der Zeit richtete der damals regierende Herr Reichsgraf Ferdinand Lorenz Franz Xaver von Tilly, auf die Hebung und Förderung der Wallfahrt ein besonderes Augenmerk. Zu dem Ende erhielt er auf dringendes Anhalten von dem Fürstbischof von Eichstätt, nicht allein die Vergünstigung, aus eigenen Mitteln und Beiträgen ein neues Gotteshaus aufzuführen, sondern auch die Patres der Franziskaner für immer an diesem Gnadenort zu behalten. Die feierliche Einweihung des neuen marianischen Tempels zu Ehren der Himmelfahrt der allerseligsten Jungfrau wurde den 3. August 1710 durch den hochwürdigsten Weihbischof von Eichstätt vollzogen.
Bei der allgemeinen Klosteraufhebung in Bayern erreichte auch dieses Kloster im Jahr 1803 den 3. September seine Endschaft. Im Jahr 1836 wurden durch Errichtung eines Franziskaner-Hospitiums daselbst die Wohngebäude und mehr als die Hälfte des Klostergartens, teils durch Schenkung, teils durch Wiederankauf der Stadtgemeinde ihrer früheren Bestimmung zurückgegeben. Gegenwärtig (1860) leben in diesem Hospitium drei Patres und vier Laienbrüder aus dem Franziskaner-Orden, deren erstere Aufgabe es ist, die geistlichen Bedürfnisse der Wallfahrer zu befriedigen, und auch sonst in der Seelsorge Aushilfe zu leisten.
(Aus: „Marianischer Festkalender, Regensburg 1866)
________________________________________________________________________
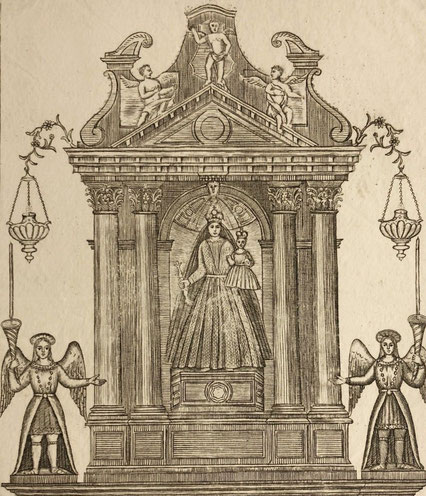
112. Die Wallfahrtskirche U. L. F. zu Dettelbach in Unterfranken
Außerhalb des Städtchens Dettelbach in Unterfranken, auf einer die ganze Umgegend beherrschenden Anhöhe, steht ein Kloster der Franziskaner, mit der vielbesuchten und weitberühmten Wallfahrtskirche „Maria-Dettelbach“. In frühesten Zeiten befand sich in Mitte von Weinbergen an derselben Stelle, wo sich jetzt das schöne Gotteshaus erhebt, auf einer einfachen Säule das Bildnis der heiligen Jungfrau und Mutter Gottes Maria, auf ihrem Schoß ihren vom Kreuz abgenommenen göttlichen Sohn haltend. Hier pflegten die Winzer, ehe sie an ihre Arbeit gingen, sich der seligsten Jungfrau zu empfehlen, und wohl keiner von den Wanderern, die da der Weg vorüberführte, unterließ es, Maria mit einem kurzen Gebet zu begrüßen, während andere, besonders aus dem Städtchen, in stillen Stunden eigens hierher kamen, um vor dem Bild der schmerzhaften Mutter ihre Andacht zu verrichten. Ein Ereignis vom Jahr 1504 machte, dass sich der heilige Ruf dieses Bildes weit hin verbreitete, und dass sich allmählich der einfache Bildstock in eine schöne, geräumige Kirche verwandelte.
Nikolaus Lemmer, ein armer Taglöhner aus einem benachbarten Dorf, wurde bei einer anlässlich der Kirchweihe entstandenen Rauferei durch Schläge und Wunden derart zugerichtet, dass er ein ganzes Jahr schwer krank zu Bette lag. Er konnte kein Wort reden, war zeitweise besinnungslos, nicht einmal bis zum Mund konnte er die Hand führen, und niemand glaubte mehr an sein Aufkommen. Die Lage des Kranken wurde noch trauriger durch die äußerste Armut, in der er schmachtete, da Nachbarn und Bekannte wegen seines früheren leichtsinnigen Lebens wenig geneigt waren, ihn zu unterstützen. Die Reue, die er nun über seinen früheren ungeordneten Wandel fühlte, und die Gebete, die er in seiner Zerknirschung zum Himmel und besonders zur seligsten Jungfrau Maria sendete, zogen ihm die Hilfe dieser Mutter der Barmherzigkeit zu. Ein Traum gab ihm Hoffnung und veranlasste ihn zu dem Gelübde, mit einer brennenden Wachskerze zu dem Bildstock der schmerzhaften Mutter bei Dettelbach zu wallfahrten, wenn er seine Gesundheit wiedererlangte. Erwacht aus dem Schlaf, rief er vertrauensvoll die seligste Gnadenmutter an und machte das Gelübde. Die Chirurgen waren die ersten, die die Wirkung des Gelübdes sehen sollten, denn zu ihrem Staunen gewahrten sie, dass die Wunden, die sich bisher durch all ihre Mittel nicht schließen und in Eiterung übergehen wollten, allmählich ohne Anwendung irgend eines Heilmittels schlossen und sich die anderen von den Wunden herrührenden Übel verloren. Bald fühlte sich Nikolaus hergestellt, verschaffte sich eine Wachskerze und löste sein Gelübde. Als er vor der Säule Gott und Maria Dank gesagt hatte, wusste er nicht, was er mit der brennenden Wachskerze tun sollte. Sie vor dem Bild liegen zu lassen, schien ihm ungeeignet, sie mit nach Hause zu nehmen, nicht weniger. In Gedanken hierüber und müde von dem Gang setzte er sich auf den nächsten Rasen und schlief ein. Da hatte er einen zweiten Traum, durch den er ermahnt wurde, sich in die Stadt auf das Rathaus zu begeben und vor den eben versammelten Ratsherren alles zu erzählen, was sich mit ihm begeben hatte. Er tat es sogleich. Einige der Ratsherren meinten, solche Träumereien nicht beachten zu müssen, andere hingegen erinnerten an die von den Voreltern überlieferte Sage, dass man früher zu Zeiten Glockengeläute in jener Gegend, wo die Säule steht, gehört habe, was nach dem Glauben der Ahnen dahin zu deuten sei, dass dort einst eine Kirche erbaut würde. So ging man ohne einen Entschluss zu fassen auseinander, und Nikolaus, der seine Kerze im Rathaus zurückließ, begab sich nach Hause und erzählte bei jeder Gelegenheit, was ihm begegnet war, und auch, was er über das Glockengeläute vernommen hatte, das man in früheren Zeiten gehört haben wollte. Das Volk griff die Sache auf, um die sich der Rat nicht weiter zu kümmern schien. Der andächtige Besuch des Bildes wurde immer häufiger und allgemeiner, man steuerte zusammen und ließ vor der Hand eine hölzerne Kapelle erbauen, die das Bild und die dargebrachten Votiv- und Weihegeschenke schützen sollte. Schon im Jahr 1519 kam mit Genehmigung des Fürstbischofes von Würzburg, Laurentius von Bibra, an die Stelle der hölzernen eine gemauerte Kapelle mit drei Altären, an der ein eigener Wallfahrtspriester angestellt wurde. Bibras Nachfolger, Konrad IV. (von Thüngen), ließ sie erweitern.
Im Jahr 1597 wäre das schöne Kirchlein durch eine Wachskerze, die auf dem Altar neben dem Vesperbild angezündet war, beinahe in Feuer aufgegangen. Die Vorhänge und Zierraten nebst anderen Bildern waren bereits ein Raub der Flammen geworden, das Gnadenbild blieb jedoch unversehrt. Auch später nachdem schon die jetzige große Kirche nebst einem geräumigen Kloster für Mönche des Franziskaner-Ordens erbaut war, wachte der Himmel auf besondere Weise über das Gnadenbild, das nun auf einem Thron von getriebenem Silber auf einem Altar – an der Stelle, wo früher der Bildstock stand – sich befindet. Der berühmte Wallfahrtsort wurde im dreißigjährigen Krieg von den Schweden furchtbar mitgenommen. Die Mönche mussten flüchten, so dass im Jahr 1631 die blühende Wallfahrt so viel wie vernichtet, das Klostergebäude fast ganz unbewohnbar gemacht worden war. Der bedeutende Kirchenschatz geriet in die Hände des Feindes, - doch blieb das größte Gut der Kirche – das wundertätige Gnadenbild – unangetastet und unversehrt. So wie es der Abzug des Feindes möglich machte, säumten einzelne Ordenspriester nicht, zurückzukehren, um die Gottesdienste an der Wallfahrtskirche, so gut sie konnten, zu versehen. Vom Jahr 1641 an aber erhoben sich Kloster und Kirche wieder aus ihrem Verfall.
Unzählige Votivtafeln bekleiden die Wände der majestätischen, mit herrlichen Gemälden gezierten Kirche, zu der noch immer zahlreiche Wallfahrer – einzeln und in großen Zügen – pilgern. Die stärkste Prozession erscheint um das Fest des heiligen Jakobus aus dem fuldaischen Land. Sie besteht meistens aus drei- bis viertausend frommen Gläubigen.
Wunder, die dort stattfanden:
Von den zahllosen Wundern, die schon in früher Zeit bei Unserer Lieben Frau zu Dettelbach stattfanden, erzählt der gottselige Abt Johannes Trithemius in einem eigenen Buch. Er beteuert feierlich, dass er nur das, was er mit eigenen Augen gesehen oder von glaubwürdigen Zeugen vernommen hat, niedergeschrieben habe. Im Jahr 1510 machte er selbst eine Wallfahrt nach Dettelbach in Folge eines Gelübdes, das er wegen eines schweren Kopf- und Halsübels gemacht und von dem ihn die Fürbitte der Lieben Frau befreit hatte.
Von diesen Wundern sollen nun mehrere zum Lob und Preis der erhabenen Gottesmutter und zur Aneiferung unseres Vertrauens und unserer Andacht zu ihrer mächtigen Fürbitte, erwähnt werden.
Im Dorf Bibergau lebte ein Bauer, namens Richard Schiller, der ein Knäblein von fünf Jahren hatte. Im Jahr 1506 am 23. Juli ging der Junge mit einer Sichel aufs Feld hinaus, um, wie er es von andern gesehen hatte, zu grasen. Hinter den Zäunen aber war ein Wolf verborgen, der den Jungen allein erblickend, plötzlich packte und sich mit seiner Beute entfernte. Sogleich hinterbrachte man es dem Vater, der aus seiner Wohnung stürzend den Wolf mit dem Jungen in der Ferne laufen sah, aber nicht mehr helfen konnte. Von Angst ergriffen, verzweifelnd an menschlicher Hilfe, fiel er zu Boden, und rief mit Tränen zur göttlichen Mutter Maria: „O heilige Maria, Mutter des Herrn, gib mir den Jungen unverletzt zurück und ich will zu deinem heiligen Bild nach Dettelbach ziehen, dort beten, danken und opfern.“ Und, o Wunder, kaum hatte er dies gelobt, als der Wolf den Jungen aus seinem Rachen fallen ließ und davon lief. Schnell eilte der angstvolle Vater hinzu und fand den Jungen unverletzt. Seine Freude war unbeschreiblich und sein Dank gegen die Liebe Frau, als er sein Gelübde erfüllte, unbegrenzt.
Im Jahr 1507 fiel im Dorf Wayern ein Junge von sechs Jahren in einen sehr tiefen Brunnen, ohne dass jemand davon wusste. Als die Eltern längere Zeit um ihn in und außer dem Haus suchten, und ihn nicht fanden, da ergriff sie große Angst und zur Lieben Frau inbrünstig flehend gelobten sie eine Wallfahrt nach Dettelbach mit einer Kerze, ein Pfund schwer, wenn sie den Jungen gesund wieder fänden.
Nun suchten sie auch das ganze Dorf ab und endlich fanden sie den Jungen im Brunnen liegend wie einen Schlafenden. Als sie ihn mit größter Eile herauszogen, fanden sie ihn frisch und gesund, auch nicht ein Tropfen Wasser war in ihn gedrungen. Dessen waren viele Zeugen, die das Wunder weithin verbreiteten.
Im Jahr 1509 ging ein Mann, mit Namen Johannes Koch, vom Dorf Greuß ins Wirtshaus. Da entstand unter den Gästen Streit, und genannter Koch erhielt von einem, der schon länger einen Groll auf ihn hatte, einen solchen Stich in den Unterleib, dass das Messer den ganzen Leib durchbohrte. Der Täter floh. Koch stürzte zusammen, und nach Hause getragen, erwartete er den Tod. In seiner Todesangst gedachte er noch Unserer Lieben Frau von Dettelbach, flehte herzinniglich zu ihr um Hilfe, und versprach zu ihrem heiligen Bild zu wallfahrten und drei Pfund Wachs zu opfern. Schon war er dem Tod nahe, als er plötzlich nach getanem Gelübde Besserung fühlte und bald Heilung fand.
Im Jahr 1507 fiel der fünfjährige Junge des Leonard Spor von Leymach in ein Messer, das er in der Hand hielt und stach es sich tief in den Unterleib. Als dies die Mutter sah, schrie sie aus Leibeskräften. Die Nachbarschaft lief zusammen, und als sie den unglücklichen Jungen daliegen sah, riefen alle zur gebenedeiten Gottesmutter und gelobten eine Wallfahrt nach Dettelbach. Die Mutter ganz bestürzt und wie außer sich, merkte nicht auf das, was die Nachbarn sagten, sondern neigte sich zu ihrem Jungen nieder, zog heftig das Messer aus seinem Leib und fiel dann ohnmächtig zu Boden. Aber kaum war das Messer herausgezogen, als der Junge sich erhob, und, als sei ihm gar nichts geschehen, ganz gesund umherlief. Und was besonders wunderbar war, obwohl die offene Wunde sehr tief war, floss doch kein Tropfen Blut heraus. Der Junge zeigte auch die offene Wunde, die ihm nicht den mindesten Schmerz machte. Voll des Dankes gingen die Eltern hierauf mit dem Jungen nach Dettelbach und lobten Gott und seine heilige Mutter.
Ich kenne, schreibt der fromme Abt Trithemius, einen gottesfürchtigen Priester, dessen Namen ich aber verschweige, der an den heftigsten Steinschmerzen leidend krank darniederlag, ein Gegenstand des Mitleids aller, die ihn sahen. Da alle Mittel gegen das Übel vergeblich waren, nahm er seine Zuflucht zur Gottesmutter und unbefleckten Jungfrau Maria und flehte, wie er mir selbst gestand, also zu ihr: „O heiligste Gottesmutter und immer unbefleckte Jungfrau, Mutter der Barmherzigkeit, Quelle der Güte, die du niemals jemanden, der in seiner Trübsal getreulich dich anrief, verlassen hast, erbarme dich meiner, und bitte für mich deinen Sohn, dass er mich befreie von der unerträglichen Krankheit, an der ich leide. Ich will dich in eigener Person in Dettelbach besuchen, und deine Güte, so viel ich kann, immer preisen.“ Nachdem er so unter Tränen gebetet hatte, schlief er, durch die Schmerzen ermattet, ein wenig ein, und als er erwachte, fand er sich vom Stein und Schmerz befreit. Alsbald brachte er auch der Gottesmutter in Dettelbach ganz in der Stille seinen Dank dar.
Im Jahr 1510 lebte im Dorf Regerndorf ein Mann, Lilian mit Namen, der ein dreijähriges Töchterchen hatte. An einem Freitag in Mittenfasten verließ es das Haus ihres Vaters und leichtfertig herumlaufend, fiel es in einen Weiher, der mitten im Dorf lag und den Pferden zur Tränke diente, und ertrank. Nach einer Stunde vermissten die Eltern ihre Tochter, suchten sie und fanden sie endlich im Wasser liegend bereits ertrunken. Der Vater angsterfüllt stürzt ins Wasser und zieht sie heraus, fand aber kein Zeichen des Lebens mehr an ihr. Mehrere Stunden lag das Kind da voll Wasser. Menschliche Hilfe vergeblich anwendend, nehmen die Eltern ihre Zuflucht zu Gott und machen das Gelübde, dass sie nach Dettelbach wallfahrten und dort der Mutter Gottes ein Messkleid von Seide opfern wollten samt allem, was dazu gehört. Kaum hatte sie das Gelübde gemacht, als das Mädchen zum Leben wiederkehrt. Sobald das Messkleid fertig war, kamen die glücklichen Eltern nach Dettelbach und brachten ihren Dank und ihr Opfer dar.
(Aus: „Marianischer Festkalender für das katholische Volk“, Regensburg 1866)
wallfahrtskirche.pfarrei-dettelbach
_______________________________________________________________________

113. Die Wallfahrtskapelle auf dem Kronberg bei Griesbach im Rottal: "U. L. F. vom Schutz"
Im königlichen Landgerichtsbezirk Griesbach und hart am gleichnamigen Markt liegt der Kronberg, der in fürstlicher Erhabenheit alle seine Brüder überragt, die die fischreiche Rott umprangen und umlagern. Dieser Berg trägt auf seinem luftigen Scheitel eine geweihte Krone, nämlich die liebliche Wallfahrt „Unserer Lieben Frau vom Schutz“.
Über die Entstehung und Ausbreitung dieser Wallfahrt sagt die Geschichte Folgendes:
Im Jahr 1686 stand auf dem Kronberg ein abgestorbener, entblätterter Eichenstamm, der inwendig morsch und hohl war und den Hirtenjungen zum Notdach bei Sturm und Regen diente. Dieser abgedorrte Stamm machte in diesem Jahr noch einer jungen Linde Platz, die Jakob Mayer, Bauer der benachbarten Hofmark Taham, pflanzte. Diese Linde nun schoss schnell empor und gewann derart die Liebe und Aufmerksamkeit ihres mühsamen Pflanzers, dass er eigens um ihren jugendlichen Stamm herum vier Pfähle in die Erde einrammelte, sie verzäunte und so seine schöne Lieblingspflanzung gegen störende Beschädigungen zu schützen suchte. Der sehr schöne, blühende Lindenbaum nun, wurde aber in der Folge vom Allerhöchsten dazu bestimmt, ein Gnadensitz seiner gebenedeitesten Mutter zu werden und mit seinem zarten Gezweige eine duftreiche Laubkapelle derjenigen zu bilden, die hinfort die gnadenreiche milde und allgeliebte Schutzfrau des ganzen, zu ihren Füßen liegenden Rottales werden sollte.
Unsere frommen Voreltern brachten zur schönen Linde auf dem schönen Kronberg Bilder und Täfelchen von ihren teuren Hausaltären mit, hingen sie an den prächtigen Stamm auf, um vor demselben im Freien auf himmelnaher Höhe beim Vorübergehen ihr Gebet desto andächtiger verrichten zu können. Und so kam es, dass der fromme Bauersmann, Johann mayer, bald ein ärmliches Hüttchen über diese religiösen Bilder bauen konnte. Vorzüglich muss ein Liebfrauenbild unter den hierher gebrachten Täfelchen der Gegenstand besonderer Verehrung gewesen sein. Dass dem so sei, beweist folgendes Wunder: Im Jahr 1686 noch, als das erste, höchst dürftige Hüttchen unter dem schönen Lindenbaum noch stand, lebte im Bruderhaus zu Griesbach eine arme Frau, die an allen Gliedern ganz contrakt war und sich mit zwei Krücken fortschleppen musste. In dieser ihrer bemitleidenswerten Bresthaftigkeit hatte sie sich zwar um Hilfe zu „Unserer Lieben Frau von der Heimsuchung“ nach Langenwinkel bei Asbach verlobt, wurde jedoch durch Alter und Schwäche an der Ausführung ihres frommen Gelöbnisses gehindert. Da gedachte sie ihr Gelübde zu lösen. Sie kam auf den nahen Kronberg, wendete sich in inbrünstigem Flehen an die Mutter der Betrübten und – war zur Stunde vollkommen gesund. Die erbauliche Kunde von diesem Wunder verbreitete sich sogleich in der ganzen Umgegend. Es wuchs das Vertrauen und die Andacht zur genannten Wallfahrt und mit dieser auch das Hüttchen wieder, denn im Jahr 1687 konnte der mehrgedachte Bauer Mayer von den immer größeren Opfergaben schon eine Hütte erbauen, die acht bis zehn Andächtige fasste.
Da bediente sich der Herr eines schwerbedrängten Bürgers von Griesbach, namens Daniel Wagner, um die Wallfahrt auf dem Kronberg in noch prächtigeren Flor zu bringen.
Daniel Wagner, bürgerlicher Tischlermeister von Griesbach, wurde nämlich im Jahr 1688 von einem so grausamen Kopfschmerz befallen, dass er gar nimmer auf die Erde niederschauen konnte. In dieser Qual wandte er sich vergeblich an die ärztliche Hilfe. Da ihn am Abend der Weg am Kronberg vorbeiführte, wollte er im schlichten Kapellenhüttchen ein wenig ausrasten. Er gelobte sofort, wenn er von seinem schrecklichen Übel befreit würde, hierher ein Marienbild – Maria Schutz genannt – malen zu lassen, das dem Gnadenbild in der Kirche der Klosterfrauen zu Niedernburg in Passau ähnlich ist und kam nach diesem frommen Versprechen ganz gesund und von seinem marternden Übel befreit in seinem Haus an. Da aber unser guter Schreinermeister nach dem Empfang der großen Wohltat auf den Dank vergaß und sein Gelübde nicht erfüllte, mahnte ihn unser lieber Herr empfindlich an sein Wort dadurch, dass er ihm die frühere Pein wieder sandte, worauf der Tischler sich gleich wieder seines Gelöbnisses erinnerte und zur baldigsten Befreiung von seinem schmerzlichen Zustand sich an den damaligen Prior des naheliegenden Prämonstratenser-Stiftes St. Salvator wandte, und von ihm ein dem Gelübde entsprechendes, zwei Schuh hohes Muttergottesbild malen ließ. Sein Leiden verschwand wieder und er selbst stellte das von ihm sauber gefasste Bild am Osterabend dieses Jahres in der kleinen Kapelle auf dem Kronberg zur öffentlichen Verehrung auf. Aber später kam es dahin, dass das wundersame Gnadenbild aus seiner einsamen Kapelle genommen und in die Pfarrkirche zum heiligen Michael in Griesbach geschafft, die sämtlichen Votivtafeln aber von der stillen Hütte entfernt wurden zum großen Leidwesen der Andächtigen. Diese Verbannung des Gnadenbildes dauerte vom Jahr 1696 bis 1708. Das ursprüngliche Gnadenbild „Maria Schutz“ wurde von der Pfarrkirche auf den anmutigen Kronberg zurückgebracht und leuchtete wieder durch neue zahllose Wunder. Am Gedächtnis der Apostelfürsten Petri und Pauli im Jahr 1847 nun wurde der Grundstein zu einem neuen, größeren Kirchenbau gelegt. Er wurde im Jahr 1851 vollendet. Die feierliche Einweihung fand am 1. Mai 1852 durch den Hochwürdigsten Herrn Bischof Heinrich von Passau statt. Als Gnadenbild wird gegenwärtig ein geschnitztes verehrt, das uralte Gnadenbild hat einen anderen geziemenden Platz.
(Aus: Marianischer Festkalender, Regensburg 1866)
wallfahrtskirche-maria-schutz-kronberg
________________________________________________________________________

114. Die Steinfels-Kapelle zu Landau an der Isar in Niederbayern
In jener traurigen Zeit, als die Schweden, nachdem ihr König Gustav Adolph in der Schlacht bei Lützen (6. Mai 1632) gefallen war, auch das katholische Land Bayern mit Gräuel und Elend erfüllten, geschah es oft, dass die Bürger benachbarter Orte einander zu Hilfe kamen, wenn es je möglich war, den eigenen Herd zu verlassen. So zogen denn auch im Jahr 1645 mehrere Bürger von Landau an der Isar den von den Schweden bedrängten Einwohnern von Straubing zu Hilfe. Unter ihnen befand sich ein Bürger von Landau, Sattlermeister und Feldwebel bei der bayerischen Landfahne, namens Christoph Christi. Die Liebe, mit der er den schwer heimgesuchten Bewohnern der Stadt Straubing zu Hilfe zog, sollte nicht unbelohnt bleiben.
Die Schweden machten wiederholte Einfälle in die Donaugegenden, bald von Regensburg herunter, bald vom Bayerischen Wald heraus, und die Stadt Straubing hatte beständig zu kämpfen und zu wehren. Bei einem solchen Einfall der Schweden geriet Christi in große Gefahr, gefangen zu werden. Die Feinde waren ihm schon so nahe, dass an eine Rettung fast nicht mehr zu denken war. In dieser höchsten Not wendete er sich, wie es jeder katholische Bayer in jener Zeit tat, an die Patronin seines Vaterlandes, die heilige Jungfrau Maria, und sein Rufen nach Hilfe wurde erhört. Es war ihm, als sähe er seine Beschützerin, die seligste Jungfrau, wie in einem Schild über seinem Haupt schweben, und in selbem Augenblick ließen die verfolgenden Schweden von ihm ab und gaben ihre Beute auf.
Christi vergaß seine Helferin und Retterin niemals. Nachdem er zwei Jahre mit den Bewohnern Straubings die Beschwerden und Leiden des Krieges ertragen hatte, und das Ende jenes schrecklichen Dreißigjährigen Krieges herannahte, kehrte er wieder in sein Haus nach Landau zurück. Dort sah er eines Tages bei einem seiner Mitbürger, dem Siebmacher Wanser, ein Muttergottesbild, das ganz genau dem glich, unter dessen Schutz er in jener drohenden Lebensgefahr gerettet worden war. Er wendete nun alles an, um dieses Bild, an das sich für ihn eine so heilige Erinnerung knüpfte, in seinen Besitz zu bekommen. Es war ein Mariahilf-Bild. Er hatte in seinem Garten, der sich an einer Anhöhe hinaufzog, eine Höhle von Sandstein, und in dieser brachte er das erlangte Muttergottesbild an. Lange pflegte er hier ungesehen, still für sich, seine Andacht zu üben. Allein die übrigen Einwohner der Stadt Landau, die die Ursache wussten, warum Christi eine solche Andacht zu diesem Bild trage, und die sich schon seiner Schicksale wegen näher zu ihm hingezogen fühlten, wollten auch an seiner Verehrung der Gottesmutter teilnehmen. Sie drangen in ihn, dass er eine Säule aufrichtete und daran das Bild befestigte. Die Andachtsübungen einzelner wurden bald allgemein, und mancher, der in einem Anliegen in diesen Garten ging und vor dem Bild der Mutter Gottes sein Herz ausschüttete, fand sich erleichtert, gestärkt und getröstet. Der Garten war nun der Garten Mariä geworden, er gehörte nicht mehr dem Christoph Christi, und vom Jahr 1658 an, wo das Bild der seligsten Jungfrau an der Säule angebracht worden, auch nach dem seligen Tod des frommen Sattlermeisters und mutigen Landwehr-Soldaten, blieb dieser Garten die Stätte der Andacht und Verehrung Mariens.
Die Gebete vieler waren an dieser Stätte schon erhört, vielen war in geistlicher oder leiblicher Not durch die Fürbitte der seligsten Jungfrau geholfen worden, auffallende Wunder geschahen an diesem heiligen Ort. Liebe und Dankbarkeit forderten auf, dem Bild der gütigen Jungfrau eine würdigere Stelle zu bereiten, als die Höhle eines Sandsteinberges. Es verbanden sich daher mehrere frommgesinnte Einwohner Landaus zur Gründung eines Kirchleins für das Gnadenbild. Durch Schenkungen der Landleute wurde die Summe, die sie anboten, noch erhöht, so dass im Jahre 1698 der Grund zur Kapelle gelegt werden konnte. Man beschloss, die Kapelle in die Bergwand hineinzubauen und in jene Höhlung des Sandsteins, in der das Bild bisher sich befunden, den Altar einzuhauen. Die Arbeiter waren eben damit beschäftigt, jene Stelle für den Altar aus dem Sandstein herauszuarbeiten, als einem von ihnen, der mit der Schaufel in den Sandstein eindringen wollte, ein kleines Liebfrauenbild von Stein auf die Schaufel sprang. Nicht bloß die Mitarbeiter, sondern auch mehrere andere Personen, die der Arbeit zusahen, nahmen den wunderbaren Fund in Augenschein, und bald verbreitete sich die Kunde davon durch die ganze Stadt. Alles strömte zu der Stelle, und unwillkürlich fiel die Menge auf die Knie. Jubel, Lob und Dank entquoll allen Herzen, dass Gott der Herr die fromme Gesinnung derer, die zur Ehre der seligsten Jungfrau ein Kirchlein erbauen wollten, auf so herrliche Weise belohnt hatte. Die Freude über diesen heiligen Fund sollte indes bald getrübt werden. Die Arbeiter bestanden nämlich zum Teil aus Landauern, zum Teil aus Bewohnern von Irlbach, einer ungefähr drei Stunden von Landau entfernten Hofmark. Der Finder des Bildnisses war einer dieser letzteren, und darum machten die Arbeiter aus Irlbach Ansprüche darauf: und da sie nicht befriedigt wurden, brachte einer aus ihnen das Bild heimlich an sich, trug es nach Irlbach und übergab es seinem Pfarrherrn.
Diese Entwendung und das fernere Schicksal des Bildes wird in folgender Weise nach der mündlichen Überlieferung erzählt, da – außer zwölf Gemälden in der Kapelle, die in Bild und Reim die Entstehungsgeschichte des Kirchleins bis zu seiner Vollendung darstellen – fast gar keine Urkunden vorhanden sind. Indem nämlich durch die schreckliche Feuersbrunst vom Jahr 1743, die Landau bis auf drei Häuser einäscherte, der größte Teil der pfarramtlichen Akten zu Grunde ging.
Der Arbeiter, der das Bildnis entführte, übernachtete, so lange er in Landau beschäftigt war, in einem Haus in der Nähe der Isarbrücke. An jenem Tag nun, - es war ein Samstag – da er das Bild bei sich hatte, bemerkten die Hausleute in seiner Kammer durch die Ritzen der Bretterwand und der Tür einen ungewöhnlichen Schein. Am Sonntag in aller Frühe ging der Arbeiter in seine Heimat nach Irlbach, gab das Bild seinem Pfarrherrn, und der setzte es in der Kirche bei. In der Nacht vom Sonntag auf den Montag sahen die Bewohner von Irlbach durch die Fenster ihrer Kirche ein so helles Licht dringen, dass alle, die auf einer Seite wohnten der Meinung waren, auf der anderen Seite müsse es brennen, und dieses Licht sei der Glanz des durchscheinenden Feuers. Als man sich aber überzeugt hatte, dass es nirgends brenne, und das Licht in der Kirche dennoch glänzte, da erkannte man, dass dieser wunderbare Lichtglanz dem Bild Mariens entströme, und man sah zugleich ein, dass man den Landauern Unrecht tun würde, wenn man ihr teures Gnadenbild länger zurückbehielte. Die Einwohner von Landau wurden in Kenntnis gesetzt, und sie zögerten nicht, das Bild augenblicklich in Empfang zu nehmen. In feierlicher Prozession wurde es nach Landau zurückgebracht.
Diese beiden Ereignisse, die wunderbare Entdeckung des Bildes und die feierliche Übertragung von Irlbach, erhöhten noch mehr den frommen Eifer und beförderten die Vollendung des Kapellenbaus in Landau (im Jahr 1699 war sie vollendet). Das kleine Bildnis von Stein wurde in eine eigens dafür verfertigte Monstranz gebracht und in eine Nische des Tabernakels gestellt, das gemalte Bild, das Christoph Christi von seinem Nachbarn erhalten hatte, bekam seinen Platz oberhalb des Tabernakels. Die feierliche Einweihung des Kirchleins samt den drei darin angebrachten Altären fand erst am 24. Oktober 1716 statt durch den Fürstbischof von Passau Joseph Dominikus Graf von Lamberg. Außer der jährlichen Kirchweih- und Patrociniumsfeier (auf die Feste Mariä-Opferung und Mariä-Heimsuchung verlegt) wird auch das Fest Mariä-Himmelfahrt in dieser Kapelle feierlich begangen. Seit 1850 ist ein einfaches Benefizium für diese Kirche gestiftet, und so wird denn täglich durch den Benefizianten, dessen Wohnung sich neben der Kapelle befindet, an dem Altar der seligsten Jungfrau das heilige Messopfer dargebracht.
Zur Zeit als die Kapelle erbaut wurde, strömte der Hauptarm der Isar, an dem Landau liegt, in ihrer Nähe vorüber. In der Folge aber nahm dieser reißende Fluss, der öfter sein Flussbett ändert, - gewöhnlich nach Hochwasser – einen mehr geraden Lauf und fließt jetzt in weiter Entfernung von dem Kirchlein vorüber, was der fromme Sinn der Achtung selbst des unvernünftigen Elementes gegen die der heiligen Mutter Gottes geweihte Stätte zuschrieb, wie das letzte der oben angeführten zwölf Gemälde andeutet.
(Aus: „Marianischer Festkalender“, Regensburg 1866)
_______________________________________________________________________

115. Die Wallfahrt Mariä Heimsuchung zu Langenwinkel bei Beuerbach in Niederbayern
Im fruchtbaren Rottal, im Pfarr-Vikariat Beuerbach, liegt auf einer einsamen waldumsäumten Höhe die Wallfahrtskirche Langenwinkel.
Im Jahr 1629 unternahm laut Inhaltes des Mirakelbuches Johann Grienwald, bürgerlicher Schmiedssohn aus Salzburg, der von Mutterleib an stumm war, aber den Gehörsinn ganz unversehrt besaß, wahrscheinlich aus Kur- oder Wallfahrtszwecken eine Reise in die Rottaler Gegend. Auf dieser seiner Wanderschaft kam genannter Johann Grienwald nach Beuerbach und scheint sich allda geraume Zeit aufgehalten zu haben. Während dieses seines Aufenthaltes traf es sich nun, dass er auf der heutigen Langenwinkelhöhe ein Marienbild fand, zu dem er ein passendes Gestell zum Aufpflanzen aufrichten ließ. Als er aber in dieser Absicht zum Zimmermeister ging, gewahrte er in dessen Wohnung ein anderes Marienbild, eine Abbildung des berühmten Gnadenbildes samt der Gnadenkapelle zu Mariahilf bei Passau und diese liebliche Darstellung zog ihn dergestalt hin und bewegte ihn dermaßen, dass er gelobte, nach Mariahilf zur Befreiung von seinem Übel eine Kirchfahrt zu unternehmen, was er im selben Jahr noch zur Ausführung brachte. Allein der fromme Waller kehrte stumm zurück, wie er stumm fortgezogen war, und auf eine zweite Wallfahrt nach Mariahilf hin ward sein Zustand um nichts besser. Da pilgerte er mit dem nämlichen Vertrauen noch ein drittes Mal zur mehrgedachten Gnadenstätte und sein unerschütterliches Hoffen trug diesmal schon einige Früchte, denn er konnte seit dieser dritten Wallfahrt, die er im Jahr 1633 verrichtet hat, schon einiges reden. Der erfreute Johann Grienwald brachte nun einige Tage in Mariahilf mit Danksagung und Lobpreisung Gottes und seiner gnadenreichen Mutter zu, während sein Zustand sich zusehends besserte. Um Weihnachten des Jahres 1633 konnte Grienwald vollkommen klar und deutlich sprechen. Er griff daher wieder nach seinem Wanderstab, um nochmal sein Herz vor der himmlischen Gnadenmutter in flammenden Dankgebeten auszugießen und seine Sünden zu beichten. Zugleich bat er auch die hohe Himmelskönigin mit inbrünstigem Flehen, sie möchte ihm huldvollst offenbaren: was für eine Buße und was für ein gutes Dankeswerk er für eine so außerordentliche Gnadenerzeigung verrichten solle. Und siehe, da geschah es, dass ihm, während er im Messnerhaus zu Mariahilf übernachtete, bei ganz wachem Zustand gegen Morgen hin die allerreinste Gottesgebärerin erschien. Aus dem Honigmund der Mutter Gottes aber vernahm er die Worte: Da, auf diesem Plätzchen, bau mir zu Ehren ein Kirchlein!“ Grienwald, der das Plätzchen gleich erkannte, gelobte den heiligen Willen seiner erhabenen Schutzfrau ganz getreulich vollziehen zu wollen und beschloss noch dazu, sein Leben in der Einsamkeit der zu erbauenden Kapelle als Klausner zuzubringen, worauf die wundervolle Erscheinung verschwand.
Jubeltrunken eilte Grienwald nach Beuerbach zurück und wusste nichts eiliger und eifriger zu tun, als mit einer Almosensammlung zum versprochenen Kirchenbau zu beginnen. Im Jahr 1686 wurde die Kirche vollendet und durch den Weihbischof Johann Maximus von Passau konsekriert.
Es erfolgten nun Wunder auf Wunder an der neuen Gnadenstätte. Es sind seitdem zwei volle Jahrhunderte verflossen (im Jahr 1866), aber noch immer pilgert der gutmütige Rottaler gerne in den freundlichen Langenwinkel, besonders am Fest Mariä Heimsuchung, als am Titularfest der Gnadenkirche, da Papst Innocentius X. schon im Jahr 1646 den andächtigen Besuchern dieser Wallfahrt am genannten Tag einen vollkommenen Ablass bewilligte.
Das ursprüngliche Gnadenbild war während des Dreißigjährigen Krieges abhanden gekommen. Heutzutage wird als Gnadenbild das von dem Kapuziner Pater Anton Maria päpstlichen Legaten dorthin geschenkte Marienbild verehrt. Dasselbe soll aus einer an einem Berg in Piemont gegrabenen und gebrannten Erdart sein und befindet sich in einer vergoldeten monstranzartigen Kapsel in der Nische des Tabernakels. Dieses Bild ist sehr freundlich. Es misst etwa neun Zoll in der Höhe und hat ein braungemaltes, sternbesätes Kleid.
(Aus: „Marianischer Festkalender“, Regensburg 1866)
wallfahrtskirche-maria-himmelfahrt-langwinkl
_______________________________________________________________________

116. Lechfeld, Wallfahrtskirche Mariahilf und Franziskaner-Kloster in Schwaben
Zwischen den Flüssen Lech und Wertach zieht sich von Augsburg aufwärts gegen Landsberg an der ehemaligen Grenzscheide zwischen Bayern und Schwaben eine unübersehbare Ebene hin, fast zehn Stunden lang und zwei Stunden breit, das Lechfeld genannt. Mitten in dieser Ebene liegt der weithin berühmte Wallfahrtsort Lechfeld mit einem Franziskaner-Kloster. Der Ort wie das Kloster verdanken ihren Ursprung der Wallfahrt.
Hier baute zuerst die Besitzerin des von da eine kleine halbe Stunde entfernten Schlosses und Landgutes Regina von Imhof, geborene Pemlin, Witwe des Friedrich Raymund von Imhof, Bürgermeisters von Augsburg, im Jahr 1603 eine Kapelle in einem Stil ähnlich jenem des Pantheons zu Rom, welches fünfundzwanzig Jahre vor Christi Geburt von Marcus Agrippa zu Ehren aller heidnischen Götter erbaut, vom Papst Bonifazius IV. dem Heiligen, aber im Jahre Christi 610 zu Ehren der seligsten Jungfrau Maria und aller Heiligen eingeweiht wurde. Einst verirrte sich diese Frau auf einer Rückreise von Augsburg nach Untermeitingen im nächtlichen Nebel und versprach, wenn sie den Weg nach ihrem Schloss wiederfinden würde, eine Kapelle zu erbauen. Nach langer Angst und inbrünstigem Gebet sah sie auf einmal aus der Ferne die Lichter ihres Schlosses. Hierüber sehr erfreut befahl sie ihrem Kutscher auf dieser Stelle als ein Zeichen seine Peitsche in die Erde zu stecken, und fuhr dann frohen Mutes in ihr Schloss zurück. Dies ist die Veranlassung zum Bau der Kapelle.
Den 9. April 1603 wurde der Grundstein gelegt und der Bau noch in dem Jahr vollendet. Von Papst Clemens VIII. und Alexander VII. wurde die Wallfahrtskapelle mit besonderen Ablässen begabt, von Ersterem schon im Jahr 1603 und dem Zweiten im Jahr 1659. Alsbald erwachte im Volk das Vertrauen zu Maria in dieser Kapelle. Es blieb aber auch nichts unbelohnt. Die Stifterin ließ daher, um das geistige Bedürfnis der Wallfahrer zu befriedigen, nahe der Kapelle ein Gebäude errichten, in dem mehrere Kapläne wohnen konnten. Diese versahen nun alle priesterlichen Verrichtungen in dem Kirchlein.
Immer mehr und mehr nahm die Zahl der Wallfahrer zu, deren geistliche Bedürfnisse von den hierher berufenen Patern Franziskanern befriedigt wurden, bis im Jahr 1803 das Kloster aufgehoben wurde. Da im Jahr 1827 König Ludwig I. in Bayern wieder mehrere Klöster des Franziskaner-Ordens herstellte, wurde auch das Kloster Lechfeld wiederhergestellt und den 1. August 1830 feierlich eröffnet. Unter dem Fürstbischof Alexander Sigismund von Augsburg wurde auf dem freien Platz vor der Wallfahrtskirche ein Kalvarienberg errichtet, dessen Bau im Jahr 1718 begann und 1719 vollendet wurde. Im Verlauf von mehr als einhundertdreißig Jahren wurden die Kapellen und Figuren durch die Witterung sehr schadhaft, so dass man sich genötigt sah, einen neuen Kreuzweg zu errichten. Binnen anderthalb Jahren war der herrliche Neubau vollendet, und am 4. Oktober 1853, als am Fest des heiligen Ordensstifters Franziskus Seraphikus, erhielt dieser Kreuzweg die kirchliche Weihe in sehr feierlicher Weise unter dem Zudrang einer äußerst zahlreichen Volksmenge.
(Aus: „Marianischer Festkalender“, Regensburg 1866)
________________________________________________________________________

117. Die St. Marienkirche zu Limbach in Unterfranken
Auf einer freundlichen Anhöhe am linken Ufer des Mains, eine Viertelstunde nördlich vom Pfarrdorf Limbach erhebt sich die schöne St. Marien-Kirche.
Schon in uralter Zeit stand daselbst eine Feld-Kapelle mit einem Muttergottesbild, vor dem Gläubige ihre Andacht verrichteten, und wohin Bedrängte in verschiedenen Anliegen und Nöten ihre Zuflucht nahmen, um die Fürbitte der göttlichen Mutter zu erlangen, wodurch die jetzige Wallfahrt entstand. Im 16. Jahrhundert geriet die Wallfahrt in Verfall: die Kapelle wurde baufällig. Dazu kam noch, dass der ganze Ort Limbach sowie das eine halbe Stunde unterhalb gelegene Dorf Sand die protestantische Glaubenslehre annahm. Im Jahr 1630 kehrte das Dorf wieder zur katholischen Kirche zurück. Im Jahr 1660 gab der Fürstbischof die Bewilligung zu einer Sammlung freiwilliger Beiträge: „eine liebreiche Beisteuer zu sammeln, die vergessene Wallfahrt wieder in Aufnahme zu bringen.“ Allein diese Erlaubnis hatte nicht den erwünschten Erfolg. Da bei der Baufälligkeit der Kapelle das Bedürfnis der Erbauung einer neuen Kirche längst obwaltete, gedachte man wohl, sie im Dorf selbst aufzuführen, allein man zog es doch vor, sie auf ihrem bisherigen, sehr beliebten und freundlichen Platz beizubehalten. Von alten Leuten im Ort ist die Sage zu vernehmen: „Man habe Vorboten gehabt, dass Maria in der dortigen Kapelle besonders wolle verehrt werden. Wie da eine Kapelle hätte erbaut werden sollen, habe man die nötigen Baumaterialien nahe an das Dörflein geführt, damit die Einwohner ein Kirchlein in dem Ort hätten, allein, was sie den Tag hindurch an den abgesteckten Ort brachten, das sei des anderen Tags an dem Ort, wo jetzt die Wallfahrtskirche steht, gelegen.“
Im Jahr 1664 wurde die Kapelle während der damaligen Kriegsunruhen beraubt, das Gnadenbild blieb vernachlässigt und wurde vom Hochaltar entfernt, und in der Sakristei aufbewahrt, bis sich endlich nach langer Zeit ein Wohltäter fand, der es infolge gemachten Gelübdes aus der Sakristei von Bamberg abholen, neu fassen und so nach Eltmann zurückbringen ließ, von wo es im Jahr 1699 Pfarrer Ehlen in einer feierlichen Prozession nach Limbach geleitete und wieder auf den Hochaltar versetzte. Das Gnadenbild ist aus Holz geschnitzt. Über dem Haupt der göttlichen Mutter, die das Jesuskind auf dem linken Arm trägt, schweben zwei Engel, die die Krone halten.
Nach einiger Zeit kam durch nachstehendes Ereignis die Wallfahrt zur Marien-Kapelle ungemein schnell in Aufnahme. „Im Jahr 1727 bekam die Hirtin Katharina Schwalvinger zu Limbach, nachdem sie von einer schweren hitzigen Krankheit glücklich genesen war, ein großes Übel (starken Fluss) in den Augen, so dass sie in Ängsten war, in Gefahr zu sein, des Augenlichtes beraubt, ihr Brot von Tür zu Tür suchen zu müssen. Da kam ihr zur Nacht im Traum vor: unten am Kapellenhügel oder „Höhlein“ befinde sich ein Wasser in einem durch Ochsentritte veranlassten Grübchen, und mit diesem solle sie ihre Augen waschen, so würde sie von ihrer Augenkrankheit befreit werden. Die arme leidende Frau ließ sich an die bezeichnete Stelle bringen, fand wirklich Wasser, wusch sich damit ihre Augen und war geheilt.“ Der Ort, wo dieses Wasser zum Vorschein kam, liegt an der Landstraße ungefähr neunzig Schritte von der Wallfahrtskirche. Man hat hierauf dem Wasser in einem Umkreis von etwa sechzehn bis zwanzig Schuh nachgegraben, aber keine Quelle, sondern gegen die Kirche zu nur einen feuchten Sand entdeckt. Die Hirtin voll Freude über ihre wunderbare Heilung machte dieses Ereignis ruchbar und bald kam eine Menge Blinder, Lahmer und mit allerlei Gebrechen Behafteter herbei und der Ort, wo das Wasser ein wenig hervorbrach, war mit Kranken und Presshaften, die Hilfe erwarteten, umlagert wie der Schwemmteich zu Jerusalem. Dieses Wasser hat nebst andern die Eigenschaft, dass, wenn es in einem reinen und verschlossenen Geschirr aufbehalten wird, in vielen Jahren keine Fäulnis und üblen Geruch an sich nimmt.
Bei dem stets zunehmenden Zudrang der Gläubigen zu dem Gnadenort trat die Wallfahrt bald in ihre Glanzperiode. Wegen großer Vermehrung der gottesdienstlichen Verrichtungen in der Wallfahrtskirche wurde Limbach zur eigenen Pfarrei erhoben. Fürstbischof Friedrich Karl von Würzburg war ein vorzüglicher Wohltäter der Kirche zu Limbach, und vermachte auch für den Bau der Pfarr- und Wallfahrtskirche zwölftausend Gulden. Im Jahr 1751 wurde zu dem Bau der neuen Kirche geschritten. Am 7. September 1755 wurde die neue Kirche vom Fürstbischof von Würzburg, Adam Friedrich Grafen von Seinsheim mit größter Feierlichkeit eingeweiht. Die Kirche erfreut sich fortwährend eines zahlreichen Besuches von Wallfahrern. Das Hauptfest wird am Sonntag nach Ostern gefeiert.
wallfahrt.bistum-wuerzburg.de/wallfahrtsorte/maria-limbach
(Aus: Marianischer Festkalender, Regensburg 1866)
________________________________________________________________________




118. Unsere Liebe Frau zu Schnals in Südtirol
(Aus: Marianischer Festkalender, Regensburg 1866)
Im Pfarrdorf Schnals, das in einem Seitental des Untervintschgaues liegt, stand schon um das Jahr 1303 an der Stelle, wo sich jetzt die Pfarrkirche befindet, eine Kapelle unserer Lieben Frau mit einem wunderbaren Gnadenbild. Eine alte Überlieferung erzählt die Entstehung dieses Gnadenortes also:
Zwei Pilgrime kamen einst in das Tal. Einsam auf einem Hügel betend, bemerkten sie unweit von sich in der dunklen Waldung eine ungewöhnliche Helle. Heiliger Schauer ergriff die Betenden. Wie von einer unsichtbaren Macht angezogen, näherten sie sich ehrfurchtsvoll der Stelle, und siehe, ein zierlich aus Holz geschnitztes Bild, das Maria mit dem Jesuskind, auf einem Baumstock sitzend, vorstellte, leuchtete ihren erstaunten Blicken entgegen. Voll heiligen Entzückens eilten sie in die nächsten Bauernhöfe über den gefundenen Schatz Kunde zu geben. Kaum erscholl die frohe Botschaft, als Jung und Alt in den Wald zum Wunderbild lief. Man trug es in die nächste Hütte herab, aber bald war es aus dem unlieben Ort an die alte Stelle verschwunden. Als sich diese Erscheinung öfters wiederholte, entschloss man sich, der Himmelskönigin eine geziemende Wohnung in der Tiefe des Tales zu bauen, jedoch vergebens. Der Bau konnte aller Anstrengung ungeachtet nicht vor sich gehen, und als die hartnäckigen Bauern sich durchaus nicht von ihrem Plan abbringen lassen wollten, so nötigten sie wiederholte Unglücksfälle, dem Wink des Himmels und den Vögeln zu folgen, die die vom Blut der verunglückten Arbeiter geröteten Hobelspäne auf den Hügel emportrugen. So entstand die ebengenannte, vielbesuchte Kapelle.
Nicht lange blieb das Heiligtum allein. Der Wald wurde gelichtet, fromme Landbewohner siedelten sich an, die sich vertraulich der Gottesmutter nahten, und unter ihrem Schutz in kurzer Zeit zu einer Gemeinde heranwuchsen, die von der Kapelle den Namen zu „Unserer Lieben Frau“ annahm.
Schon im Jahr 1361 wurde daselbst ein Priester angestellt, ein Prämonstratensermönch aus dem Stift Steingaden in Bayern, abhängig von dem Pfarrer in Tschars. Die Pfarre Tschars gehörte damals diesem bayerischen Stift und so wurde auch der Gnadenort Schnals in Bayern bekannt. Im Jahr 1746 wurde die alte Kapelle abgebrochen und die jetzige Kirche erbaut. Das Hauptfest wird am Tag der Himmelfahrt Mariä gefeiert und viele andächtige Pilger aus den benachbarten Tälern finden sich dabei ein.
________________________________________________________________________

119. Mariahilfberg bei Neumarkt in der Oberpfalz
In der Nähe der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz erhebt sich der Mariahilfberg vom Volk auch Kalvarienberg genannt. Diese Bergeshöhe ist gekrönt mit dem Kirchlein Mariahilf.
Auf dem Mariahilfberg wurden anfangs von den frommen Vätern Kapuzinern im Jahr 1684 drei große Kreuze aufgestellt, weswegen der Berg auch Kalvarienberg genannt wird. Dabei stand eine Klause für einen Einsiedler und in den darauffolgenden Jahren wurden die fünf Kapellen, unter ihnen die Grabkapelle, nach dem Muster des heiligen Grabes zu Jerusalem errichtet. Als aber die Väter Kapuziner im Jahr 1687 vom Kurfürsten Max Emanuel von Bayern ein Muttergottesbild geschenkt erhielten, so erbauten sie auf dem Berg eine hölzerne Marienkapelle, und stellten darin dieses Gnadenbild zur öffentlichen Verehrung auf. Fromme Wallfahrer kamen gezogen auf die Höhe des Gnadenberges und legten ihre Opferspenden auf den Altar der ärmlichen Kapelle. Auf ein feierliches Gelübde hin, das die Bewohner Neumarkts während der Schrecknisse einer verheerenden Seuche getan hatten, machte man sich endlich, unterstützt von den reichlich anfallenden Opfergaben, im Jahr 1718 daran, der seligsten Jungfrau zu Ehren das schöne liebliche Kirchlein zu bauen, das jetzt die Höhe des Berges krönt und so freundlich in die Talebene niederblickt. Am 14. Juli genannten Jahres wurde der Grundstein gelegt, und die Kirche schon den 11. Februar 1722 benediziert, das vom Kurfürsten Max Emanuel geschenkte Gnadenbild aus der hölzernen Kapelle in die neuerbaute Kirche feierlichst übertragen und die erste heilige Messe darin gelesen. Der Bau der Kirche wurde jedoch erst 1727 vollendet. Im Jahr 1755 wurden die neuen Altäre der Kirche errichtet. Im Jahr 1822 wurde die hundertjährige Jubelfeier der Kirche acht Tage hindurch festlich begangen. Unheildrohend dem Kirchlein wurde der Abend des 25. Septembers 1841. Bei einem heftigen Gewitter schlug der Blitz in seinen Turm und zündete. Der Turm brannte ab und die Glocken zerschmolzen, die Kirche selbst wurde fast wunderbarer Weise und durch die aufopfernde Tätigkeit der Bürger Neumarkts gerettet. Eben dieser fromme christliche Sinn der städtischen Einwohner für ihr Heiligtum auf dem Berg, unterstützt von den Nachbargemeinden, ermöglichte es, dass schon wieder am 7. September 1843 neue Glocken mit lauten Zungen vom neuerbauten Turm in die Talebene niederriefen. Im Jahr 1847 wurde der Pfad auf die Höhe des Berges mit den Leidensstationen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus geschmückt. Endlich im Jahr 1854 am 27. August wurde die Kirche von dem hochwürdigsten Herrn Bischof Georg von Oettl von Eichstätt feierlich konsekriert und dieses Fest der Kirchweihe acht Tage hindurch mit religiöser Andacht gefeiert. Das traute, wahrhaft freundliche Kirchlein in seiner herrlichen Lage, ist aber auch ein anziehender Lieblingsplatz für die Andacht der unten hausenden Bewohner. Darum ziehen sie mehrmals des Jahres (abgesehen von den äußerst zahlreichen Privat-Wallfahrten) am Bittsonntag, am Fest Mariä Verkündigung, als am Titularfest der Kirche, am Kirchweihfest, am Erntedankfest, und besonders während des marianischen Dreißigers (vom 15. August bis 14. September) teils in feierlichen Prozessionszügen, teils in zahlreichen Scharen die Bergeshöhe hinan zu ihrem Heiligtum, zum lieblichen Kirchlein Mariahilf.
(Aus: Marianischer Festkalender, Regensburg 1866)
_______________________________________________________________________

120. Unsere Liebe Frau von Sasvár, deutsch:
Maria Schlossberg,
Basilika der Sieben Schmerzen Unserer Lieben Frau
Einer der berühmtesten Gnadenorte in Ungarn ist Sasvár, Schlossberg in Ungarn, im Erzbistum Gran. Das aus weichem Holz geschnitzte Gnadenbild der schmerzhaften Mutter Gottes verdankt seine Entstehung der frommen Gräfin Angelika Czobar, der Tochter des berühmten Kriegshelden Paul Bakitze. – Sie fuhr im Jahr 1564 eines Tages in einem Wagen mit ihrem dem Jähzorn sehr ergebenen Gemahl. Wegen eines kleinen Wortwechsels warf er sie plötzlich aus dem Wagen. Da machte die fromme Gräfin das Gelübde, wenn die Gottesmutter durch ihre Fürbitte das Gemüt ihres Gemahls besänftigen würde, so wolle sie ihr zu Ehren ein Bild fertigen und zur Verehrung aufstellen lassen. Ihre Bitte fand Erhörung: Sie wurde fortan mit einer glücklichen und friedlichen Ehe gesegnet. Alsbald ließ sie ein Bildnis der schmerzhaften Mutter Gottes mit dem Leichnam ihres Sohnes auf dem Schoß aus Holz schnitzen und ließ es auf eine dreieckige Säule, gerade an dem Ort, wo sie das Gelübde machte, neben dem Sassiner Schloss setzen. In den späteren stürmischen Zeiten ließ die Familie Czobar das Gnadenbild in die Schlosskapelle bringen. Sobald es aber wieder still geworden war im Land, setzte man auch die allgeliebte Statue wieder an ihre alte Stelle.
Es geschah indessen, dass der Verwalter der Herrschaft, indem er den Fasangarten vergrößerte, auch die Säule, worauf das Bild stand, in den Zaum mit einschloss, so dass die Gläubigen das geheiligte Bild nur mehr von der Ferne verehren konnten. Allein trotz der Ferne setzten sie ihre Andacht fort. Das Jahr 1732 ist besonders merkwürdig. Die Verehrer der Gottesmutter wollten nämlich nicht länger dulden, von der Bildsäule durch einen Zaun getrennt zu sein. Als nun am 16. Mai die Prozession wie gewöhnlich über die Miavanerbrücke zur Statue des heiligen Johannes von Nepomuk ging, erbrachen die Fahnenträger auf allgemeines Verlangen die Umzäunung und die ganze Menge strömte unter Freudenrufen und Gesängen zum Bild der heiligen Jungfrau. Im genannten Jahr 1732 drang die Nachricht von diesem wundertätigen Bild auch zu den Ohren des Erzbischofs von Gran, Emerich Esterhazy. Dieser ließ die außerordentlichen Wunder, die sich bei dem heiligen Bild ereigneten, einer Prüfung unterziehen, das Bild aber bis zur Entscheidung in der Loretaner-Kapelle neben der Pfarrkirche verwahren und von Bewaffneten bewachen, so dass in die Kapelle niemand hineingehen konnte. Den Bericht der Prüfungskommission unterzog der Fürstprimas einer sorgfältigen Prüfung.
Am 9. November 1732, dem Tag der Übertragung des heiligen Bildes, bedeckten über 25.000 Pilger den weiten Platz vor dem Sassiner Schloss. Bischof Graf Esterhazy erhob das Bild aus der Loretaner-Kapelle, die Pfarrer trugen es auf ihren Schultern und unter Freudentränen wurde das Bild zu seinem früheren Ort geleitet, an dem dann der Gottesdienst in feierlicher Weise verrichtet wurde.
Im folgenden Jahr übernahmen die Paulaner die Seelsorge, und ihr erster Gedanke war die Erbauung eines neuen würdigen Gotteshauses, das denn auch im Jahr 1764 vollendet dastand. Mit der Feier der Einweihung verband man zugleich die des zweiten Jubiläums und sie fand am 15. Oktober mit außerordentlicher Pracht und unter großem Zudrang des Volkes statt. Das Bildnis wurde in Gegenwart des Kaisers und der Kaiserin in die neue Kirche übertragen, die Joseph II. zur Pfarrkirche erhob, nachdem er die Paulaner 1786 aufgehoben hatte. Maria Schlossberg gehört noch immer zu den berühmtesten Wallfahrtsorten Ungarns.
________________________________________________________________________
 Marianisches
Marianisches






















