Geschichten des Lebens aus alter Zeit 3. Teil
1. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern - Erzählt von Johannes Buse
2. Maria, Zuflucht der Sünder
3. Wähle recht! - Von F. Clute-Simon
4. Eine edle Königin
5. Madame, mein Sohn ist Präfekt! - Von N. Pontis
6. Probatum est! - Ein Traum, der Wirklichkeit ist
7. Seht meine Hände - Von Pierre l`Ermite
8. Die Zahl "Dreizehn" - Nach einer Tatsache von Paul Lucas
9. Der Geist der Stärke - Von Ernst Schultheiß
10. Die Söhne des Rosenkreuzers - Nach den Aufzeichnungen eines Seminaristen von R. Pontis
11. Das Wunder von Bolsena - Von Stephardt
12. Ein treuer Hirte
13. Bei dem "Heiligen" in Padua - Von Erhardt Krafft
14. Gerettet - Von Ernst Schultheiß
15. Die Bitte ans heiligste Herz Jesu - Von Erhardt Krafft
16. Ein Apfel (Eine Legende) - Von Stephardt
17. Die Geschichte eines Mönches, eines Königs und eines Revolutionärs - Nach Ségur von T. Carbonaro
18. Der alte Brief - Von Hermann Weber
19. Der Lohn des Opfers - Von Silesia
20. Nehmt mich zum Vorbild! - Von Franz Clute-Simon
21. Bruderliebe - Von Elsbeth Düker
22. Das Pünktchen
23. Wohlzutun ist Christenpflicht - Von Georg Bleibetreu
24. In heimatlicher Erde - Von Joseph Grabenschröer
25. Der Irre von Buchental - Erzählung aus der Zeit des Bauernkrieges von Johannes Buse
26. Seltsame Wege - Von Margarete Cochet
27. Wilhelm Achtermann, ein deutscher Künstler und Verehrer Mariens
28. Unsere Liebe Frau in der Rosengirlande - Von H. Verus
29. Seine Barmherzigkeit währt ewig!
30. Verirrt, verunglückt und zweimal gerettet - Von Rudolf Grein
________________________________________________________________________

1. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern - Erzählung von Johannes Buse
1.
Das Abendessen war beendet. Nachdem das Dankgebet gesprochen war, verließen die Knechte das Zimmer, während die Mägde mit dem Abräumen des langen Eichentisches begannen, der von alters her auf dem Erlenhof als gemeinsame Speisetafel gegolten hatte.
Bastian Danner, der Hofherr, saß noch immer auf seinem Vorzugsplatz am oberen Ende des Tisches, just unter dem alten Kreuzbild; gedankenvoll vor sich hinstarrend, trommelte er mit der Rechten auf der weißen Tischplatte, nur ab und zu warf er einen kurzen Blick zu seinem Sohn hinüber, der sich auf der Ofenbank niedergelassen hatte und nun gerade mit dem Stopfen seiner kurzen silberbeschlagenen Pfeife beschäftigt war.
"Franz", begann der alte Danner plötzlich, als die Mägde das Geschirr in die Küche getragen hatten und er sich mit seinem Sohn allein sah, "kannst dich noch einmal hier an den Tisch setzen, habe ein Wort mit dir zu sprechen."
"Das kann geschehen, Vater", antwortete der Sohn überrascht. Dann fuhr er in gedämpften Ton fort: "Drei Jahres sind es nun, seit die Mutter gestorben ist, und drei Jahre haben wir uns mit fremden Frauleuten geholfen, da denke ich, es wäre an der Zeit, wenn wieder eine Bäuerin auf den Erlenhof käme, die überall nach dem Rechten sähe und die Mägde ordentlich unter Aufsicht nähme."
"Recht wäre es schon, Vater", warf Franz ohne aufzusehen dazwischen.
"Na also. Alt genug bist du ja auch, eine Frau heimzuführen, bist ja im Achtundzwanzigsten. Darum sobald wie möglich ein Ende mit der jetzigen Wirtschaft gemacht. - Hast dich doch sicher auch schon umgesehen - oder nicht? - - Ich weiß bestimmt, die Therese vom Waldhof wartet nur auf deine Frage, und der alte Bergschulze sagte mir noch heute morgen: er sähe seine Anna am liebsten als Bäuerin auf dem Erlenhof. - Beide Mädchen sind gute Partien; du brauchst also nur zu wählen."
Fragend blickte der alte Danner seinen Sohn an, der sinnend mit niedergeschlagenen Augen dasaß, verlegen mit dem Pflöckchen seiner Pfeife spielend.
"Nun, was meinst du zu der Sache?" kam es nach einem Weilchen ungeduldig aus des Vaters Mund.
"Das dem Hof eine ordentliche Bäuerin nottut, weiß ich gerade so gut, als du, Vater", entgegnete der Gefragte endlich, "aber zu der Wahl, wozu du mir rätst, kann ich mich nicht entschließen."
"Nicht?" fragte nun der Vater staunend, "was hättest du denn an ihnen auszusetzen?"
"Gewiss, Vater, die beiden Mädchen haben Vermögen, sind nach deiner Ansicht eine gute Partie. Aber dennoch möchte ich mich nicht an eine von beiden ketten. Das Geld tut es nicht allein. Im übrigen denke ich, wäre es gar nicht nötig, dass eine reiche Bäuerin auf den Erlenhof kommt. Ich meine, die Hauptsache wäre, wenn sie fromm, fleißig und umsichtig wäre; das meine ich, wäre das beste Heiratsgut."
Mit hochrotem Gesicht saß Franz da, wenngleich er es vermied, zu dem strengen Vater aufzublicken.
"Das sind ja nette Ansichten, die du da hast", polterte Danner nun rau und laut heraus. "Man sollte bald glauben, du hättest schon eine andere in Aussicht."
"Glaube es ruhig, Vater", antwortete Franz fest und bestimmt, "denn ich habe auch schon meine Wahl getroffen. - Ich hätte es dir schon eher gesagt, doch ich scheute vor dem Geständnis; da du nun aber selbst die Angelegenheit zur Sprache gebracht hast, ist es jetzt die rechte Zeit, dir darüber Auskunft zu geben."
"Nun, da bin ich wirklich neugierig."
"Ich weiß es, Vater", fuhr Franz ruhig fort, "dass die von mir Erwählte nach deiner Ansicht nicht als gute Partie zu betrachten ist, und dennoch ziehe ich sie der Therese vom Waldhof wie auch Bergschulzen Anna vor."
"Nun, wen meinst du denn eigentlich?" fragte Danner, aufs äußerste gespannt.
"Die Maria Neder."
Grimmig ballten sich die Fäuste des Bauern und mit vorgebeugtem Körper blickte er seinem Sohn starr und drohend ins Gesicht. "Die Neder?"
"Ja, Vater, die Maria Neder. - An ihrem Charakter wirst du auch nicht das geringste mäkeln können. - Dass sie kein Vermögen besitzt, fällt bei mir . . . ."
"Nun ist es genug, Bursche", schrie Danner hochrot vor Zorn, im Aufspringen den Stuhl mit lautem Krachen zu Boden stoßend.
Auch Franz war aufgesprungen, doch ruhig und gefasst stand er seinem Vater gegenüber. Nur leise murmelten seine Lippen: "Dachte ich es mir doch."
"Dass du mir nicht den Namen nennst. Solange ich lebe, kommt mir so eine Mamsell Habenichts nicht auf den Hof." Dröhnend fiel die geballte Faust des Bauern auf den Tisch. "Das könnte so einer Jungfer recht sein, ins volle Nest auf den Erlenhof zu schlüpfen, auf dem sie früher als Kleinmagd diente. - Herrgott, so etwas! - Das könnte mir passen, so eine Betteldirn als Bäuerin auf dem Erlenhof, dem schönsten Hof in der Runde."
"Halt, Vater, nun aber nicht weiter", mahnte Franz mit bebender Stimme, die Rechte wie zur Abwehr erhoben. "Ob du meine Braut als Schwiegertochter anerkennst, darüber kann ich dir keine Vorschriften machen, aber beschimpfen lasse ich sie nicht, denn unantastbar steht sie da. Beschimpfst du sie, so beschimpfst du auch mich, und das lasse ich mir nicht gefallen."
"Ist das der Gehorsam, den du mir als Sohn schuldest?"
"Ich habe dir nie den Gehorsam verweigert, Vater, aber in diesem Fall muss ich es, denn es handelt sich um das Glück zweier Menschen, das sich nicht mit Geld erkaufen lässt. Mein Gewissen heißt meine Wahl gut, darum . . . ."
"Kein Wort mehr oder ich vergesse mich. - Willst du die Dirne heiraten, tu es, zwingen kann ich dich nicht, aber solange ich lebe, betretet ihr mir nicht den Erlenhof."
Mit finsterem Gesicht verließ der alte Danner das Zimmer, die Tür dröhnend hinter sich ins Schloss werfend.
Aufs äußerste erregt, suchte Franz doch jede empörende Bewegung seiner menschlichen Natur zu unterdrücken. Hätte ihm ein anderer diese Worte ins Gesicht geschleudert, er hätte schnelle Abrechnung mit ihm gehalten, nun aber war es sein Vater, der ihn und seine Braut beschimpft, und welche Ehrfurcht, welchen Gehorsam er ihm schuldete, hatte er nie vergessen. Es war dieses das erste Mal in seinem Leben, dass er dem Vater den Gehorsam versagte, aber sein Gewissen beschuldigte ihn nicht. Der Geiz und die Habsucht des alten Danner waren ja bekannt, deshalb hatte er auch stets gezögert, mit dem Vater über seine Wahl zu sprechen, denn er wusste ja, dass er nur auf Geld und Reichtum sah. Wenn die gute Mutter noch gelebt hätte! Der wäre die Maria Neder schon ohne Geld und Gut recht gewesen, denn schon zu der Zeit, als sie als Magd auf dem Erlenhof diente, hatte sie durch ihr stilles, bescheidenes und frommes Wesen der Mutter Zuneigung voll und ganz errungen. An der Mutter hätte Franz eine gute Fürsprecherin gehabt. Nun aber ruhte sie schon auf dem stillen Friedhof, und so sah der Sohn nur zu klar ein, dass der Streit, der infolge seiner Wahl zwischen dem alten Vater und ihm entfesselt war, nur von ihm allein ausgetragen werden musste.
2.
Fast zehn Jahre waren vergangen. Franz Danner hatte die Maria Neder vom Altar heimgeführt, jedoch nicht zum Erlenhof, sondern in ein zu jener Zeit leerstehendes Haus eines Nachbardörfchens. Bescheiden hatten sie sich eingerichtet, über große Geldmittel verfügten ja beide nicht, aber glücklich fühlten sie sich in ihrem am Waldessaum, dicht an der Landstraße gelegenen Heim. Und als der Himmel im Lauf der Zeit den jungen Leuten einige Kinderchen schenkte, da fühlten sich die beiden erst recht glücklich, so glücklich, dass sie gar kein Verlangen nach dem großen Erlenhof trugen. Als fleißiger Tagewerker war Franz bei den Bauern des Dorfes bekannt und beliebt, und wenn sein Verdienst auch nicht zuließ, viele Spargroschen auf die Seite zu legen, so war er doch noch ausgiebig genug, Frau und Kinder vor Not zu schützen.
Und doch sollte auch in dieses Heim einmal die finstere Not Einzug halten.
Es war ein äußerst rauer und nasser Herbst gewesen. Unermüdlich war Franz seinen Arbeiten nachgegangen, mutig bot er der Nässe und Kälte Trotz, aber endlich musste sein Körper den schädlichen Witterungseinflüssen unterliegen. Eine schmerzhafte Krankheit warf ihn aufs Lager, das er vorerst nicht wieder verlassen sollte. Der Arzt kam häufig und ließ sich bezahlen aus den Spargeldern, die die jungen Leute in den ersten Jahren ihrer Ehe erübrigt hatten. Bald waren die Notpfennige aufgezehrt, allein die Ausgaben waren noch täglich dieselben. Und nun trat die Not grinsend in das kleine Haus, des Mannes Schmerzen vermehrend und den Augen der braven Frau Tränen erpressend. Dann kamen Augenblicke, wo Franz an den Wohlstand seines Vaters dachte, der nun ohne Kinder mit Knechten und Mägden auf dem Erlenhof waltete. Nur ein Bruchteil von dem Vermögen hätte genügt, die Sorge und Not wieder aus ihrem Heim zu verscheuchen.
Wieder lag Franz in solchem Sinnen auf seinem Lager, als seine Frau das Krankenzimmer betrat.
"Höre einmal, Maria, was ich schon gedacht habe", redete er sie an.
Langsam ließ sie sich auf den Stuhl gleiten. "Nun, Franz?"
"Wie lange meine Krankheit noch dauern soll, weiß Gott. Ich würde sie schon ruhiger ertragen, wenn die Sorge um dich und die Kinder nicht dabei wären . . ."
"Aber Franz, wozu solche Gedanken" suchte ihn die Frau zu beruhigen.
"Unterbrich mich nicht, Maria", fuhr er fort. "Unsere Notpfennige sind aufgezehrt. Not und Armut sind bei uns eingezogen, während mein Vater im Wohlstand lebt. Ob es recht von ihm war, mich von sich zu stoßen, darüber will ich nicht richten, er ist aber streng und hart, vielleicht würde er jetzt seine Hand hilfsbereit öffnen. - Ich kann nicht zu ihm gehen - da dachte ich, wenn du mal . . ."
"Nach dem Erlenhof gingest, meinst du? - Ich will es tun, dir zuliebe", antwortete sie fest, indem sie sich erhob. - "Aber es ist ein großes Opfer", raunte sie leise vor sich hin.
Heulend fuhr der Wind um die langgestreckten Gebäulichkeiten des Erlenhofes, scharfe Eiskristalle mit sich führend und klirrend an die Fensterscheiben werfend. Mit finsterem Gesicht saß der alte Danner in seinem alten Lehnstuhl am Ofen, gedankenvoll in das unwirtliche Treiben hinausblickend. Nicht spurlos waren die letzten zehn Jahre an ihm vorübergegangen: völlig ergraut waren die Haare seines Hauptes und tiefe Furchen hatten sich in das Gesicht eingegraben, aber der düstere Stolz und Trotz, die aus diesen grauen Augen blickten, waren noch dieselben, wie früher.
Da riss ihn ein leises, zaghaftes Klopfen an der Tür aus seinem Sinnen auf.
"Herein!" rif er mit fester, voller Stimme.
Sichtlich befangen betrat eine Frau das Zimmer, deren gerötete Augenlider von vergossenen Tränen zeugten.
Nur einen Blick warf der alte Danner auf die Gestalt, dann sprang er von seinem Sitz auf. "Bist du nicht die Neder?" rau und frostig wie das Wetter klang seine Stimme.
"Früher war ich es, Danner. Seit zehn Jahren bin ich Eures Sohnes Frau." Mit zitternder Stirn hatte die Frau dem Mann Antwort gegeben.
"Was willst du auf dem Erlenhof?"
"Euch benachrichtigen, Danner, von der schon seit Wochen dauernden Krankheit Eures Sohnes. - Auf seinen Wunsch bin ich hierhergegangen, um - - um -" die Worte erstarben der Frau fast auf den Lippen - "Euch die Hand zur Versöhnung zu reichen."
Mit einer stolzen, kalten Gebärde wies der Alte die Nähertretende von sich.
"Ich bitte Euch, Danner", flehte die Frau mit aufgehobenen Händen, "lasst allen Groll fahren. Tut es Eures Sohnes halber, dessen Familie infolge seiner Krankheit mit der Not ringt."
"Genug!" schnitt Danner mit rauem Wort jede weitere Rede ab. "Für Bettler ist der alte Danner nicht zu sprechen. - Was der Bube gesät hat, mag er nun auch ernten. - Dort ist die Tür!"
"Kennt Ihr wirklich kein Erbarmen? . . ."
Wieder hob sich die Rechte gebieterisch. "Dort ist die Tür!"
"Möge Gott Euch barmherzig sein!"
Schnell huschte die Frau aus der Stube wieder hinaus in das winterliche Treiben. Aber sie achtete nicht darauf, denn ihr Herz blutete ob der lieblosen Behandlung seitens des alten Danner, und unaufhörlich rannen ihr die Tränen über die Wangen.
Hangend und bangend sah Franz der Heimkehr seiner Frau entgegen. Schon drei Mal hatte er im Gebet die Perlen seines Rosenkranzes durch die Finger gleiten lassen, nun endlich war sie heimgekehrt. Niedergeschlagen trat sie nun in das Krankenzimmer.
"Nun, Maria?" fragte er, groß zu ihr aufblickend.
"Beruhige dich, Franz", antwortete sie, sich über ihn beugend, "einer verlässt uns nicht: Gott im Himmel!"
Und die Tränen der Frau einten sich mit denen des Mannes.
3.
Es war an einem Abend im März. Dichte Wolkenballen trieb der Wind vor sich her, und nur von Zeit zu Zeit war es dem Mond vergönnt, einen Strahl seines Lichtes auf die düstere Erde zu werfen.
In leichtem Trab kam von der Stadt her ein Fuhrwerk die Landstraße entlang. Mit sicherer Hand lenkte der Führer den Wagen durch den düsteren Wald.
Klatschend flog die Peitsche über den Rücken des Pferdes. "Nun, Fuchs, greif aus", brummte der Wagenführer, "dass wir an der Hütte vorbeikommen, wo der Bube mit der Betteldirne haust."
Und pfeilgeschwind flog das Tier dahin. Plötzlich aber scheute es; im wilden Galopp riss es den Wagen im Zickzack mit sich fort. Kreidebleich hielt der Führer die Zügel in der Hand, die vorbeisausenden Bäume entgingen seinem Auge, dann ein Krach, ein Schrei - an einem Baum war das Gefährt zerschmettert, wo er nun stöhnend und winselnd lag, in nächster Nähe der Hütte, deren Anblick er meiden wollte. Die Trümmer der Deichsel nachschleppend, rannte das Pferd dem Dorf zu.
Hatte auf dem Waldweg auch niemand den Angstschrei des alten Danner vernommen, in dem kleinen Haus hatte man den Ruf gehört - man wusste: es war ein Unglück geschehen.
Franz war von seiner Krankheit wieder so weit hergestellt, dass er sich wieder im Umhergehen bewegen konnte. Lesend hat er am Tisch gesessen, als der Angstschrei des Verunglückten in das Zimmer gedrungen war.
"Bastian, mach schnell die Laterne zurecht, es wird jemand unsere Hilfe nötig haben", wendete er sich an seinen Sohn, der, mit Schularbeiten beschäftigt, ihm gegenübersaß.
Eilig kam der Knabe dem Befehl des Vaters nach. Im nächsten Augenblick trat der Knabe, die Laterne in der Hand, in die Dunkelheit, gefolgt von den hilfsbereiten Eltern. - Da lagen die Trümmer des Wagens und dort in einer Grube am Rand des Weges erblickten sie im dämmernden Schein der Laterne den Verunglückten auf dem Gesicht liegend. Schnell stiegen die drei zu dem Mann hinab, der ohne Lebenszeichen dalag.
Behutsam versucht man dem Körper eine andere Lage zu geben, um in das Gesicht blicken zu können. Bald ist es gelungen, aber mit finsterem Gesicht tritt Franz zurück, als er den Blick in das blutige Antlitz des daliegenden Mannes geworfen hat: er hat seinen Vater erkannt, dessen Sinne nun von einer Ohnmacht gefangen gehalten werden.
"Ist er tot?" fragte mit merklicher Angst die Frau.
"Nur ohnmächtig!" antwortete Franz.
"Wer ist es wohl?"
"Du wirst ihn sicher kennen, sieh einmal genau zu!"
Wieder beugt sich die Frau über das Gesicht, dann blickt sie fragend zu ihrem Mann auf, der wie sinnend mit abgewandten Augen dasteht: "Dein Vater?"
Franz überhört die Frage: er gedachte der Szene, als ihn der Vater vor zehn Jahren vom Hof verwies, weil er gegen seinen Willen die Ehe mit der Maria Neder schloss, und noch ein anderes Bild hielt seinen Sinn gebannt, machte seinen Puls schneller schlagen: jene Begebenheit, wo seine hilfesuchende Frau von dem Verunglückten war vor die Tür in Sturm und Schnee gestoßen worden war. Nun lag er hilflos, vielleicht schwer verletzt, zu seinen Füßen, nun war die Zeit der Rache gekommen. Und der Versucher trat ungesehen zu ihm heran und raunte ihm zu: "Lass ihn liegen, leicht ist es, dass er hier im Verderben stirbt, dann bist du morgen Herr vom Erlenhof!" Nur einen Augenblick lauschte Franz dieser Stimme, denn das ernste und milde Gesicht des alten Pfarrers, der ihn während seiner Krankheit oft besucht hat, trat wieder vor seine Augen, und er glaubte wieder die mahnende Stimme seines Seelenhirten zu vernehmen; "Hass darfst du dem Vater nicht nachtragen; du musst vergeben, denn du verlangst doch auch von Gott: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern!" Und Franz gab dieser Stimme Gehör, den Versucher in die Flucht schlagend.
"Ob es uns gelingt, ihn in das Haus zu bringen?" meinte er besorgt.
"Versuchen wir es, es ist Christenpflicht", antwortete entschlossen die Frau.
Eine mühevolle Arbeit war es für die drei, den Verunglückten in das Haus zu schaffen, zumal Franz noch längst nicht wieder im Vollbesitz seiner Kräfte war. Doch endlich war ihr Werk gelungen. Lang ausgestreckt lag der alte Danner auf dem Bett seines Sohnes, und mit echt christlicher Liebe begann seine Schwiegertochter das blutige Gesicht abzuwaschen. Dann schlug er die Augen auf, groß und fragend, um sie sofort wieder zu schließen. Es währte nicht lange, da kamen die Knechte vom Erlenhof, um ihren Herrn zu suchen: an eine Überführung nach dem Hof konnte in der Nacht aber nicht gedacht werden. Und auch in den nächsten Tagen nicht. Der sofort herbeigeholte Arzt konstatierte einen Beinbruch, infolgedessen der Alte mehrere Wochen in dem kleinen Waldhaus gefangen gehalten wurde. Die ersten Tage konnte er sich nicht in seine Lage finden, allmählich aber gab er sich in sein Schicksal, ja, er begann die Menschen, die er bisher gehasst und gemieden hatte, zu lieben. Und als er ihnen eines Tages die Hände zur Versöhnung bot, fühlte er sie beide von seinem Sohn und seiner Schwiegertochter fest ergriffen.
Endlich konnte der alte Danner auf seinen Hof zurückkehren, aber er kehrte zurück als ein anderer Mensch: seinen Hass und Stolz hatte er zurückgelassen. Aber nicht er allein hielt seinen Einzug auf den schönen Landsitz: mit sich führte er seinen Sohn, seine Enkelkinder und die früher so gehasste Schwiegertochter, die durch ihre Liebe und Sorge um ihn sein Herz erweicht hatte.
Und auf dem Erlenhof begann eine neue, glückliche Zeit.
________________________________________________________________________

2. Maria, Zuflucht der Sünder
Am Fuß des Apennins in Italien liegt ein weißes Städtchen. In der letzten Hütte unweit eines dichten Waldes wohnte eine Witwe mit ihrer sechzehnjährigen Tochter Beatrice.
Sie saß auf der Terrasse unter einem Zitronenbaum - krank und auf Haut und Bein abgemagert. Ihr Gesicht trug die Farbe des Wachses, als wäre sie bereits eine Leiche, nur die schwarzen, feurigen Augen glühten noch vor Liebe zum Leben.
Von dem Platz, auf dem die Witwe saß, konnte man das gesegnete, mit Gärten und weißen Häusern förmlich besäte Meeresufer überblicken. Im Hintergrund glänzte das grünliche Meer und die Augen konnten kaum unterscheiden, wo das irdische Meer aufhört und das unermessliche Luftmeer beginnt. Die südliche Sonne brannte, aber vom Meer her wehte eine kühlende, feuchte Luft. Es war eine wahre Lust, so im Schatten zu sitzen, die würzige, erfrischende Seeluft zu atmen und mit den Augen über den tiefblauen Himmel mit den weißen "Lämmern" herumzuirren oder die auf dem Meer so ruhig wie Schwäne dahinfahrenden Schiffe zu verfolgen und dem aus den Gärten und Weinbergen erklingenden Gesang zu lauschen.
Über das abgehärmte Gesicht der Witwe flog ein trübes Lächeln: "Ach, du schöne Welt, warum muss ich dich so bald verlassen? Und mein Kind!"
Sie schaute sich um nach der Tür, wo Beatrice auf der Schwelle saß und Schoten auslöste.
"Beatrice, cara anima (liebe Seele), komm, setz dich neben mich."
Beatrice stand auf und ging zur Mutter. Die Mutter sah sie mit unaussprechlicher Liebe an - und sie wusste auch warum. Beatrice war schlank und geschmeidig wie ein Reh, dichte, schwarze Haare fielen ihr in mächtigen Strähnen über den Rücken, und ihre sonnverbrannten Wangen blühten ihr wie Pfirsiche. Unterhalb der schön gewölbten Brauen sahen große, dunkelblaue, tiefe Augen unschuldig und zugleich munter hervor. Die Adlernase zeugte von Tatkraft.
"Wie geht es dir, Mutter?"
"Ganz gut, liebes Kind. Es kommt mir vor, als wenn die ganze Krankheit von mir wäre. Schau nur, wie das Meer schön glänzt. Ach, wo sind die Zeiten, wo uns auf ihm dein Vater selig auf dem Schifflein herumführte und dabei so schöne Lieder sang. Beatrice, geh und hol deine Mandoline und sing mir das "Santa Lucia".
Voll Freude, dass sich die Mutter wohler fühlte, brachte die Tochter die Mandoline, setzte sich neben die Mutter, stimmte das Instrument und sang mit weicher, von tiefem Gefühl durchdrungener Stimme das beliebte Nationallied.
Der Kranken wurden die Augen nass und die zweite Strophe sang sie mit der Tochter halblaut mit.
Als sie zu Ende gesungen hatten, sah die Mutter wie im Traum auf das Meer und seufzte: "Ach, das Lied pflegte dein Vater so gern und so schön zu singen! Kannst du dich noch an seine tiefe, klangvolle Stimme erinnern?"
"Gut", nickte Beatrice mit dem Kopf und lächelte in beseligender Erinnerung.
"Mir klingt seine Stimme heute noch in den Ohren. So wie er verstand es weit und breit niemand zu singen", sprach die Mutter weiter. "Einmal führte er mich dorthin ins Kloster - damals warst du noch nicht auf der Welt - zu einer Feierlichkeit.
Wir blieben dort bis zum Abend. Als wir heim ruderten, standen schon die Sterne am Himmel und der Vollmond stieg - wie ein Rad groß - aus dem Meer hervor. Ach, war das schön! Dein Vater vertiefte sich in das flammende Meer, auch in seinen Augen flammte es auf und er begann zu singen: "Santa Lucia".
Und die Kranke sang die Worte der ersten Strophe mit tiefer Stimme: sie ahmte den Gesang des Mannes nach.
Dann senkte sie den Kopf und sagte traurig: "Ach, von den Sternen hat er gesungen und jetzt ist er dort, wo die Sterne leuchten, und ich - ich werde ihm bald nachgehen."
"Mutter, rede nicht so!" Die Tochter ergriff die Mutter leidenschaftlich bei der Hand, "ich werde dich nicht verlassen!"
"Ach, wenn ich könnte, würde ich ewig bei dir bleiben, meine teure Seele, aber der Tod greift mir schon ans Herz. Ich fühle es gut. Es geht aber nicht anders: wir müssen bald voneinander Abschied nehmen, mein Engel."
Die Mutter umarmte die Tochter und legte ihren Kopf an ihre kranke Brust.
Der Beatrice flossen Tränen über die Wangen.
"Verzeihe, cara anima mia, dass ich dir mit meinen Worten weh tue, aber endlich muss ich es dir sagen. Fürchte dich nicht, du wirst nicht verlassen sein, wenn ich deinem Vater selig nachgehe. Gehe dann hin zu der Madonna", die Kranke zeigte zum Wald, "und bitte sie, sie soll deine Mutter sein. Als meine Eltern starben, ging ich auch zu ihr, und glaube es mir, sie beschützte mich getreu bis auf diesen Tag. Und hier das Kreuzlein da", die Mutter zog ein Kreuz aus Messing von ihrem Hals, "das trage nach meinem Tod stets bei dir, es wird deine mächtige Waffe sein gegen jeglichen Feind. Es ist in Loreto geweiht, ich habe es von deiner Großmutter geerbt."
Sie drückte das Kreuz innig an ihre Lippen und gab es dann der Tochter.
* * *
Das Laub begann welk zu werden. Vom Norden her zogen Vögel in Scharen dem wärmeren Süden zu, wo es weder Schnee noch Eis gibt, wo die Palmen immer grünen. Und in der Hütte über dem weißen Städtchen lag im Sarg die Witwe wie eine welke Pflanze. Ihre Seele war noch weiter fortgeflogen als die Zugvögel, sie flog dorthin, wo der ewige Mai blüht, wo as ewige Licht leuchtet.
Beatrice schmückte den teuren Leichnam mit den Herbstblumen, Freunde und Bekannte bedeckten ihn mit Heiligenbildchen und dann trug man sie unter Tränen hinaus auf den Friedhof unterhalb des Städtchens und legte ihn ins Grab.
Beatrice kniete beim Grab - bleich wie eine Marmorstatue - und sah mit starren Augen auf den Sarg, als könnte sie nicht begreifen, was geschieht. Tränen vergoss sie keine einzige. Als man den Sarg ins Grab hinabgelassen hatte, sank sie ohnmächtig zu Boden. Die Freundinnen trugen sie fort, suchten sie wieder zu beleben, und als sie wieder zu sich kam, entrang sich ihrer Brust ein langer, langer Seufzer und erst dann brach sie in lautes Schluchzen aus.
Die Freundinnen redeten ihr mit schmeichelhaften Worten zu und führten sie wie ein willenloses Kind heim. Vor der Hütte zuckte Beatrice zusammen, als hätte sie ein Gespenst gesehen, und rief: "Nein, dort geh ich nicht hin, dort hab ich jetzt niemand!"
"Komm also zu uns", lud sie des Nachbars Tochter ein.
"Erst später. Komm jetzt mit mir zur Gnadenkapelle - zu der Madonna."
Die Freundinnen gingen mit ihr hinaus in den Wald, wo an einem hoch hinansteigenden Steg eine Kapelle stand; in ihr befand sich eine künstlich aus Marmor ausgehauene Statue.
Beatrice ging eilig und furchtlos dahin, und als sie zur Kapelle kam, warf sie sich auf die Knie nieder, umschlang nach Art der leidenschaftlichen Italienerinnen die Füße der Statue und rief aus:
"Madonna, du weißt, dass ich jetzt eine verlassene Waise bin, dass ich niemand habe, niemand auf Gottes weiter, weiter Welt! Meine Mutter selig schickt mich zu dir, du sollst jetzt meine Mutter sein. Ich bitte dich um Gottes willen, um deines lieben Sohnes willen, nimm dich meiner an, verlass mich nicht, sonst müsste ich ins Meer springen! Madonna, hier vor meinen Freundinnen verspreche ich dir, dass ich dir eine treue, gute Tochter sein will. Oh, meine Mutter, ich werde täglich zu dir kommen, dir Blumen bringen und alles will ich dir anvertrauen, alles klagen. Gib mir doch ein Zeichen, dass du mich zu deinem Kind annimmst!"
Die Sonne schien hell und warf ihre Strahlen auf die Statue in der Kapelle. Das Gesicht der Madonna glänzte und der Beatrice kam es vor, als ob Maria ihr zulächele.
"Schaut, wie sie mich angelächelt hat!" rief sie erfreut. "Oh, meine gute, treue Mutter, jetzt bin ich nicht verlassen!"
Sie sprang auf und küsste der Statue die Füße. Dann verrichtete sie mit ihren Freundinnen noch ein Dankgebet und dann kehrten sie ins Städtchen zurück.
"Wirst dich jetzt daheim nicht fürchten?" fragte Beatrice des Nachbars Tochter Angela, ihre vertrauteste Freundin.
"Fürchten? Und warum? Schützt mich ja die Madonna selbst. Werde wohl ohne die Mutter mich einsam fühlen, aber fürchten? - Nein!" - Sie schüttelte den Kopf.
"Damit du dich nicht so einsam fühlst, komm ich jeden Abend zu dir und werde bei dir schlafen, ja?"
"Gute Angela, ich werde dir dafür dankbar sein", dankte ihr Beatrice.
Das Versprechen, das Beatrice nach dem Leichenbegängnis der Mutter in der Kapelle der Madonna gemacht hatte, erfüllte sie treu und redlich.
Es verfloss seitdem kein Tag, wo sie nicht ihre himmlische Beschützerin wenigstens einmal besucht hätte. Auch als der Winter kam mit seinem Nebel, kniete Beatrice täglich in der Kapelle im Wald. Und erst im Frühling, wo ohnehin die Schönheit der Natur jeden Menschen aus der dunklen Stube hinauslockt!
Die große südliche Sonne sank majestätisch ins Meer. Das weite Meer glänzte im purpurnen Licht, die Luft war von Licht und Wohlgeruch erfüllt; aus dem Wald erklang der Gesang der Vögel.
Vor der Kapelle Stand Beatrice und legte der Madonna einen schönen Kranz aus Frühlingsblumen aufs Haupt.
"So, jetzt bist du schön, meine gütige Frau!" sagte Beatrice mit kindlicher Stimme.
Dann kniete sie nieder und betete, bis die Dämmerung langsam heraufkam. Zur guten Nacht begann sie der Madonna das in ganz Italien verbreitete Lied zu singen: O sanctissima, o piissima, dulcis virgo Maria! (O heiligste, o gütigste, süße Jungfrau Maria!)
Im Wald rauschte es und ein hochgewachsener, sonnenverbrannter Mann trat aus dem Dickicht hervor. Auf dem Kopf hatte er einen breitkrämpigen Hut, unter den dichten Brauen glühten stechende Augen und das ganze bärtige Gesicht war von Leidenschaften und Entbehrungen zerrüttet. Die auf der Brust zusammengelegten Hände verhüllte ein kurzer, breiter Mantel.
Beatrice zuckte zusammen und sah den fremden Mann verwundert an.
Er lächelte bitter und sagte spöttisch: "Du betest? Na, so bete, wenn es dich freut. Einst habe ich auch gebetet."
Dann sah er auf das schöne, nur noch von der Abendröte erglänzende Meer und seufzte tief auf.
Beatrice sah ihn noch verwunderter an. "Und beten Sie vielleicht jetzt nicht mehr?"
Der Mann schüttelte heftig den Kopf, dass die langen Haare flatterten.
"Und warum nicht?" wunderte sich das Mädchen. "Hatten Sie denn keine Mutter, die Sie ermahnte, das Beten nicht zu vergessen?"
"oh, wohl, wohl!" lachte der Fremde. "Aber wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du dich kaum wundern. Hast du schon einmal von Carlo Benzoni gehört?"
Beatrice erschrak jetzt wirklich. "Carlo Benzoni?! Bei der Madonna, sind Sie am Ende selbst . . .?"
"Ja, ich bin Carlo Benzoni. Schweig nur und schrei nicht, dass uns niemand hört, sonst brauche ich nur zu pfeifen und meine Kameraden stürzen aus dem Wald hervor. Fürchte mich aber nicht, ich will dir nichts zuleide tun."
"Oh, ich fürchte mich nicht", sagte mutig Beatrice.
"Wie? Nicht einmal mich fürchtest du?" wunderte sich der Räuberhauptmann. "Was bist du denn?"
"Wie Sie sehen, ein armes Mädchen, aber ich habe eine Waffe, die mich selbst gegen den grimmigsten Feind zu schützen vermag."
Sie zog das von der Mutter ererbte Kreuz hervor.
Der Räuber war durch dieses heldenmütige Vertrauen sichtlich überrascht und gerührt. Er sagte mit freundlicher Stimme: "Auch ich habe einst geglaubt und betete so vertrauensvoll wie du; aber das ist schon lange her! Jetzt sind meine Hände mit Blut befleckt, wie könnte ich sie vor der Madonna falten? Verstehst du es?"
"Nein. Zur Madonna darf selbst der größte Sünder seine Zuflucht nehmen - also auch Sie!"
"Ich kann nicht!" rief Benzoni entschieden.
"Gut, dann will ich für Sie beten und Sie sollen sehen, dass mich die Madonna erhören wird", sagte Beatrice mit voller Überzeugung, kniete nieder, faltete die Hände mit dem Kreuzchen und begann das ewig schöne Gebet des hl. Bernhard zu beten: "Gedenke, o mildreichste Jungfrau Maria, dass es noch nie ist gehört worden, dass jemand, der zu dir seine Zuflucht nahm und dich um deine Fürbitte anflehte, von dir verlassen worden ist."
Und wie sie so innig, vertrauensvoll aus dem Innersten ihres jungfräulichen Herzens betete, fiel der Räuber wie von übernatürlicher Kraft getrieben auf die Knie und faltete wieder einmal seit langer Zeit seine verruchten Hände.
Als Beatrice zu Ende gebetet hatte und sich nach Benzoni umsah, rannen ihm Tränen über die Wangen.
"Danke, Madonna", rief das Mädchen aus, "du hast mich erhört!"
Der Räuberhauptmann sprang aber plötzlich auf, riss Beatrice das Kreuz aus den Händen und verschwand im Wald.
Beatrice sprang auf: "Mein Kreuz!" rief sie und eilte auf den Wald zu. "Gib mir mein Kreuz zurück! Ist ja nur aus Messing, was nützt es dir? Meine sterbende Mutter hat es mir gegeben. Gib mir mein Kreuz zurück."
Aber im Wald blieb alles still.
Sie fürchtete sich, weiter zu gehen und kehrte weinend heim.
Am Himmel schimmerten schon die Sterne der Hoffnung und vom Meer her wehte ein heilsames Lüftchen.
* * *
Fünfzehn Jahre nach dieser Begebenheit läutete ein grauhaariger Kapuziner an der Pforte des Frauenklosters, wohin zur Zeit des gemeinsamen Glückes der Vater Beatrice mit deren Mutter zu führen pflegte, und wünschte die Oberin des Klosters zu sprechen.
Die Pförtnerin zeigte ihm die Tür zum Sprechzimmer.
Er trat schweigend ein und zog die Kapuze über die Stirn.
Nach einer Weile erschien hinter dem Gitter eine hochgewachsene Klosterfrau, grüßte und fragte nach dem Wunsch des ehrwürdigen Mannes.
Der Kapuziner trat näher heran und fragte mit erwartungsvoller Stimme: "Kennen Sie mich?"
Die Klosterfrau sah ihn scharf an, erkannte ihn aber nicht.
Der Kapuziner schob die Kapuze zurück, so dass sein ganzer Kopf sichtbar wurde und fragte neuerdings: "Erkennen Sie mich auch jetzt noch nicht?"
"Nein."
"Dann kennen Sie wenigstens dieses Kreuz da!" sagte der Kapuziner und nahm ein messingenes Kreuzlein heraus.
Die Oberin streckte danach beide Hände aus und rief freudig: "Das ist mein Kreuz, das Kreuz meiner seligen Mutter!"
"Ja", verneigte sich der Kapuziner und fügte mit tiefer, bebender Stimme bei: "Carlo Benzoni hat es Ihnen genommen, ehrwürdige Schwester, der unwürdige Klosterbruder Francesco stellt es Ihnen wieder zurück. Ich erfuhr, wo Sie gegenwärtig sind, und kam, um Ihnen zu danken. Gott möge es Ihnen lohnen und beten Sie auch fürderhin für mich armen Sünder."
Er legte das Kreuz vor das Gitter, verneigte sich und verließ still das Zimmer.
Die Oberin faltete die Hände, sah empor und rief: "Madonna, Zuflucht der Sünder, wie bist du mächtig! Bitte auch für mich."
Die durch das niedrige Fenster eindringende Sonne beleuchtete ihr Gesicht wie das einer Heiligen. In diesem Augenblick war Beatrice wirklich glücklich in dem Bewusstsein der vollbrachten guten Tat.
________________________________________________________________________

Die Werkzeuge des Heils
3. Wähle recht! - Von F. Clute-Simon
König Karl V., der von 1364 bis 1380 als ein weiser, umsichtiger Fürst über Frankreich herrschte, ließ einmal seinen Sohn, den jungen Dauphin Karl, zu sich kommen, um seine Gesinnung und seine Absichten zu erforschen. Vor den Prinzen ließ er zwei Tische stellen; auf den einen legte er Zepter und Krone, auf den anderen ein Schwert und einen eisernen Helm und fragte ihn dann, welchen von den beiden Tischen er nach eigener freier Wahl sich zum Geschenk wünschen würde. Ohne sich lange zu besinnen, griff der Prinz nach Schwert und Helm, während er die goldgeschmückten, mit kostbaren Edelsteinen besetzten Abzeichen der königlichen Würde unbeachtet ließ.
Als der Vater, überrascht über die schnelle und nicht erwartete Wahl des Jünglings, ihn nach den Gründen fragte, die ihn bewogen hätten, so zu handeln, deutete der Dauphin von dem Tisch, der Helm und Schwert trug, auf den mit Zepter und Krone und gab dabei die kurze, aber inhaltsreiche Antwort: "Durch diese erwirbt man sich jene!"
Ein gewichtiges, ernstes Wort aus dem Mund des jungen Prinzen, beachtenswert für manche, die nach ihm Purpur und Krone getragen hatten!
Aber auch uns als Christen kann dieser Ausspruch als mahnendes Gleichnis dienen bei unserer Wahl zwischen dienendem, willigem Gehorsam und ungebundener Freiheit. Wollen wir die strahlende Krone der ewigen Freiheit und Glückseligkeit gewinnen und als Sieger in die Glorie des Himmels eingehen, so müssen wir auch zuerst nach den oft eisernen, harten Banden des Gehorsams, der Demut und Selbstentäußerung greifen und uns gleich dem königlichen Prinzen gestehen: "Nur durch diese erwerbe ich mir jene!"
Doch diese "Weisheit der heiligen Zucht ist wenigen offenbar", wie es in der Hl. Schrift heißt. Die meisten Menschen wählen anders: sie greifen im irdischen Leben schon zur unrechten Zeit nach Herrschaft und Freiheit, ohne sie sich für die Ewigkeit zu erstreiten durch Gehorsam und Entsagung; ihre Wahl trifft jene Freiheit, die in frecher Willkür und Zügellosigkeit besteht und den Kampf führt gegen Gott, gegen göttliches und menschliches Gesetz, deren Losungswort nach dem Psalmisten heißt: "Lasst uns ihre Fesseln zerreißen und von uns werfen ihre Stricke!" (Psalm 2,3)
Aber in diesem Reich schrankenloser Willkür und Eigenmacht wird es mit der Herrschaft nicht von langer Dauer sein. Ihre Jünger werden nur zu bald in den eigenen Schlingen gefangen, von den selbstgeflochtenen Banden umgarnt und ganz zu dienenden Sklaven und unfreien Knechten erniedrigt.
Wer jedoch nach diesem Wort des Prinzen denkt und handelt, dem werden die drückenden, eisernen Banden zu befreienden Banden des Heils, zu Waffen im Kampf, der ihm das Zepter himmlischer Macht und Freiheit, die Krone ewigen Glücks und unvergänglicher Größe erringt. Darum: Wähle recht!
________________________________________________________________________

Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans
4. Eine edle Königin
Die fromme Königin von Belgien, die im Oktober 1850 starb und deren Wohltätigkeit allgemein bekannt war, machte an einem Winterabend des verhängnisvollen Jahres 1848, das so viele Familien ins Elend stürzte, einen Ausgang. Es war einer ihrer gewohnten Wege, um das Elend aufzusuchen und Not und Armut zu mildern. Sie war von einer ihrer Hofdamen begleitet. Ihr Ziel war ein Stadtviertel von Brüssel, das man so recht als die Wohnung der Armen betrachten konnte. Hier wanderte sie von Haus zu Haus, in jedem Trost und Unterstützung spendend, aus jedem Dank und Segen mitnehmend.
In einem dieser Häuser nun traf sie einen jungen Mann mit seiner Frau, beide in düsterer Stimmung. Im Ofen brannte kein Feuer, im Schrank fand sich kein Stückchen Brot. Die Königin, gerührt von so großer Dürftigkeit, fragte nach ihrer Ursache; der Mann aber antwortete nur mit einem schrecklichen Fluch. Die Königin ließ sich jedoch nicht abschrecken; sie bat um nähere Mitteilung, und dies mit solcher Teilnahme, dass der Unglückliche endlich eingestand, dass er ein französischer Revolutionär und aus Frankreich nach Belgien geflüchtet sei, um einer Verurteilung zu entgehen. Auch habe er keine Arbeit und seine Mittel seien zu Ende.
"Aber welches Gute erwarten Sie von der Revolution?" fragte die Königin. "Welches Übel wollen Sie in Frankreich ausrotten?"
"Ludwig Philipp!" stieß der junge Mann unter einer Flut von Verwünschungen und Flüchen hervor.
Diese Worte machten auf die gute Königin, Luise von Orleans, Tochter des vertriebenen Königs Ludwig Philipp, einen schmerzlichen Eindruck. Indes, eingedenk der Worte unseres göttlichen Heilandes, dass man selbst seinen größten Feinden verzeihen müsse, behielt sie ihre Fassung und gab sich nicht zu erkennen.
"Der König muss Ihnen viel Böses zugefügt haben, da Sie solch großen Hass gegen ihn hegen", bemerkte sie. "Wohlan denn, ich will Sie dafür reichlich entschädigen!"
Und die edle Frau und echte Christin überreichte dem Menschen, der keinen größeren Wunsch hatte, als der Mörder ihres Vaters zu werden, hundert Frank mit dem Versprechen, dass sie in Zukunft für seine Bedürfnisse sorgen werde.
Das Erstaunen des Rebellen steigerte sich aber später zur tiefsten Beschämung, als er zufällig erfuhr, wer seine Wohltäterin war. In eiliger Hast begab er sich zu ihr und bat um Verzeihung für die schwere Beleidigung. Sie wurde ihm auch vollständig zuteil; denn diese edle Frau kannte kein Gefühl der Rache, wohl aber hatte sie die Rettung eines Verirrten erreicht, und in diesem Gefühl fand sie sich hinreichend belohnt.
________________________________________________________________________

Der selige Papst Pius IX.
5. Madame, mein Sohn ist Präfekt! - Von N. Pontis
Im Sommer 1846 stand die päpstliche Postkutsche, die dreimal wöchentlich die Reise von Ancona nach Ferrara machte, angespannt vor dem Gasthof "Zu den Tre Pellegrini" in Ancona.
"Kutscher!" rief mit gebieterischer Stimme eine im Inneren des rotgelben Kastens sitzende majestätische und schon bejahrte Dame, an deren Aussprache man die Piemontesin erkannte. "Kutscher! Ja, wann fahren wir denn ab? Wir haben bereits zehn Minuten Verspätung."
"Halten`s zu Gnaden, Madame", erwiderte unterwürfig der Kutscher, "sobald die Dame, die ihren Platz zurückbehalten hat, angekommen sein wird."
Die Dame murmelte etwas über die Unhöflichkeit der Mitreisenden und machte sich um ihre Toilette zu schaffen. Sie trug eine malvenfarbene seidene Robe, und auf ihrem Kopf türmte sich ein safrangelber Turban auf. An ihrem Hals glänzte eine goldene Kette und am Arm eine goldene Spange. An den Fingern trug sie goldene, mit Saphiren und Smaragden besetzte Ringe. In der Hand hielt sie einen mit Flittergold besternten Fächer, mit dem sie sich aufgeregt fächelte.
In diesem Augenblick näherte sich ein Lakai, der einen schweren Handkoffer auf der Schulter trug, der Kutsche. Auf dem Koffer stand folgende Inschrift: Contessina M., Sinigaglia.
Endlich schritt eine alte Dame mit gutmütigen Zügen auf die Kutsche zu. Sie hatte eine schwarzseidene Robe an. An ihrer Seite ging der Bischof von Ancona und drei alte Domherren. Einer dieser letzteren hielt ganz demütig den Fußschemel, auf dem die Dame in die Kutsche stieg. Darauf nahmen der Bischof und die Domherren mit einer tiefen Verbeugung Abschied, der Postillion sprang auf seinen Sitz, knallte mit der Peitsche und die rotgelbe Maschine rasselte über das holperige Pflaster Anconas dahin.
"Irgend eine wichtige Betschwester", dachte die aufgeregte Dame, indem sie die Neuangekommene von der Seite her betrachtete.
Die Dame im schwarzen Rock zog einen einfachen Rosenkranz aus der Tasche und fing an zu beten. Die andere nahm ihrerseits einen Rosenkranz mit Goldkörnern in die Hand und tat desgleichen. Als das Gebet zu Ende war, sagte die Dame im Malvenkleid:
"Sie reisen nach Sinigaglia. Eine arme Stadt, fürwahr! Ich fahre nach Turin, das ist eine Hauptstadt. Dort wohnt viel alter Adel. Die Marchesin von Montevatini, die Gräfin von Portanova und die Baronin von Muskat-Asti sind meine Freundinnen. Ich gehe auf die Bälle des königlichen Hofes und zweimal wöchentlich ins Theater. Das Leben in einer kleinen Stadt wie Sinigaglia muss furchtbar langweilig sein."
Die schwarzgekleidete Dame lächelte gütig, antwortete aber nicht. Eben hatte die Kutsche eine kleine Anhöhe erstiegen, von wo aus das Adriatische Meer sichtbar war. Die Dame mit der schwarzseidenen Robe ließ ihre Blicke über die blauen Fluten des Meeres schweifen und begann einen zweiten Rosenkranz zu beten. Die andere erstickte fast vor verhaltenem Ärger.
Bei der ersten Haltestelle reichte ein Kapuziner seine Sammelbüchse herein. Die schwarzgekleidete Dame legte bescheiden einige Kupfermünzen hinein, während die Piemontesin ostentativ ein Zweilirestück mit dem Bildnis Karl Alberts hineinfallen ließ.
Bei einer anderen Haltestelle stand eine Frau des Volkes mit zwei Kindern, einem zweijährigen Bübchen und einem kleinen Mädchen, das sechs Jahre alt zu sein schien. Sie schickte sich an, in den rollenden Käfig zu steigen.
"Was, ihr wollt mitfahren?" rief die Piemontesin. "Es ist ja kein Platz in diesem engen Kasten, man erstickt fast vor Hitze. Ich will durchaus nicht, dass ihr euch neben mich setzt!"
Durch diese Worte eingeschüchtert, wandte sich die Frau weg, um bei dem Kutscher Hilfe zu suchen. Kaum hatte die schwarzgekleidete Dame ihre Verlegenheit bemerkt, so rief sie ihr freundlich zu:
"Steigt nur ein, liebe Frau. Reicht mir den Kleinen herein, ihr mögt euch neben mich setzen und den Knaben auf den Schoß nehmen. Das Mädchen setzt sich in die Ecke."
Nachdem der Kutscher die Pferde gewechselt hatte, wollte die "Schnellpost" weiter. Eine Stunde später stieg die Frau mit ihren Kindern unter großen Dankbezeugungen gegenüber der schwarzgekleideten Dame aus, während die andere einige Tropfen aus ihrem Riechfläschchen in die Kutsche goss.
Gegen Mittag hielt die rotgelbe Kutsche ihren Einzug in Sinigaglia. Vor dem Portal eines alten Palastes hielt sie mit einem Ruck unter heftigem Schellengeklingel an. Am Eingangstor des Palastes standen merkwürdigerweise ebenfalls ein Bischof und drei Domherren. Der Bischof öffnete selbst den Kutschenschlag und grüßte ehrerbietig. Ein Domherr hielt den Schemel, als die Dame ausstieg. Die Piemontesin war rot vor Zorn. Sie konnte sich nicht mehr mäßigen, und während ihre Reisegefährtin, auf den Arm des Bischofs gestützt, auf den Palast zuging, rief sie ihr zu:
"Wissen Sie auch, Madame, dass mein Sohn Präfekt ist?"
"Und mein Sohn, Madame, ist Papst!"
Es war die Mutter Pius IX., die von Rom kam, wo sie der Krönung ihres Sohnes in der Laterankirche beigewohnt hatte, und die eben in den Palast der Mastai zurückkehrte.
________________________________________________________________________
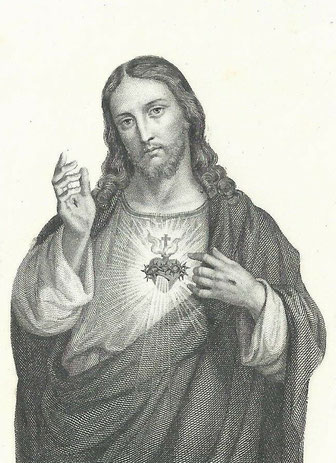
6. Probatum est! - Ein Traum, der Wirklichkeit ist
Probatum est!
In der Tat ein merkwürdiger Titel. Was heißt denn das?
Ich war einmal hinaufgepilgert in die Fremde, weit, viele, viele Stunden von hier. Vor mir lag ein hoher Berg. Ich kletterte ihn hinauf und schaute über das weite Land und lauschte den Glockentönen nah und fern. Der Abend dämmerte in goldener Pracht. Über mir winkte der Abendstern freundlich seinen Gruß.
Wie ich mich umsehe, entdecke ich zwischen uralten Eichen und Kastanien ein liebtrautes Kapellchen und gehe hinein, um zu beten. Die letzten Lichtstrahlen des scheidenden Tages zittern durch die bunten Scheiben und weben stillen Glanz um ein hübsches Herz-Jesu-Bild hoch oben über dem alten Altar. Holdselig lächelnd deutet der gute Hirt mit der einen Hand zur Erde, während die andere auf sein liebeglühendes Herz zeigt. Unten trägt das Bild in goldenen Lettern eine Inschrift: Probatum est!
Es ist schon vorgerückter Abend. Bald wird es Nacht. Das liebe Glockengeläute tönt noch fort in meinen Ohren, es bebt die Seele in heiliger Freude - eine linde Luft, eine liebliche Frische umfängt mich - eine süße, heilige Ahnung erhebt mein Gemüt.
Ich schaue auf das Herz-Jesu-Bild und mein Blick haftet an der sonderbaren Inschrift. Ich denke nach: "Probatum est - es ist erwiesen." Und wie ich denke und denke, schwebt ein Englein durch den Raum und drückt mir sacht die Augen zu.
Ich schlummere und ein Traum zieht durch meine Seele:
Von ferne tönt ein wundersames Klingen. In weißen Kleidern, mit wallenden Fahnen, mit Kreuz und Stab kommt eine unabsehbar lange Prozession gewandert und steigt singend den Berg hinan.
Ich stehe auf und verberge mich in einem hochgelegenen Winkel. Jetzt sind die Wallfahrer oben angelangt. Die Tür öffnet sich und die Menge füllt dicht geschart den letzten Platz. Voll Erstaunen schaue ich gar merkwürdige Gestalten. Die einen gehen auf Krücken, die anderen tragen eine große Last. Dieser ist blind und jenem steht der Hunger ins Gesicht geschrieben. Niemanden sah ich ohne Leid. Aber alle richten sie ihre Augen hoffnungsfreudig nach dem Bild des göttlichen Herzens, und der liebe Heiland lächelt gütiger, glückverheißender denn je.
Da erhob sich die erste Reihe der Bresthaften und begann zu klagen: "Probatum est - es ist erwiesen. O getreues Herz Jesu, hilf auch uns."
Lächelnd winkt Jesus. Sie erhoben sich und zogen sich zurück.
Da trat die zweite Reihe vor: "Probatum est - es ist erwiesen. Es ist erwiesen, dass du die Quelle allen Trostes bist. O göttliches Herz-Jesu, hilf auch uns!"
Mild winkt des Heilands Hand Gewährung. Sie verlassen ihre Bank und ziehen sich zurück.
Langsam tasten sich die Blinden heran: "Probatum est - es ist erwiesen! Es ist erwiesen, dass du das Schlachtopfer für unsere Sünden bist. O göttliches Lamm, o brennender Glutofen der Liebe, hilf uns in unserer geistigen Blindheit."
Und unendlich mild im sanften Antlitz steigt der gute Hirt selbst vom Thron, um die Binde fortzunehmen von ihren Augen und die Sünden aus ihren reuigen Herzen.
Preisend danken sie erlöst und gehen.
Auch die letzten fassen Mut: "Probatum est - es ist erwiesen! Es ist erwiesen, dass wir aus deiner Fülle alle empfangen, gib uns Brot und Arbeit. O Herz Jesu, hilf!"
Jesus neigt das Haupt. Erhörte gesellen sich zu den übrigen.
Draußen erschallt noch lange ihr jubelnder Gesang. Lobsingend wallen die Wanderer von hinnen. Leise, leise verhallt er.
Ich erwache und fahre in die Höhe. Aus irgend einem Tal klingen vom Wind hergetragen die ersterbenden Schläge eines verspäteten Glöckleins. Dunkelheit breitet sich aus und aus ihr glänzt und schimmert im matten flackernden Licht der Ewigen Lampe das milde Gottesbild.
Doch was ist das? Ich trete näher und staune. Sinnend lege ich die Hand an die Stirn. Habe ich denn geträumt oder nicht? Sind wirklich Pilgrime hier gewesen?
Siehe, da hängen sie an der Wand all die Krücken, die dankbaren Votivtafeln, die Beweise, dass Jesus geholfen hat.
Ein heiliges Schauern ergreift mich.
"Probatum est - es ist erwiesen!" flüstern meine Lippen und niederkniend küsse ich die Füße des göttlichen Heilandes: "O göttliches und liebevolles Herz Jesu! O du Heil aller, die auf dich hoffen und beseligende Hoffnung aller, die in dir sterben, sei auch mir gnädig und barmherzig, sei auch mir ein sicherer Hafen und schützender Port in den Finsternissen und Trübsalen des Lebens."
Und getröstet und gestärkt verlasse auch ich den heiligen Berg.
________________________________________________________________________

7. Seht meine Hände - Von Pierre l`Ermite
Es war ein trüber Herbstabend. Der Wind heulte über die Heide. Der Himmel war grau und die dicken Regentropfen zerschlugen sich an den kleinen Fensterscheiben der Strohhütte. Drinnen am Feuerherd saßen die beiden Alten nebeneinander auf der Bank und sahen beim traulichen Geplauder in das Ersterben der Flammen . . . .
"Auch uns wird es bald ergehen wie diesem Feuer, Annemarie."
"Bei Gott, ja."
"Wie viele Jahre sind es schon?"
"67 auf Weihnachten."
"Und ich 70!"
"Wolltest du das Leben nochmals beginnen, wenn es sich dir anbieten würde?"
Der Fischer wurde nachdenklich und im erglimmenden Feuer glich sein runzeliges Gesicht einer alten Baumrinde.
"Noch einmal das Vergangene durchmachen! Unsere Kinder noch einmal sterben sehen? - Nein, nein, lieber sterben!"
"Nur müssen wir noch unsere Vorsichtsmaßregeln treffen."
"Welche Maßregeln?"
"Wenn wir einst in kühler Erde ruhen, sag an, wer wird dann für uns beten?"
Daran hatte der Alte bis jetzt wenig gedacht.
Ja, richtig! Wenn einst sechs Fuß Heideerde ihn bedecken und auch seine Frau nicht mehr ist, wer wird dann für sie beten?
Und im Geist dieses schweigsamen Bretonen, der doch so sehr gewohnt war an seine öde Heimat und an die einsamen Meereswellen, stieg eine Ahnung auf von diesem tiefen Schweigen, diesem Verlassensein an geheimnisvollem, schrecklichem Ort - und er wurde darüber ganz entsetzt. - Ja, sie hatte recht, seine gute Alte - man muss danach sehen; aber wie?
Und Annemarie suchte ihm zu erklären, dass mit einer Summe von dreihundert Franken der Pfarrer ihnen jedes Jahr am Sterbetag eine Messe singen würde für ihre Seelenruhe.
"Und wie lange wird das geschehen?"
"Auf ewige Zeiten!"
Und zur Bekräftigung ihrer Worte streckte die gute Bretonin ihren Arm weit aus, als wolle sie damit bis an die Ewigkeit reichen.
Aber wie es anfangen, um hier in weltverlorener Strohhütte, ohne darben zu müssen?
Dreihundert Franken! Man müsste fischen; Strümpfe stricken!
Dann rechneten sie weiter mit größeren Faktoren:
Auf der Sparkasse standen hundertsiebzehn Franken für Krankheitsfälle.
Sie besaßen eine kleine Wiese, die der Fleischer gemietet hatte und die wohl achtzig Franken wert war.
Und dann hatte jener alte Pariser den alten Schrank abgehandelt; das Erbstück, an dem man mit ganzer Seele hing, weil es aus grauer Vorzeit stammte und mit seinen glänzenden Beschlägen und seinem goldgelben Anstrich an die fleißigen Hände der Vorfahren erinnerte. Annemarie hatte darin all ihre Wäsche liegen . . . .
Nun, man wollte schon ohne ihn zurechtkommen.
Man könnte sich außerdem etwas vom Fett absparen, das Strohdach wollte man dieses Jahr nicht erneuern, und der kleine Nachen müsste ohne Anstrich bleiben.
Ja, ja, es würde schon alles gehen.
Und wirklich, es ging!
Eines Tages setzte Annemarie die weiße Haube auf; Yvo zog den blauen Kittel an, nahm den schwarzen Filzhut mit dem Sammetband, und die beiden Alten schlugen den Pfad zum Pfarrhof ein. Dort legten sie auf das Pult des Pfarrers in eine Reihe fünfzehn Goldstücke, fünfzehn schöne blanke Goldstücke. - Annemarie hatte sie sogar noch mit Sand und Asche gescheuert, um ihnen ein gefälliges Aussehen zu eben.
Und feierlich im Namen der Kirche und des Bischofs trug der Pfarrer ihre Stiftung unter zwölf andern ins Pfarrregister ein:
Yvo und Annemarie L. C.
Jahresgedächtnis auf ewige Zeiten!
Und überglücklich schlugen sie den Rückweg nach dem Strand ein. Der schöne Himmel, das blaue Meer spiegelten sich in ihren Herzen wieder.
Nunmehr war ja die Zukunft gesichert!
Unter großen Opfern hatten diese armen Leute sich auf dieser Erde ein wenig Unsterblichkeit erkauft. Hienieden wird man sie jetzt nicht mehr vergessen, und droben werden sie auch nicht gelten als ungeliebte Wesen jeden Gebetes bar.
Nicht nur wird ihre Pfarrei sie einschließen in das allgemeine Gebet für die Verstorbenen, nein, sie werden auch die Freude haben, dass man an einem bestimmten Tag das hl. Opfer für sie darbringt. Man wird sie erwähnen, ihre Namen verkünden - die Jugend wird es hören und sich sagen: Ach ja, Annemarie und Yvo L. C.! Der bärtige Fischer - mein Vater sprach öfters von ihnen - sie wohnten draußen im Heidehäuschen!
Und tot im Grab werden sie so fortleben im Herzen ihrer Mitmenschen.
Und wirklich! Drei Jahre lang nach ihrem Tod lud jedes Mal am 10. November der Pfarrer die Gemeinde zur Messe ein, um für die zu beten, die so sehr um ein Gebet nach ihrem Tod besorgt waren.
Drüben im Jenseits mussten die beiden Alten zufrieden sein: Die Erde war ihnen treu geblieben in ihren Gebeten und in ihrem Andenken. Dieses Jahr aber ist nichts mehr!
Die Kirche ist leer; die Glocken sind stumm; die Stiftung ist geraubt von der französischen Regierung.
Die fünfzehn Goldstücke, die Frucht so vieler Sorgen und Entbehrungen haben die Freimaurer geraubt, nicht nur im verlorenen Dörfchen der Bretagne, sondern in ganz Frankreich!
Ja, ja; Sie haben sich getäuscht, Annemarie, und Sie, guter Vater Yvo!
Ein Blick in die Vergangenheit hat euch gesagt: Wir sind sicher! Und so seid ihr ruhig in den Armen des Todes entschlummert mit dem Gedanken: Man wird es nicht wagen!
Und doch, die Zukunft hat es gewagt! Ein Mann hat mit großem oratorischen Pathos in der Kammer ausgerufen: Seht meine Hände; kein Tropfen Blut klebt an ihnen! Und die Umstehenden schauten erstaunt: wirklich, kein Blutstropfen war zu sehen.
Aber nähertretend und sie genauer betrachtend hätte man andere, vielleicht noch unheilvollere Spuren darauf sehen können . . . nämlich Tränen, Seelenblut, das jener Mann so ziemlich überall in seinem Vaterland fließen lässt.
Tränen der Überlebenden, die zusehen mussten, wie ihre Toten des einzigen ihnen noch bleibenden Schatzes beraubt wurden.
Geheimnisvolle Tränen derer, die im Jenseits leiden und nun nicht mehr getröstet werden.
Tränen so vieler Franzosen, die mit ihren Kindern ein gedrücktes, gebrochenes und an Verfolgungen reiches Leben führen müssen, weil sie am Glauben der Väter festhalten wollen.
Tränen, selbst der leblosen Geschöpfe, wie der Dichter sagt, Tränen, die epochemachend sind und ein Land den strengen Strafen der göttlichen Gerechtigkeit aussetzen.
Wenn Hände durch eine Unterschrift soviel Elend heraufbeschworen haben, dann ist es unklug, selbst in oratorischem Pathos die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dann schweigt man, oder man verbirgt sich.
________________________________________________________________________

8. Die Zahl "Dreizehn" - Nach einer Tatsache von Paul Lucas
Auf meiner mehrwöchigen Ferienreise kam ich auch in die Eifel, und da mir diese Gegend bisher unbekannt war, so nahm ich mir vor, hier die letzten Tage meiner Ferien zu beschließen. Ich logierte mich daher in ein mir von meinen Freunden bestens empfohlenes Hotel eines kleinen, aber anmutigen Städtchens ein und brachte schon den ersten Tag recht angenehm in fröhlicher Gesellschaft zu.
Am letzten Abend vor meiner Heimreise wollten meine Tischgenossen mir zu Ehren noch ein schönes Abschiedsfest feiern.
Da es ein wunderschöner Abend war, wurde einstimmig gewünscht, das Fest draußen auf der reizenden Veranda des Hotels abzuhalten.
Die kleine Festlichkeit verlief glänzend, und die Nacht sank langsam hernieder. Es war schon spät, gegen 1 Uhr, doch waren wir - wahrscheinlich durch den feurigen Wein - noch so eifrig in interessante Unterhaltung vertieft, dass wir kaum ans Schlafengehen dachten.
Wir sprachen sehr lebhaft über geheimnisvolle sogenannte spiritistische Begebenheiten und auch besonders über den Aberglauben, der, wie die Mehrzahl der ehrenwerten Gäste behauptete, ganz besonders stark unter dem Landvolk vertreten sei . . . Die Städter aber seien gegen solchen Unsinn hoch erhaben . . .
Besonders tat sich eine mir mit Frau Rat vorgestellte ältere Dame hervor.
Kurz und gut, es wurde lebhaft und lange gestritten. Die einen behaupteten, dass nicht unter der Landbevölkerung, sondern hauptsächlich unter den "gebildeten" und besseren Ständen der Aberglaube am stärksten sich finde; die anderen aber bestritten unter besonderer Anführung der mit sehr guten Sprechwerkzeugen begabten Frau Rat aufs empörteste eine solche Behauptung.
Mitten im Stimmengewirr erhob sich plötzlich ein wohlbeleibter, gemütlicher Herr, namens Wineke, der mir schon wegen seiner feierlich-drolligen Scherze und Antworten aufgefallen war, von seinem Platz und sagte mit geheimnisvoller Stimme zu den Anwesenden:
"Meine verehrtesten Damen und Herren, ich erlaube mir, Ihnen zu sagen, dass ich für meine Person fest und steif an das Walten einer übersinnlichen Macht glaube, und es ist meiner Ansicht nach der Aberglaube ein "guter Glaube" und vielfach sehr berechtigt. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, dass wir augenblicklich hier gerade dreizehn Personen sind."
Ein Schein des Erschreckens huscht bei dieser Mitteilung über fast alle Gesichter. Doch niemand lässt sich etwas anmerken, sondern alle hören Herrn Wineke weiter aufmerksam zu.
"Es dürfte nun einem jeden von Ihnen bekannt sein, dass diese böse Zahl stets Unglück und Verderben bringt. - Auch habe ich gehört, dass derjenige, der von dreizehn Personen zuerst aufsteht, sterben soll . . . Es ist dies keine Faselei oder gar Schwindel, sondern Tatsache. - Noch vor kurzem las ich in einer Zeitung, dass ein junger blühender Mensch das Opfer einer solchen geheimnisvollen Macht geworden sei - - -."
Diese zuletzt im Flüsterton gesprochenen Worte verfehlten ihre Wirkung nicht.
Unruhig, von geheimer Furcht erfasst, rückten alle näher beisammen, und besonders war es Frau Rat, die bei den letzten Worten des Erzählenden um einen Schatten bleicher geworden war und nervös auf ihrem Stuhl hin und her rutschte.
Jedoch suchte ein jeder sein geheimes Bangen zu verbergen und das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. Dies gelang auch bald, und das soeben Gehörte schien vergessen zu sein.
Die ausgelassene Lebhaftigkeit war jedoch vorbei, und es war ein Leichtes, einem jeden anzusehen, dass er sich nicht behaglich fühlte.
Der dicke gemütliche Herr schien sich aber nicht zu ängstigen; denn er plauderte fröhlich weiter und sprach sehr lebhaft über seine Erlebnisse in fernen Ländern. Doch ab und zu, wenn er sich nicht beobachtet glaubte, umspielte ein spöttisch-mitleidiges Lächeln seinen Mund.
Inzwischen rückte der Zeiger der Uhr immer weiter; es war schon 2 Uhr nachts, und noch immer wurde nicht aufgebrochen; denn es getraute sich niemand, zuerst aufzustehen!
Die Geschichte fing an, mir interessant, den anderen aber höchstwahrscheinlich langweilig und lästig zu werden. Jene nämlich wollten schon früh einen Ausflug machen und sehnten sich deshalb danach, recht bald schlafen zu gehen, und nun saßen sie hier fest und konnten nicht fort - wegen abergläubischer Furcht!
Für mich war die Ruhe nicht so nötig, da mein Zug erst gegen 11 Uhr morgens abfuhr. Außerdem war ich sehr gespannt, was wohl geschehen würde, da niemand sich zuerst erheben wollte.
Die Situation wurde immer peinlicher, die Kellner liefen erregt umher, und dem Hotelbesitzer, der seine Gäste um diese Zeit gewöhnlich schon längst zur Ruhe wusste, wurde die Sache nicht weniger ungemütlich.
Jetzt konnte auch ich die furchtbare Verlegenheit, in der wir uns befanden, nicht länger ertragen und dachte nach, wie ihr abzuhelfen sei.
Wir säßen vielleicht noch immer zusammen, wenn mich nicht plötzlich ein rettender Gedanke, den ich auch sogleich zur Ausführung brachte, durchzuckt hätte.
"Heda, Herr Wirt", rief ich dem Hotelbesitzer zu, der schon Anstalt zu machen schien, uns an die Luft zu setzen, "trinken Sie zum Abschied, da ich morgen von hier wieder fortreise, ein Gläschen Wein mit!"
Der Wirt, in der Hoffnung, dass hiermit die Festlichkeit endlich aus sei, setzte sich zu uns und trank auf mein Wohl ein Glas Wein.
Wir waren nun 14 Personen. Dies hatte mit einem Blick Frau Rat erfasst, die sich mit einem Seufzer großer Erleichterung auch sogleich erhob und sagte: "Meine Herrschaften, es ist die allerhöchste Zeit, dass wir ins Bett kommen, wenn wir unseren geplanten Ausflug morgen nicht versäumen wollen."
Alle erhoben sich freudig ob dieses guten Ausgangs, und nachdem mir alle, besonders aber Frau Rat, sehr herzlich und dankbar die Hand geschüttelt hatten, verabschiedeten wir uns.
Herr Wineke jedoch hielt mich noch einen Moment zurück und sagte lächelnd: "Mein lieber Herr, hier haben Sie die beste Gelegenheit gehabt, zu sehen, wo der Aberglaube am größten ist."
________________________________________________________________________

9. Der Geist der Stärke - Von Ernst Schultheiß
Friedrich Schaller war im Büro der Firma Hiller & Co. als Bote beschäftigt. Jahrelang hatte er treu und gewissenhaft seinen Dienst verrichtet. Er war schon im vorgerückten Alter und das gefiel seinem Chef nicht. Unsere moderne Zeit ist gefühllos; sind die Leute verbraucht, so wirft man sie zum alten Eisen. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen.
Beim Mittagessen meinte Herr Hiller: "Den Schaller werde ich bald entlassen müssen, der Mann ist alt. Trotzdem läuft er jeden Morgen in aller Frühe mit einem dicken Gebetbuch zur Kirche. Dabei muss der Mensch ja verdummen!"
Herr Hiller war nämlich ein richtiger Lebemann und zwar im verwegensten Sinn des Wortes. Dass dieses Leben nur eine Vorschule der Ewigkeit ist, dass er dereinst einmal bei seinem Richter ein strenges Examen zu bestehen hat, daran dachte er gar nicht. Seine Frau kleidete sich nach der neuesten Mode, besuchte und veranstaltete Festlichkeiten und las zwei- und eindeutige Romane. Ihre Dienstboten betrachtete sie als Menschen dritter und vierter Klasse und behandelte sie auch so.
Schaller hatte eine Tochter, ein blühendes, sittsames Mädchen, unberührt vom Hauch des Schlechten, die Freude und der Stolz der Eltern. Die größte Sorge der Mutter war, ihrem Kind jede Gefahr für ihre Reinheit und Unschuld aus dem Weg zu räumen. Und doch sollte der Tag kommen, an dem ihr dies nicht mehr möglich war.
Frau Hiller sagte nämlich bei der Unterredung mit ihrem Mann: "Den Schaller wirst du wohl noch einige Zeit verschleißen müssen, ich habe vor, seine Tochter in meinen Dienst zu nehmen, und das wird nichts werden, wenn du ihm den Stuhl vor die Tür setzt."
Der Sohn der Eheleute Hiller, der mit zu Tisch saß, horchte auf. Schon lange hatte er seine Augen auf das Mädchen gerichtet und allerlei Versuche zur Annäherung unternommen, allerdings vergeblich. Nun fühlte er sich berufen, auch ein gutes Wort für den alten, treuen Schaller - wie er sich ausdrückte - einzulegen.
Herr Hiller Senior liebte lange Auseinandersetzungen nicht und entschied, dass unter solchen Umständen die Kündigung noch hinausgeschoben wird.
Am Tag darauf wurde Schaller zu der Frau seines Chefs befohlen.
"Sehen Sie, lieber Mann", sagte sie, "eigentlich sollten Sie Ihre Kündigung am 1. April erhalten, ich habe für Sie gebeten und deshalb bleiben Sie noch auf Ihrem Posten. Dafür darf ich wohl eine kleine Gegenleistung beanspruchen. Überlassen Sie mir Ihre Tochter Anna für ein Jahr. Sie wissen, ich zahle einen guten Lohn."
Schaller wurde verlegen. Er wolle die Angelegenheit mit seiner Frau besprechen und baldigst Bescheid geben.
Beim Abschied drohte ihm Frau Hiller lächelnd mit dem Finger.
"Machen Sie aber, dass ich keinen Korb bekomme, sonst . . ."
Schaller konnte nur mit gepresstem Herzen seiner Frau Mitteilung von der Unterredung erstatten.
Die schlug die Hände zusammen und rief: "Um keinen Preis gebe ich das Mädchen in das Haus. Die Herrschaft will katholisch sein und kümmert sich um die Kirche nicht, der Mann, Frau und Sohn haben ihre eigenen Wege. Nein, nein!"
"Bedenke doch", sagte der Mann, "ein Jahr noch muss unser Fritz die Maschinenbauschule besuchen. Wovon sollen wir das Schulgeld bestreiten, wenn ich entlassen werde? Wir verderben dem Jungen seine Zukunft."
"Nein", entgegnete die Frau, "Anna geht unter keinen Umständen in das Haus."
Das Mädchen hatte die Aussprache zwischen den Eltern gehört. Sie kam näher herzu und sprach: "Mutter, ich will die Stelle antreten, was soll sonst aus Vater und Fritz werden? Jeden Tag werde ich zum Hl. Geist um die Gabe der Stärke beten. In der Jungfrauen-Kongregation hat uns der Herr Präses erzählt, wie heldenmütige Frauen und Mädchen trotz aller Bedrängnisse und Versuchungen seitens ihrer verderbten Umgebung Tugend und Reinheit mit dem Beistand Gottes bewahrt haben. Werde ich nicht auch so starkmütig sein können?"
Die Augen des Vaters glänzten vor Freude über die Charakterfestigkeit des Kindes. Die Mutter gab nun auch ihre Zustimmung und sprach: "Bedenke, wie groß der Lohn sein wird, den dir Gott gibt, wenn du den guten Kampf kämpfst."
Anna kam in den Dienst der Frau Hiller.
"Hast du besondere Wünsche, Anna?" fragte sie.
"Jawohl."
"Und die wären? Gewiss hoher Lohn? Gutes Essen? Viele Geschenke?"
"Das alles nicht, nur will ich meine Pflichten als katholische Jungfrau unter allen Umständen erfüllen, sonst gehe ich sofort nach Hause. Die zweite Bedingung ist, dass mir keiner im Haus in irgend einer Weise eine unerlaubte Zumutung stellt, sonst gehe ich auch."
"Recht so", sagte Frau Hiller. In Gedanken aber lachte sie über solche läppische Einfalt, die wollte sie schon zahm machen.
Es war an einem Samstag im wonnesamen Maimonat, als Frau Hiller Anna rufen ließ und sprach: "Morgen früh musst du mich begleiten, wir fahren mit dem Auto, ich will meine Cousine besuchen. Die hat sich verlobt, reich, sage ich dir. Eine herrliche Tour."
"Wann kann ich denn die hl. Messe besuchen?"
"Das wirst du einmal wohl ausfallen lassen müssen. Du lieber Himmel, so schlimm wird das wohl nicht sein. Eine solch schöne Gelegenheit, ein reichliches Trinkgeld zu verdienen, wird sich dir so bald nicht wieder bieten."
"Ich bleibe hier", entgegnete Anna.
"Wenn ich es dir aber befehle."
"Denken Sie, bitte, an das mir gegebene Versprechen."
Frau Hiller war außer sich vor Zorn, eine solche Starrköpfigkeit war ja geradezu unerhört.
Am Sonntagmorgen tänzelte Herr Hiller, der Jüngere, heran, geschniegelt und gebügelt, um Anna den Hof zu machen.
"Sie haben wohl Langeweile, Fräulein Anna, gestatten wohl, dass ich Ihnen Gesellschaft leiste. Habe Ihnen auch ein kleines Geschenk mitgebracht." Dabei ließ er einen wertvollen goldenen Ring im Sonnenlicht blitzen und funkeln. Er setzte ganz bestimmt voraus, Anna würde das Geschenk nicht ablehnen. Sie aber besann sich nur einen kurzen Augenblick und sprach: ""Sie glauben wohl, einem armen Mädchen Fallstricke legen zu können, sei eine leichte Sache? Da irren Sie sich. Wenn Sie sich sogleich nicht aus dem Zimmer entfernen und den Ring wieder mitnehmen, so warte ich die Rückkehr Ihrer Mutter nicht ab, sondern begebe mich sofort zu meinen Eltern."
Im Gebet war das Mädchen starkmütig geworden und so überwand es siegreich jede sündhafte Einflüsterung.
Immer dachte sie an die schönen Worte des Kirchenliedes:
"Treib weit von uns des Feind`s Gewalt,
In deinem Frieden uns erhalt`,
Dass wir, geführt von deinem Licht,
In Sünd` und Leid verfallen nicht."
Nach und nach bekam Frau Hiller angesichts ihrem Wollen einen hohen Grad von Achtung dem Mädchen gegenüber, und allmählich kam sie auch zu der Überzeugung, dass in den schlammigen Niederungen des Lebens der Geist des Menschen, der Hauch Gottes, sein Glück nicht finden kann, sondern nur in dem Frieden, den der Hl. Geist am Pfingsttag der Welt gebracht hat.
________________________________________________________________________

10. Die Söhne des Rosenkreuzers - Nach den Aufzeichnungen eines Seminaristen von R. Pontis
Dem Drama, das ich hier erzähle, habe ich selbst beigewohnt. Die Kenntnis der Familienverhältnisse der darin auftretenden Personen habe ich teils aus den Zeitungen der letzten Jahre geschöpft, teils aus dem Mund des jungen Mannes vernommen, der das unschuldige Opfer des Dramas werden sollte.
1.
Herr Alassor war ein reicher, angesehener Fabrikbesitzer aus der Umgegend von Paris. Seit Jahren schon vertrat er das Seinedepartement im Senat, wo er stets mit der radikalen Partei für alle Maßregeln der Regierung gegen die Kirche und die Religion stimmte. Sooft eine Ministerkrise ausbrach, stand sein Name auf der Liste der Ministerkandidaten, doch war es ihm bisher nicht gelungen, in den Besitz eines Portefeuilles zu gelangen. Er tröstete sich aber mit der Hoffnung, dass die Reihe das nächste Mal an ihn kommen werde. Herr Alassor hatte um so mehr Aussicht, dereinst Minister zu werden, als er ein einflussreicher Freimaurer war. Schon lange besaß er den Grad eines Rosenkreuzers, der ihn berechtigte, eine rote Schärpe mit Goldverzierungen zu tragen, und ein rotes Schurzfell mit einem Kelch drauf, der mit einer sich in den Schweif beißenden Schlange umgeben war.
In seiner Konversation und in seinen Reden sprach er immer von den unsterblichen Prinzipien der glorreichen Revolution, vom Joch der Dogmen, von der Emanzipation der Geister, von Freiheit, Toleranz und Humanität, von Gerechtigkeit und dem religiösen Aberglauben, der mit seiner fabelhaften Ewigkeit das Volk verdumme. Alle Schlagwörter der Freimaurerei waren ihm gang und gäbe. Dass Herr Alassor sein Leben nach diesen Theorien einrichtete, ist selbstverständlich.
"Esst und trinkt und belustigt euch, solange es geht!" war sein Wahlspruch.
Herr Alassor war zweimal verheiratet. Seine erste Frau starb ein Jahr nach der Geburt eines Söhnleins, das er nach seinen eigenen Prinzipien erziehen ließ. Den schulpflichtigen Jungen schickte er in eine Anstalt, die im Ruf stand, nur Freidenker zu bilden. Nie wurde den Schülern von Gott und Religion gesprochen.
Als Karl zwölf Jahre alt war, nahm Herr Alassor eine zweite Frau. Diese war eine gar fromme Person und hatte den Witwer, der ihr als Freidenker bekannt war, nur unter der Bedingung geheiratet, dass er ihr die größte Freiheit in der Ausübung ihrer Religionspflichten gewähre und dem kleinen Karl, sowie ihren eigenen Kindern, wenn Gott ihnen welche schenken würde, eine christliche Erziehung gebe. Herr Alassor versprach alles, und sie wurden ein Paar.
Ein Wortbruch kostet den Freimaurern nicht viel. Das sollte die junge Frau Alassor bald erfahren. Trotz des Versprechens, der Erziehung seines Sohnes Karl eine andere Richtung zu geben, fuhr der Senator fort, ihn in dieselbe Schule zu schicken, die er bisher besucht hatte. Bald warf er ganz die Maske ab und gestand seiner Frau unumwunden ein, er sei ein Mitglied der Loge, und zwar ein Rosenkreuzer, folglich ein geschworener Feind der Religion, deren Vernichtung er nach Kräften anstrebe.
Aber die gute Frau war noch lange nicht am Ende ihrer Trübsal. Ein Jahr danach wurde sie Mutter eines Sohnes. Sie freute sich ungemein darüber, denn sie hoffte, der kleine Engel werde das Freundschaftsband, das sich zwischen ihr und ihrem Gemahl etwas gelockert hatte, wiederum befestigen. Ihre Hoffnung war von kurzer Dauer. Als sie einige Tage später von der Taufe des kleinen Ernst sprach, fuhr Herr Alassor auf:
"Zum Henker mit deiner Taufe! Er wird nicht getauft, er wird ohne Religion erzogen wie sein Bruder!"
Die arme Mutter traute ihren Ohren kaum.
"Und dein Versprechen", wandte sie schüchtern ein, "mir dessen Erziehung anzuvertrauen?"
"Ach was, das sind Dummheiten! Zu solchen Versprechungen sind wir Freimaurer nicht gebunden. Sogar der Gerichtseid hat keine bindende Kraft für uns. Nur dem Eid, den wir in der Loge ablegen, sind wir Gehorsam schuldig. Darum noch einmal, er wird nicht getauft! Das ist mein letztes Wort."
Da Frau Alassor nicht die Kraft in sich fühlte, ihrem Mann zu widerstehen, und andererseits auch wenig Hoffnung hatte, ihn zu besseren Gesinnungen zurückzuführen, traf sie Anstalten, das Kind im geheimen taufen zu lassen. Sie benutzte eine längere Reise ihres Gemahls ins Ausland, um den Jungen in die Pfarrkirche zu tragen, wo die heilige Handlung an ihm vollzogen wurde.
Als Herr Alassor von seiner Reise zurückkehrte und von seiner Frau die Taufe des Jungen erfuhr, geriet er außer Rand und Band, und es dauerte mehrere Monate, ehe er wieder ein Wort mit ihr sprach.
Der Junge wuchs unter der Aufsicht seiner Mutter heran. Trotz des Verbotes ihres Gemahls lehrte sie ihn die Gebete der Kirche, die er jeden Tag mit inniger Andacht verrichtete. Auch hatte sie sich im stillen vorgenommen, in der Frage der Erziehung nicht nachzugeben, und koste es was es wolle, ihm eine christliche Erziehung angedeihen zu lassen. Die Frage der Schule, in die er geschickt werden sollte, war bereits von den Eheleuten erörtert worden, doch unentschieden geblieben. Der Vater hatte dieselbe Anstalt vorgeschlagen, in der Karl studierte. Doch davon wollte die Mutter nichts wissen.
Eine Szene, die allen Streitigkeiten ein Ende machte und einen für beide unerwarteten Ausgang nahm, fand einige Tage danach zwischen den Eheleuten statt. Es war nach Tisch. Der kleine Ernst war in den Garten hinuntergegangen, um zu spielen.
"Die Frage der Erziehung", unterbrach Herr Alassor das Schweigen, das nach dem Hinausgehen des Jungen eingetreten war, "muss endlich gelöst werden. Ich habe den Direktor des Lyzeums von der Ankunft des kleinen Ernst benachrichtigt und ihm anempfohlen, ihn nach denselben Prinzipien zu erziehen wie seinen Bruder. Ich ersuche dich daher, seine Wäsche und Kleider für nächste Woche bereit zu halten, damit er die ersten Lektionen nicht versäume."
"Und ich will nicht, dass er in eine Staatsschule eintrete, wo er mit Leib und Seele verdorben wird. Entweder geht er in eine katholische Schule, oder er geht in gar keine", erwiderte Frau Alassor mit fester Stimme.
"Das schlag` dir nur aus dem Sinn. Ich habe für die Neutralität der Schule im Senat gestimmt und kann ihn unmöglich in eine konfessionelle Schule schicken. Was würden meine Wähler und meine Kollegen dazu sagen?"
"Und erst deine Brüder vom Großorient?" unterbrach ihn seine Frau ironisch.
"Ich würde an den Schandpfahl genagelt werden. Ich will nicht, dass mein Sohn seine Zeit mit dem Studium dieser Fabeln vergeude, die man Religion nennt, er soll ein freier, unabhängiger Mann werden wie Karl."
"Es gibt vielleicht einen Ausweg", wandte Frau Alassor nach einigen Minuten des Schweigens ein. "Wie wäre es, wenn wir ihn hier zu Hause behielten und ihn von einem Lehrer unter meiner Leitung unterrichten ließen?"
"Auch daraus wird nichts", widersprach Herr Alassor mit heftigem Ton. "Das würde bald ruchbar werden und mir die nämlichen Unannehmlichkeiten zuziehen. Ich bleibe dabei: der Junge geht ins Lyzeum, du hast dich nur zu fügen oder dein Bündel zu schnüren und in deine Heimat zurückzukehren."
"Das wäre mein sehnlichster Wunsch. Wisse aber, eine Mutter geht nicht ohne ihr Kind. Wenn ich abreise, nehme ich den Jungen mit."
Herr Alassor dachte einige Augenblicke nach. Sein Gesicht nahm einen freundlicheren Ausdruck an. "Nun meinetwegen", sagte er dann mit ruhiger Stimme, "um all den Szenen ein für allemal ein Ende zu machen, so nimm den Jungen und geh` mit ihm, wohin du willst. Lass ihn nach deinen Ideen erziehen, nur darf niemand erfahren, dass er der Sohn des Senators und Rosenkreuzers Alassor ist."
Er stand auf und verließ den Saal.
Aus Furcht, sein Entschluss möchte ihn gereuen, packte Frau Alassor noch an demselben Nachmittag ihre notwendigsten Sachen zusammen und fuhr mit dem Jungen zum Bahnhof. Hier löste sie zwei Fahrkarten nach Tours, wo sich ihr väterliches Gut befand, das ihr eine jährliche Rente von 12.000 Franken abwarf und von einem Vertrauensmann verwaltet wurde. Diesem gab sie die notwendigen Unterweisungen, wohin er fürderhin ihre Rente zu schicken habe. Besonders empfahl sie ihm, keinen Menschen, auch ihrem Mann nicht, ihre Adresse zu geben, doch solle er alle Briefe, die ihr hierhergeschickt würden, an ihre neue Adresse weiterbefördern. Sie schrieb noch in aller Eile einen Brief an ihren Gemahl, in dem sie ihm mitteilte, sie ziehe sich aufs Land zurück, um sich ausschließlich mit der Erziehung ihres Sohnes zu beschäftigen, und damit kein Mensch die Wahrheit erführe, nehme sie ihren Mädchennamen wieder an und lasse den Jungen unter dem Namen Augustini studieren.
Am selben Abend reiste sie nach der kleinen Stadt Laroche, wo sich eine berühmte, von Ordensleuten geleitete Schulanstalt befand. Hier angekommen, mietete sie eine außerhalb der Stadt gelegene Villa und vertraute den Patres die Erziehung ihres Sohnes an.
2.
Karl hatte seine Gymnasialstudien beendet und wollte in die höhere Staatsverwaltung eintreten. Er studierte daher die Rechte, wenn man den Besuch der Theater, der Bälle, der Rennbahn, der Kaffeehäuser und hier und da das Anhören einer Vorlesung auf der Universität studieren nennen kann. Dank seines lebhaften Geistes und auch dank des Einflusses seines Vaters, der seit einigen Monaten Minister war, bestand er sein Examen und wurde Lizentiat der Rechtswissenschaft. Um ihn in die Geheimnisse der hohen Verwaltung einzuweihen, nahm sein Vater ihn zu sich ins Ministerium, wo er als Generalsekretär tätig war. In Abwesenheit seines Vaters empfing er selbst die Bittsteller aller Art, die den Schutz und den Einfluss des mächtigen Ministers für ihre Unternehmungen nachsuchten. Natürlich ließ er sich seine Mühe auf eine ganz diskrete Art vergüten, einerseits um seine Einkünfte zu vermehren und so auf größerem Fuß leben zu können, und andererseits auch, weil es so Brauch in der hohen französischen Verwaltung ist. Man munkelte sogar, er verkaufe das Kreuz der Ehrenlegion, und dieser Handel bringe ihm jedes Jahr mindestens hunderttausend Franken ein. Das ist immerhin möglich, denn nie war die Zahl der eitlen Gecken und Narren, die eine Dekoration nachsuchen, so groß wie in unserer Zeit der Aufklärung und des Fortschritts. Dem Vater war dieser Handel bekannt, doch drückte er die Augen dabei zu. Nur forderte er seinen Sohn auf, recht vorsichtig zu sein.
Den Leuten, die nach seiner Frau fragten, erklärte der Minister, sie sei auf Anraten der Ärzte mit ihrem Sohn, der an einer Nervenkrankheit leide, nach Neuseeland gereist. Das Klima dieser Insel sei dem Jungen recht heilsam, und er werde wohl bald wieder hergestellt sein.
Nach vierjähriger Tätigkeit fiel das Ministerium, und Vater und Sohn verließen den Staatspalast, wo sie so lange Zeit unumschränkt geherrscht hatten. Einige Monate danach wurde Karl zum Unterpräfekten von Villefort, einer kleinen Garnisonstadt Zentralfrankreichs, ernannt und mit der Austreibung der Kongreganisten betraut, die einige blühende Klöster und Schulen in diesem Bezirk besaßen. Darunter befand sich auch die Schulanstalt, in der sein Bruder eben seinen Studien oblag.
Ernst war zu einem frommen, talentvollen und geistreichen jungen Mann herangewachsen und berechtigte zu den kühnsten Hoffnungen. Er war mein bester Freund und hatte kein Geheimnis vor mir. Kürzlich noch sagte er zu mir:
"Mein sehnlichster Wunsch wäre es, mein Blut für unseren heiligen Glauben zu vergießen. Auch treibt es mich an, ein Diener des Herrn, und zwar ein Missionar zu werden, und nach China und Afrika auszuwandern."
Leider war seine Mutter bald nach ihrer Ankunft nach Laroche von einer heimtückischen Krankheit befallen worden. Sie siechte dahin, und als Ernst sechzehn Jahre alt war, schlummerte sie in ein besseres Jenseits hinüber. Ihr Tod war ein harter Schlag für den jungen Mann, doch fand er in seiner Tante, die schon seit einem Jahr herbeigeeilt war, um ihre Schwester zu pflegen, eine zweite Mutter. Ihr Gemahl, Herr Blaise, ein tüchtiger Rechtsanwalt, wohnte in Tours. Die Patres ihrerseits verdoppelten die Zuneigung, die sie dem hoffnungsvollen jungen Mann schenkten, damit er den so herben Verlust weniger fühlen möge.
Herr Alassor wurde von Herrn Blaise von dem Tod seiner Frau und von ihren testamentarischen Bestimmungen, gemäß derer ihr Sohn seine Studien zu Laroche unter der Vormundschaft seines Onkels vollenden sollte, in Kenntnis gesetzt. Der Senator, der seit der Trennung von seiner Frau sich gar nicht mehr um sie, noch um seinen Sohn bekümmert hatte, gab seine Einwilligung, und das um so lieber, als die Senatswahlen vor der Tür standen und ein Bekanntwerden seiner Familienverhältnisse womöglich seine politische Stellung hätte gefährden können. Er hielt es sogar nicht der Mühe wert, den Unterpräfekten, seinen ältesten Sohn, von dem Hinscheiden seiner Stiefmutter in Kenntnis zu setzen, denn nie hatte sich dieser herzlose und selbstsüchtige Mensch nach ihr und seinem Bruder, die er als Eindringlinge in das väterliche Haus betrachtet hatte, erkundigt.
Ernst bereitete sich eben auf sein Maturitätsexamen vor, als die Patres den Befehl erhielten, ihre Schüler zu entlassen und dem Liquidator die Schlüssel ihrer Anstalt einzuhändigen. Die Patres, die die rechtmäßigen Eigentümer der Schule waren, beschlossen, nur der Gewalt zu weichen. Sie setzten die Eingänge in Verteidigungszustand, um den Obrigkeiten solange als möglich den Eintritt zu wehren. Dazu gingen ihnen die Einwohner der Stadt, die ihnen herzlich zugetan waren, bereitwillig zur Hand. Die Patres, denen die meisten ihre Erziehung verdankten, hatten sich die Zuneigung und Achtung aller erworben. Außerdem war ihre Schulanstalt eine Quelle des Reichtums für die Stadt, deren Lokalhandel ihr jährlich an die 100.000 Franken eintrug.
Die jungen Männer der Stadt hatten eine Garde gebildet, die Tag und Nacht Wache hielt, damit die Schule nicht unversehens überrumpelt werde. Als sie endlich durch ihre Kundschafter der nahegelegenen Stadt Villefort die Mobilmachung mehrerer Kompagnien Infanterie und einer Schwadron Husaren für den folgenden Morgen erfuhren, verbarrikadierten sie alle Straßen, die zur Schule führten. Gegen 6 Uhr morgens verkündeten die ausgestellten Vorposten die Ankunft der Sturmkolonne. Sogleich wurden die Glocken geläutet, und die männliche Bevölkerung verschanzte sich hinter die Barrikaden oder schlossen sich in die Schule selbst ein, um dort den Truppen den Eingang streitig zu machen.
Unterdessen hatte die Sturmkolonne ihren Einzug in die Stadt gehalten. An ihrer Spitze marschierten der Unterpräfekt Alassor, der Staatsanwalt und der Polizeikommissar. Neben ihnen ritt der Kommandant.
"Da haben Sie Arbeit", wandte sich der Unterpräfekt lachend zu dem Offizier, als sie auf die erste Barrikade stießen. "Lassen Sie sie stürmen!"
Der Kommandant ritt an die Barrikaden heran, und nachdem er sie in Augenschein genommen hatte, befahl er den Soldaten, sie einfach wegzuräumen, denn sie bestand aus Pflastersteinen, die man mehrere Meter hoch aufeinander gehäuft hatte.
Von den zwei anderen zur Schule führenden Straßen war die eine mit Wagen, Karren, Pflügen, Eggen und sonstigem Ackergerät, das man mit dickem Eisendraht zusammengebunden hatte, und die andere mit Balken und Baumstämmen gesperrt. Gegen 9 Uhr waren sämtliche Barrikaden aus dem Weg geräumt, und unter dem Schutz der Truppen traten die Obrigkeiten an das verrammelte Tor. Im Namen des Gesetzes verlangte der Unterpräfekt Eintritt in die Schule und freiwillige Übergabe der Gebäulichkeiten.
"Im Namen des Eigentumsrechtes verweigere ich die Übergabe einer Schule, die mir von meinen Vorgesetzten anvertraut worden ist", antwortete der P. Rektor, den man herbeigeholt hatte.
"Dann werden wir Gewalt brauchen, doch muss ich Ihnen erklären, dass Sie sich einer gerichtlichen Verfolgung aussetzen, wenn Sie meiner Aufforderung nicht Folge leisten."
"Tun Sie, was Ihres Amtes ist", erwiderte der P. Rektor, indem er sich zurückzog.
Zu gleicher Zeit erscholl der vieltausendstimmige Ruf:
"Nieder mit den Einbrechern" Nieder mit den Dieben!"
Der Unterpräfekt war bleich geworden. Er hatte keinen solchen Empfang erwartet. Er forderte sogleich den Kommandanten auf, den Truppen den Befehl zu geben, das Tor einzuschlagen. Dieses bestand aus dicken Eichenbohlen und war mit schweren Eisenstangen beschlagen. Es dauerte volle 2 Stunden, ehe es den Soldaten gelang, einen Flügel davon zu zertrümmern. Als er krachend zu Boden fiel, befanden sich die Truppen vor einer Barrikade, die sie Stück für Stück abreißen mussten, ehe es ihnen gelang, den Eingang in den Hof freizumachen.
Auf Befehl des Rektors durfte kein Schüler an der Verteidigung teilnehmen. Alle waren in den Park geführt worden, wo sie unter der Aufsicht ihrer Lehrer ihren gewöhnlichen Studien oblagen. Zu diesem Zweck hatte man die Schulbänke in den Alleen des Parks aufgestellt.
Ich stand an einem geöffneten Fenster des ersten Stocks, wo ich alle Phasen der Belagerung gesehen habe. Als Seminarist durfte ich nicht an der Verteidigung teilnehmen. Meine Eltern wohnten in der Stadt. Ich hatte bei den Patres studiert und war herbeigeeilt, um ihnen meine Sympathie in den gegenwärtigen schmerzlichen Zeiten zu bezeugen.
Gegen elf Uhr kam Augustini mit Erlaubnis seines Lehrers in den Saal, in dem ich mich befand, um ein Buch zu holen. Er kannte seinen Bruder nicht, den Unterpräfekten, und wusste nicht einmal, dass er es war, der die Expedition gegen die Schule befehligte. Ich winkte ihn zu mir ans Fenster, um einige Worte mit ihm auszutauschen.
In diesem Augenblick trat der Unterpräfekt, der sich seit einiger Zeit im Hof befand, einige Schritte vor, um mit den Verteidigern zu unterhandeln. Weit entfernt, auf seine Worte zu hören, gingen diese vielmehr wie auf Kommando allesamt miteinander gegen ihn vor. In der Meinung, man wolle ihn umringen und gefangen nehmen, oder ihn hinterlistig anfallen, riss er seinen Revolver aus der Tasche und schoss ihn auf die Reihen der Vorgehenden ab. Keiner von ihnen wurde getroffen. Doch mit den Worten: "O Gott!" brach der junge Augustini neben mir zusammen. Ein Seufzer noch, und er war eine Leiche. Die Kugel war ihm mitten durch das Herz gegangen.
Hatte der Unterpräfekt, wie er später aussagte, in die Luft schießen wollen, um seine Angreifer abzuschrecken, oder hatte er in der Eile einfach nur schlecht gezielt? Niemand weiß es.
Ich hob den Unglücklichen auf und trug ihn auf ein Bett des nahen Schlafsaales. Schnell eilte ich dann hinunter, um den P. Rektor von dem Geschehenen zu unterrichten.
Die Soldaten hatten unterdessen Ordre erhalten, zu stürmen. Dreimal stürzten sie sich auf die Reihen der braven Männer, dreimal wurden sie zurückgeworfen. Beim vierten Anlauf erst gelang es ihnen, die Treppe zu nehmen und in die Schule einzudringen. Durch den Tod des jungen Augustini, der sich blitzschnell in der Anstalt verbreitet hatte, wütend gemacht, schlossen sich die Verteidiger gruppenweise in den verschiedenen Sälen ein, wo sie fortfuhren, den Angreifern zu widerstehen. Erst gegen fünf Uhr abends waren die Truppen Meister der Schule. Die Patres, die Schüler und die Verteidiger hatten das Gebäude verlassen und sich in die Stadt zurückgezogen. Letztere zählten 35 Verwundete, außerdem waren ihrer an die 20 gefangen genommen worden.
Im Hof lagerten die Soldaten. Sie freuten sich ihres Sieges und sangen die Marseillaise.
In der Kapelle der Schule auf einem Ruhebett lag die Leiche des unglücklichen Augustini. Er schien zu schlafen. In seinen gefalteten Händen hielt er ein Kruzifix. Auf seinem bleichen Antlitz lag Ruhe und Frieden ausgebreitet. Sein Wunsch war in Erfüllung gegangen, und zwar schneller als er gedacht hatte. Er brauchte nicht nach China auszuwandern, um für seinen Glauben getötet zu werden. Er fiel in seinem eigenen Vaterland, ein Opfer der Katholikenverfolgung, das Werk der internationalen Freimaurerei. Ringsumher knieten die Patres und einige Mitschüler. Sie beteten nicht für den Märtyrer, wie der P. Rektor sich ausdrückte, - er bedurfte keines Gebetes - sondern für den Mörder und ihre Verfolger.
Die Erstürmung der Schule von Laroche und der Brudermord riefen im ganzen Land eine ungeheure Aufregung hervor. Der Unterpräfekt wurde in der Folge seines Amtes entsetzt und als Gouverneur in eine entfernte Kolonie Afrikas geschickt. Bevor er Paris verließ, hatte er eine Unterredung mit seinem Vater. Was zwischen beiden Männern gesagt wurde, ist nicht bekannt. Nur eine Zeitung behauptete, sie hätten sich gegenseitig die bittersten Vorwürfe gemacht. Der Vater stellte seine Kandidatur als Senator nicht mehr auf. Er verkaufte seine Fabrik und sein Haus in Paris und ging auf Reisen.
* * *
Vor einem Monat befand ich mich in einer Gesellschaft, wo von dem ehemaligen Senator und Minister die Rede war.
"Er ist gänzlich verschwunden", meinte eine Dame, "kein Mensch weiß, was aus ihm geworden ist."
"Mit Verlaub", erwiderte ein Herr, "vergangenen Winter war ich in Rom. Dort traf ich zweimal mit Herrn Alassor, dem Rosenkreuzer, zusammen. Das erste Mal sah ich ihn im Kolosseum in tiefes Nachdenken versunken auf einem Stein sitzen. Ich machte eine Bewegung, um mich ihm zu nähern und mit ihm zu sprechen, doch wandte er das Haupt nach einer anderen Seite. Eine Woche danach bemerkte ich ihn in der Peterskirche neben einem französischen Beichtstuhl knien und beten."
"Das Blut der Märtyrer", schloss tiefsinnig ein Priester, "ist und bleibt immer eine große Gnadenquelle der Bekehrung für die sündige Menschheit."
________________________________________________________________________

Raffael: Messe von Bolsena
11. Das Wunder von Bolsena - Von Stephardt
Im mittleren Italien, nicht weit von Orvieto entfernt, liegt ein Städtchen mit Namen Bolsena. Dieses Städtchen wäre wohl kaum über die Grenzen der apenninischen Halbinsel hinaus bekannt geworden, wäre nicht in seinen Mauern ein Wunder geschehen, dessen Ruf sich bald in die entlegensten Länder verbreitete, wodurch der Name des Städtchens unvergesslich wurde.
Es war im Jahr 1263, als ein Priester aus Deutschland sich anschickte, eine Wallfahrt nach Rom zu machen. Er wollte die in der damaligen Zeit noch sehr schwierige Reise unternehmen, um am Grab der heiligen Apostelfürsten Erlösung aus seiner Seelennot zu finden, um dort zu beten und den lieben Gott zu bitten, er möge ihn auf die Fürbitte der heiligen Apostel Petrus und Paulus von den furchtbaren Zweifeln befreien, die seine Seele seit längerer Zeit schon so sehr ängstigten und in fast ständige Unruhe versetzten. Es kam ihm nämlich bei der Darbringung des heiligen Opfers der Gedanke, ob es auch wirklich möglich sei, dass Jesus Christus nach der heiligen Wandlung in seiner Wesenheit unter den Gestalten von Brot und Wein wirklich zugegen sei, oder ob dies nur eine fromme Mutmaßung enthalte ohne jede Wirklichkeit. Der Priester kämpfte mutig gegen diese Versuchung. Oft und oft wiederholte er sich das Wort des Herrn: "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben", ja er sagte es sich fast stündlich, dass Jesu Wort: "Dies ist mein Leib! Dies ist mein Blut!" ihm doch genügen könnte; allein die schwarzen Zweifel wollten nicht aus seiner Seele weichen, sie peinigten ihn mit einer Heftigkeit, dass er sich nicht zu helfen wusste und Gefahr lief, sein Herz durch Einwilligung und Zustimmung mit einer schweren Sünde zu beflecken. In dieser seiner großen Seelennot entschloss er sich zu einer Wallfahrt nach Rom, um dort, wo es fast kein Fleckchen Erde gibt, das nicht getränkt wäre mit dem Blut jener, die für das Bekenntnis des heiligen Glaubens ihr Leben hingaben, neue Glaubenskraft zu schöpfen.
Der priesterliche Pilger gelangte glücklich nach Mittelitalien, wo er in der Nähe von Orvieto in dem oben genannten Städtchen Bolsena übernachtete. Am anderen Morgen brachte er in der Kirche des Städtchens das heilige Messopfer dar. Dabei erfassten ihn an diesem Tag mehr denn je die Zweifel an die Gegenwart Jesu im allerheiligsten Altarsakrament. Immer und immer wieder kam ihm die Frage in den Sinn, ob Jesus wirklich und wahrhaft, mit Gottheit und Menschheit, mit Fleisch und Blut, Leib und Seele zugegen sei, oder ob dies alles doch nur als eine fromme Meinung zu gelten habe, der die Wirklichkeit nicht ganz entspricht. Dann sagte sich der Priester wohl: "Ich glaube an Gottes Wort. Wie konnte Jesus sagen: Dies ist mein Leib! wenn es nicht sein Leib wäre? Ein Lügen und Trügen musste doch ausgeschlossen sein, da Jesus Gott ist und als Gott nichts Falsches sagen kann. Gab es in der hebräischen Sprache nicht so viele Ausdrücke, die besagen, dies bedeute nur den Leib Christi? Nach den heiligen Evangelien aber wählt Jesus keines dieser Worte, die von bloßem Bedeuten sprechen, sondern er gebraucht das eine Wort, das besagt, dass es wirklich so ist." So suchte der Priester die Versuchung zu überwinden und sich zu trösten. Doch wieder und wieder kam es, wie wohl Thomas einst gesprochen, als seine Mitapostel ihm erzählten, sie hätten den Herrn gesehen, der von den Toten auferstanden sei. "Schauen möchte ich, schauen nur ein einziges Mal einen Tropfen seines heiligen Blutes. Wenn es mir schon nicht vergönnt ist, meinen Finger zu legen in seine Seitenwunde und an seinen Händen und Füßen das Mal der Nägel zu sehen, so möchte ich doch schauen einen Tropfen seines heiligsten Blutes, um zu wissen, dass ich nicht vergebens geglaubt habe, dass nach der heiligen Wandlung auf dem Altar nicht mehr Brot und Wein, sondern Christi Fleisch und Blut ist."
Die heilige Wandlung kam und ging vorüber. Der Priester betete mit ausgebreiteten Händen das Pater noster und nahm dann die heilige Hostie, um sie vor dem Pax Domini sit semper vobiscum über dem Kelch zu brechen. Selbst in diesem Augenblick nahten die dunklen Zweifel seiner Seele, die sofort in heißem Flehen zum lieben Heiland um Hilfe rief.
Da, was war das? Aus dem Antlitz des Geistlichen wich jeder Blutstropfen und seine Hände zitterten; denn er sah, wie die Brotsgestalten sich plötzlich veränderten und zu wahrem, wirklichem Fleisch wurden. Aus ihm aber floss helles Blut, das tropfenweise in den Kelch und auf das Korporale fiel. Die Verwirrung des Priesters, sein Schrecken und sein Staunen waren, wie sich leicht denken lässt, groß, ja grenzenlos. In seiner Angst und Verwirrung ließ er die heilige Hostie den zitternden Händen entfallen und legte dann das Korporale zusammen, um die heilige Hostie zugleich mit den frischen Blutstropfen zu verbergen. Allein das Wunder hatte noch kein Ende. Unter den Augen des erschrockenen Priesters wurde es noch größer. Wohin ein Tropfen des heiligen Blutes gefallen war, zeigte sich das Antlitz des leidenden Heilands, mit Blut überronnen, mit der Dornenkrone umkränzt.
Der Priester stand still und seine Augen blickten in heiligem Schrecken auf das Wunder. Er vermochte es nicht über sich zu bringen, die heilige Messe fortzusetzen und zu vollenden, Zitternd nahm er Kelch und Korporale, um beides in die Sakristei zu bringen. Auf dem Weg dorthin fielen, der Überlieferung gemäß, noch einige Blutstropfen zur Erde und benetzten fünf Marmorsteine des Fußbodens. Nachdem er Priester in der Sakristei alles an einen sicheren und geziemenden Ort gebracht hatte, machte er sich sogleich auf den Weg nach Orvieto, wo damals zufällig der Heilige Vater, Papst Urban IV., weilte. In Orvieto bat der Priester um eine Audienz beim Papst, und als sie ihm sofort gewährt wurde, warf er sich dem Stellvertreter Christi demütig zu Füßen, erzählte das staunenerregende Wunder, bekannte seine großen Zweifel und bat, von tiefster Reue bewegt, um Verzeihung und Lossprechung.
Der Papst tröstete den Priester wie ein liebevoller Vater der mit dem Sohn, der gefehlt hat, liebevoll und ernst zugleich spricht. Dann trug er dem Bischof von Orvieto auf, sich sofort nach Bolsena zu begeben, die Sache dort genau und gewissenhaft zu untersuchen, und, falls sich alles wirklich so verhalte, wie erzählt worden war, das Korporale mit den wunderbaren Blutstropfen nach Orvieto zu bringen. Der Bischof kam diesem Auftrag sofort nach. Er ging nach Bolsena und fand dort alles so, wie der Priester es berichtet hatte. Voll Staunen und Demut nahm er das Korporale, ausgezeichnet mit dem wunderbaren Bildnis des Christusantlitzes, um es dem Wunsch des Papstes gemäß nach der Bischofsstadt zu bringen. Alle Einwohner von Bolsena schlossen sich dem Oberhirten an und begleiteten die kostbare Reliquie in feierlicher Prozession nach Orvieto. Als man dort erfuhr, was sich zugetragen hatte, zog eine große Prozession, vom Papst selbst geführt, hinaus vor die Tore der Stadt, um das Wunderzeichen würdig zu empfangen. Der Heilige Vater empfing kniend vom Bischof das Korporale und trug es dann unter Weinen, Beten und Singen einer unabsehbaren Menschenschar in die Domkirche zu Orvieto. Dort musste es sofort ausgestellt werden, um der Andacht der Gläubigen zu genügen. Dann wurde es in einen kostbaren silbernen Reliquienschrein gefasst und zur immerwährenden Verehrung ausgestellt. Noch heute ist das heilige Zeichen zu sehen. Wer in den Dom von Orvieto kommt, kann das wunderbare Korporale schauen, auf dem noch jetzt nach so vielen Jahren die Spuren des Wunders bemerkbar sind.
Die wunderbare Begebenheit bei der heiligen Messe zu Bolsena bewog Papst Urban IV., seine letzten Bedenken gegen die allgemeine Einführung des heiligen Fronleichnamsfestes und wie es bereits in der Diözese Lüttich (Belgien) gefeiert wurde, aufzugeben und mit Eifer an die Einführung des hochheiligen Festes zu denken. So hat das Wunder von Bolsena viel dazu beigetragen, dass heute das heilige Fronleichnamsfest auf dem ganzen katholischen Erdkreis gefeiert wird. Die Nachricht von dem Wunder wurde uns in Schriften und Gemälden überliefert. Die berühmteste Darstellung befindet sich zu Rom in den Stanzen des Vatikans. Der Fürst der Malerei Raphael Sanzio war es, der das herrliche Gemälde in den Jahren 1512-1514 geschaffen.
Möge unser Glaube an die wirkliche Gegenwart Jesu im allerheiligsten Sakrament nie wanken. Des Herrn Wort: "Dies ist mein Leib! Dies ist mein Blut!" gibt uns die sicherste Bürgschaft dafür, dass es wirklich so ist, dass kein Zweifel sein darf; denn Jesus Christus, Gottes Sohn, die ewige Wahrheit selbst, kann nicht irren und nicht irreführen. Und wenn das irdische Auge es auch nicht sieht: "Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!"
________________________________________________________________________

12. Ein treuer Hirte
Vor einigen Jahren kam an eine Pfarre unweit Paris ein neuer Pfarrer. Er war ein hochgewachsener Mann mit militärischem Benehmen, feurigem Blick und schwarzen Haaren. Er diente einst im Heer "Don Carlos" in Spanien, wurde zu wiederholten Malen verwundet, musste das kampflustige Heer verlassen, auch die teure Heimat und gesellte sich dem friedfertigen Heer bei, das da für eine schönere, ewige Heimat kämpft: für den Himmel. Mit seiner ganzen Seele und mit allen übriggebliebenen Kräften seines leidenden Körpers widmete er sich seinem neuen Beruf.
In der ersten Zeit ging er wohl traurig umher, sah oft sehnsüchtig nach der Richtung, in der das von Gott gesegnete, durch die Menschen aber zerrüttete Spanien liegt, - seine schöne Heimat, oder er saß mit geneigtem Haupt da, als wolle er lauschen, ob er nicht den Donner der Kanonen seines Königs Don Karlos vernehmen wird. Dann bedeckte er oft mit den weißen Händen das bleiche Gesicht, seiner Brust entrang sich ein tiefer Seufzer.
Wenn er aber am Sonntag die Kanzel bestieg, da verschwand aller Schmerz, alle Trauer, er stand da gerade wie ein Soldat, hob den Kopf empor und schleuderte um sich mit dem Blitz des Geistes der Wahrheit. Dann glänzten seine Augen, die Haare flogen vor Begeisterung wie schwarze Wolken um die schneeweiße Stirn - und das versammelte Volk stand wie bezaubert da: jedes Auge hing mit kindlicher Ergebenheit an seinem Mund.
Die Zuhörer, wenn sie die Kirche verließen, plauderten nicht, kritisierten nicht - sie glaubten, und wenn sie den Pfarrer sahen, verneigten sie ehrfurchtsvoll den Kopf.
In kurzer Zeit war er den Kindern ein Vater, den Erwachsenen ein Beispiel, den Unglücklichen Trost, den Schwachen Stütze, den Armen Wohltäter, den Kranken Engel und allen Freund.
Die Flamme greift um sich nach allen Seiten und entzündet alles, was nicht Felsen oder harter Boden ist. So entflammte auch der Pfarrer, der in der Liebe zu Gott und dem Nächsten aufging, seine ganze Pfarre mit derselben Glut, und der Erfolg erfreute und beseligte ihn so, dass er sein schönes Spanien vergaß.
Er war zufrieden, ja glücklich - nur eines betrübte ihn.
In der Nähe des Pfarrhauses stand mitten in einem großen Park ein Landgut. Hier wohnte ein ältlicher, lediger Abenteurer, der sich lange Jahre in der Welt herumgetrieben hatte, bis er sich zuletzt hier niederließ, um in Stille seine alten Tage zu verbringen. Seine verwitwete Schwester führte ihm die Wirtschaft.
Dieser Abenteurer - man nannte ihn allgemein "Kapitän" - verursachte dem Pfarrer manche bittere Stunde. Er war zwar maßvoll, gutmütig - aber bis jetzt hat ihn noch niemand in der Kirche gesehen, noch weniger im Beichtstuhl. Ja, früher spottete er sogar manchmal öffentlich über solche Dinge. Freilich von der Zeit an, wo der neue Pfarrer hierhergekommen war, vermied der Kapitän solche Reden aus Schonung und Verehrung zu dem Geistlichen, den er aus ganzem Herzen hochschätzte; aber seine Ansichten vom Glauben änderte er nicht, obwohl der Pfarrer öfter das Gespräch mit ihm gern auf dieses Thema gelenkt hätte, - er blieb verstockt und kalt wie ein Stein. Ja, er war der Felsen und der harte Boden, die der eifrige Pfarrer nicht zu entflammen vermochte. Das schmerzte den Pfarrer, die sonst so aufrichtige, gute Seele tat ihm leid.
Sonst war der Pfarrer, wie gesagt, ganz glücklich und arbeitete wie ein sorgsamer Gärtner, der jedes einzelne Blümchen hegt und pflegt. Aber es dauerte nicht lange. Der Wille war zwar gut, aber der Körper war schwach und krank.
Die alten Wunden aus seiner Militärzeit verzehrten seine Kräfte. Als der zweite Frühling herankam und alles grünte, auflebte und aufblühte, verwelkte der Pfarrer und rüstete sich zum Tod.
Eines Tages ließ er sich den Schreiner rufen. Der Schreiner kam und küsste ihm die Hand: "Was befehlen Hochwürden?"
Der Pfarrer saß krank in seinem Lehnstuhl. Es war traurig, ihn anzusehen. Die schwarzen, dichten Locken umrahmten seine hohe Stirn, die großen, hellen Augen glänzten unter den buschigen Brauen hervor - aber das Gesicht war abgezehrt und bleich wie bei einem Toten. Er reichte dem Tischler die magere, weiße Hand, lächelte still und freundlich und sagte: "Lieber Meister, haben Sie Vorrat an Särgen?"
"Wohl. Was wünschen Sie?"
Mit Mühe richtete sich der Pfarrer auf, stellte sich mit dem Rücken an die Wand, hob die Hand über den Kopf und bezeichnete mit dem Finger einen Punkt in der Wand. "Hier machen Sie ein Zeichen, lieber Meister, und messen Sie die Höhe!"
Der Tischler blieb erschrocken stehen: "Herr Pfarrer, wollen Sie gar - -?"
"Messen Sie die Höhe!"
Der Tischler nahm den Maßstab heraus und maß. "Ein Meter und 87 Zentimeter."
"Gut, machen Sie mir einen so langen Sarg. Dürfte aber noch länger sein - vielleicht zwei Meter."
"Aber, Herr Pfarrer - -."
"Nun, ist schon gut! Sehen Sie denn nicht, dass ich schon reif bin, freilich vor der Zeit, aber reif doch! Ich muss sorgen um die letzte Ruhestätte."
Dem Schreiner traten Tränen in die Augen. Weinend ging er heim.
Dann schrieb der Pfarrer an den Bischof und bat um einen Hilfspriester. Der Priester kam. Der Pfarrer stellte ihn den Pfarrkindern vor und nahm von ihnen vom Altar aus Abschied. Alles weinte, alles war traurig, unsäglich traurig.
Und als alles blühte, lag der Pfarrer im Bett und der Hilfspriester ging mit dem Allerheiligsten aus der Kirche zum Pfarrhof. Vor ihm her klingelte der Mesner. Der Pfarrhof war von Leuten wie belagert. Alles kniete und weinte.
Nur der Pfarrer lag ruhig da und betete. Als er die Sterbesakramente empfangen hatte, sah er mit langem Blick den Sarg an, den er sich samt dem Bahrtuch ins Zimmer hatte bringen lassen, und flüsterte: "Nunc dimittis servum tuum, Domine - Nun entlässt du, Herr, deinen Diener im Frieden!"
Doch der Herr entließ ihn noch nicht: seine Stunde war noch nicht da.
Es wurde Abend, Sterne tauchten auf, das Abendglöcklein ertönte.
Der Pfarrer lag immer noch ruhig da und betete beständig.
Es kam Mitternacht. Vor dem Haus rasselte ein Wagen; man zog an der Hausglocke. Die Magd öffnete. In das Zimmer trat die Schwester des Kapitäns, ganz verweint, und sank bei dem Bett des Pfarrers auf die Knie.
Der Pfarrer reichte ihr die Hand und fragte: "Warum weinen Sie?"
"Ach, Hochwürden! Mein Bruder wurde plötzlich krank, sterbenskrank, und niemand in der Welt kann ihn überreden, dass er sich versehen lässt - außer Sie - und Sie, mein Gott! Sie sind selbst - -."
Der Pfarrer seufzte und faltete die Hände. Nach einer Weile sagte er: "Ist doch der Hilfspriester da!"
Die Schwester des Kapitäns schüttelte den Kopf: "Den kennt er nicht und lässt sich von ihm auch nichts sagen - am Ende würde er ihn noch wegjagen."
Der Pfarrer warf einen Blick auf das Kreuz an der Wand und flüsterte: "Lieber Heiland, nur noch diese Nacht!" Dann wandte er sich nach der Magd und sagte ihr: "Holen Sie den Hilfspriester!"
Der Hilfspriester kam.
"Bitte gehen Sie in die Kirche", sagte der Pfarrer, "und bringen Sie das Allerheiligste hierher, wir werden zusammen zum Versehen fahren. Bringen Sie meine Kleider her!" sagte er dann zu der Magd.
Der Hilfspriester und die Magd waren starr vor Entsetzen.
"Tut, wie ich gesagt habe!" befahl der Pfarrer fast streng. "Mich ruft die Pflicht."
Beide gehorchten. Der Pfarrer schien neue Kraft geschöpft zu haben. Der schwache, sterbende Körper gehorchte dem Geist.
Man setzte ihn in den Wagen und der Hilfspriester setzte sich mit dem Allerheiligsten zu ihm.
Die Mainacht war lieblich und warm. Hoch am Himmel glänzte das Gestirn "der Wagen". Der Pfarrer sah zu ihm empor und flüsterte: "Noch sinkt er nicht, noch kann ich es vollbringen. Salve Regina."
Sie gelangten zu dem Landgut. Man setzte den Pfarrer herab und führte ihn zu dem Kranken. Vor ihm ging der Hilfspriester mit dem Allerheiligsten.
Als der Kranke das Glöcklein vernahm, zuckte er zusammen, und als er den jungen Priester eintreten sah, fragte er barsch: "Was wollen Sie bei mir? Wer hat Sie gerufen?"
Aber die Tür ging noch mehr auf und, von zwei Männern gestützt, trat der totkranke Seelenhirt herein.
Der Kapitän erschrak und sah den Pfarrer verwundert an. Er trat an das Bett und reichte ihm die Hand.
"Was führt Sie zu mir, Herr Pfarrer?" fragte fast beschämt der Kapitän.
"Mein Freund, ich habe gehört, dass Sie daran sind, die Welt zu verlassen", sagte aufrichtig der Pfarrer. "Auch ich bin am sterben. Möchten Sie als guter Freund nicht mit mir den gleichen Weg gehen, den Weg der Buße?"
Der Kapitän sank in die Kissen, dann winkte er den Anwesenden, sich zu entfernen. Lange blieben die beiden allein und als endlich die übrigen auf ein gegebenes Zeichen eintraten, sahen sie den Kapitän in Tränen aufgelöst, des Pfarrers Gesicht aber leuchtend.
Der Hilfspriester erteilte dem Kranken die hl. Wegzehrung und die letzte Ölung und dann nahm der Pfarrer den Kranken bei der Hand; beide sahen einander lange in die Augen, bis der Kapitän, von dem Heldenmut des sterbenden Pfarrers überwältigt, tat, was er noch nie getan hatte - er küsste dem Pfarrer die Hand, der Pfarrer küsste ihn auf die Stirn und sagte: "Auf Wiedersehen!"
Man brachte den Pfarrer zum Wagen. Ganz ermattet sank er auf den Sitz und sah empor zum Himmel.
Die Morgenkühle trat ein, die Lerchen erhoben sich trillernd und jubelnd zum Himmel und die Morgenröte des neuen Tages erschien am Horizont.
Sie fuhren beim Pfarrhaus vor. Man brachte den heldenmütigen Priester zu Bett.
Der Pfarrer sah nach dem Sarg hin und flüsterte: "Öffnet das Fenster, zündet die Kerze an und Sie, Herr Konfrater, beten Sie die Gebete der Sterbenden!"
Der junge Priester fing an zu beten und der Pfarrer betete mit gefalteten Händen still ihm nach.
Die Morgenluft wehte ins Zimmer und trug den Duft der Blumen und den Gesang der Vögel herein.
Plötzlich erstrahlte die Kirchenkuppel im ersten Sonnenstrahl, ein Strahl der Seligkeit flog über das Antlitz des ehrwürdigen Seelenhirten, der junge Priester fiel auf die Knie nieder und betete: "Proficiscere anima christiana - fahre hin, christliche Seele -!"
Der Küster zog die Glocke, die Leute in der ganzen Pfarre machten das Kreuz und der Maienmorgen lächelte so selig wie des toten Pfarrers Gesicht. - Der Kapitän genas, er pflegte noch lange das Grab des Pfarrers zu besuchen.
________________________________________________________________________

13. Bei dem "Heiligen" in Padua - Von Erhardt Krafft
1.
"Il Santo!" Beim Klang dieser beiden Wörtchen erhellt sich das Auge der meisten Italiener; ihr Gesicht strahlt, ihr Mund fließt fast über vom frohen Lobpreis des großen Gottesmannes von Padua.
Selbst Irrgläubige und solche, die längst jedes positive Religionsbekenntnis von sich losgestreift haben, nennen den Namen des "Santo" mit hoher Wertschätzung, ja mit einer gewissen Ehrerbietung.
Und was ist es, das aus dem heiligen Antonius den "Santo" kurzerhand macht; das ihm den Vorzug vor so vielen und großen italienischen Heiligen in ganz Italien verleiht, das ihm die Liebe von Freund und Feind, von hoch und niedrig sichert?
Außer dem engelhaften Wesen des großen Gottesmannes reißt besonders seine betätigte menschliche Liebenswürdigkeit, seine stete Hilfsbereitschaft in allen Lebensnöten, seine große historische und soziale Wirksamkeit die Herzen an sich. Und die vielen wundersamen Geschehnisse, die noch heutigentags an seiner Ruhestätte zu Padua in aller Munde sind, halten diese Begeisterung stets wach.
Was Wunder, wenn auch unser Herz und Gemüt in erregte, erwartungsreiche süßtraute Stimmung geriet, als wir am hohen Fest Christi Himmelfahrt aus Venedig aufbrachen, um der Stadt des "Heiligen" zuzustreben.
Dazu kam ein echt italienischer Frühlingstag und das wundersame Landschaftsbild, das wir durcheilten.
Über der "Königin" des Adriatischen Meeres (Venedig) wölbte sich in metallischer Tiefbläue das Ätherrund. Die herrliche Dogenstadt war in eine unendliche Flut goldensten Sonnenscheines getaucht, so dass sie mit ihren schneeweißen Marmorpalästen neben den zahlreichen Kirchenkuppeln wie ein duftiges Märchen aus den blauen Meeresfluten emporstieg.
Erd und Himmel schienen sich hier an Schmuck und Schönheit überbieten zu wollen. Auch die Landschaft, die sich an das venezianische Seegebiet anschließt, zeigt sich dieser Herrlichkeit vollwürdig: die reiche Fruchtbarkeit der oberitalienischen Tiefebene lockte hier ebenso sehr das Auge wie die stets wechselnde Schönheit eines südlichen Erdstriches.
Schon viele Meilen von Padua sah man sich stark in den Bannkreis des "Heiligen" hingezogen: zu Tausenden zogen an dem schönen Festtag seine Verehrer in Richtung Padua. Aus den Städten und vom Land, Einheimische und Fremde schwirrten durcheinander - ein Gemisch von Sprachen und Trachten, das seinesgleichen sucht.
Auf den letzten Stationen vor der Antonius-Stadt wurde das Menschengewoge fast beängstigend. Und als endlich die Bahnschaffner das längst ersehnte "Padova" ausriefen, fluteten wahre Menschenströme aus den Bahnhofshallen der Stadt zu.
"Al Santo, al santuario, alla basilica!" schwirrten die Ausrufe oder Fragen durch die Menschenmassen, die sich zu Fuß, zu Wagen oder per Trambahn auf der breiten Straße durch Padua nach dem Heiligtum hinwandten.
In der Stadt selber herrschte, wie in allen mittelgroßen italienischen Städten, selbst an Christi Himmelfahrt großes Handelsgetriebe, echtes Weltgetümmel. Dieses verlor sich erst in der Nähe des Heiligtums. Auf dem weiten Vorplatz der Basilika wehte eine würdige, ehrfurchtsvolle Stimmung; man verspürte schon den Geist des großen Heiligen.
"Ecco, il santuario del Santo! La basilica!" flüsterten sich die Menschen zu. ("Sieh` da, das Heiligtum des Heiligen! Die Basilika!")
Welch imposanter Bau! Welch würdige Ruhestätte des heiligen Antonius!
Großartig, fast erdrückend für uns kleine Menschen wölbt sich der prachtvolle Kuppelbau in die Lüfte, die ganze Umgebung, ja die Stadt selber in Schatten stellend.
Und nun erst das Innere der Basilika!
Wie mächtig wölbten sich die Hallen, die Seitenbauten, vornehmlich aber die Mittelkuppel zum Himmel empor!
Welch wundervolle Wandgemälde; welch farbenschöne Fenster und kunstreiche Marmorfiguren oder -denkmäler hüben und drüben!
Alles weist hier mit tausend Zungen zum Himmel und auf die Pfade hin, die dereinst "der Heilige" auf seinem Erdenweg zum Jenseits gegangen ist.
An den Wänden erblickt man eine fast unzählige Reihe von Beichtstühlen - ein Beweis, dass sich hier, im Bannkreis des Heiligen, viele Seelen Jahr um Jahr im Bad des Bußsakramentes reinwaschen; wie auch die große Anzahl von Nebenaltären darauf hindeutet, dass es gar manchen Priester drängt, in diesem Heiligtum das Messopfer zu feiern.
Zur Grabstätte selber, die sich vom Eingangsportal der mächtigen Basilika links in einer Seitennische befindet, bedurfte es keines Wegweisers: wie von einem gewaltigen Magnet angezogen, strömte alles darauf zu - ein günstiger Zufall trug mich gerade in dessen Nähe.
Tiefergreifend, völlig überwältigend ist die Ruhestätte des "Heiligen".
In weitausragender Rundung, deren obere Teile mit köstlichen Malereien ausgeziert sind, während sich weiter unten links an den Wänden wundervolle Marmor-Reliefbilder aus dem Leben oder der Wirksamkeit des "Heiligen" hinziehen, steht der Altar mit den Gebeinen des hehren Gottesmannes.
Alles ist Kunst hier, vollendete Kunst, erlesene Pracht, vollwürdig des kostbaren Schatzes, der im Innern des Altares ruht.
Auf mehreren Marmorstufen steigt man zu dem prachtstrotzenden Altar empor, dessen Geräte beinahe durchgängig von reinem Gold gefertigt sind; rechts und links stehen kunstvoll geschnitzte Kommunionbänke, vor denen unzählige Gläubige das Jahr hindurch den Leib des Herrn empfangen.
Und nun das Leben um das Heiligtum her, die seelenerschütternden Szenen, die sich hier abspielen!
Ein Priester las gerade die heilige Messe an der Gnadenstätte - und noch nie habe ich an einem Altar das hochheilige Messopfer mit solcher Begeisterung feiern sehen: aus dem Strahl der Augen, aus jedem Wort, aus jeder Bewegung des Geistlichen brach dessen hohe Liebe und Ehrfurcht für den großen Heiligen sieghaft hervor.
Auch die Gläubigen boten einen Anblick, den man niemals vergessen wird.
Bauern und Städter, fein und schlicht, Mann und Frau, Greis und Knabe lagen hier auf den Knien. Und fast jedem strömten seine Ehrfurchtsgefühle für den "Heiligen" in einer anderen Weise aus: da lagen italienische Bauersfrauen mit der Stirn auf den Steinfliesen, während andere die Arme sehnsüchtig nach dem Gnadenaltar ausstreckten.
Mit über die Brust gekreuzten Armen, die Augen wie gebannt zum Altar gerichtet, knieten elegant gekleidete Männer auf bloßem Boden; Greise und Kinder rangen die gefalteten Hände empor.
Schluchzen und unterdrücktes Weinen, halblautes Gebetsflüstern und tiefes Seufzen ertönte aus jeder Menschengruppe.
Wie viele Bitten mögen dem großen Heiligen zur Vermittlung beim allmächtigen Gott hier vorgebracht worden sein!
Wie viele Nöte des Geistes, der Seele, des Körpers werden ihm an dieser Stätte geklagt!
So überwältigend ist der Anblick der gläubigen Menge vor dem Heiligtum, dass er jeden auf die Knie niederzieht, jeden zur Mitverehrung des hohen Gottesmannes zwingt.
Nach Schluss des Messopfers endlich beginnt eine Szene, die auch die härtesten Herzen höher schlagen lässt, die in jedes fühlenden Menschen Auge heiße Tränen lockt.
Auf der Rückseite des Altars liegt die eine Längsseite des kunstreich ziselierten Sarges des "Heiligen" offen; und hierher ergießt sich nun der ganze Menschenstrom zur speziellen Verehrung der Reliquien.
Man lehnt in tiefster Innigkeit eine Sekunde lang die Stirn an den Sarg; man küsst ihn, streicht mit der Rechten liebend darüber hin.
Besonders innige Verehrer des "Heiligen" wollen von der Berührung nicht schnell genug ablassen und werden deshalb von den Nachfolgenden mit sanfter Gewalt vorwärts geschoben.
Und erst die Stoßseufzer, die hier mit halblautem, oft genug aber auch im Seelenüberschwang mit lautem Rufen ausgestoßen werden.
"Hilf, Heiliger! Hilf mir armen Sünder!" hörte ich einen jungen schwarzäugigen Italiener seufzen, nachdem seine Lippen innig den Sarg berührt hatten.
"Mein Knäblein, mein krankes Knäblein - lass es gesunden durch deine Fürbitte!" flehte eine junge Mutter, während sie ein schneeweißes Kinderkleidchen an das Heiligtum presste.
"Gib meinem leichtlebigen Sohn von der Kraft deines Gottesglaubens!" lispelte eine greise Mutter, während ihre Stirn an dem Sarkophag ruhte.
In dieser Weise eilten Hunderte an dem Heiligtum vorüber: jeder vielleicht mit anderen Gedanken, mit verschiedenen Anliegen - alle aber übereinstimmend in ihrer großen Verehrung für den "Heiligen" und im Vertrauen auf seine mächtige Mittlerschaft bei Gott.
Es war ein unbeschreiblich rührendes Bild; eine Szene, die den Menschen im Innersten aufwühlte, ihm unauslöschliche Eindrücke ins Herz senkte.
Noch ganz überwältigt von den Vorkommnissen an dem Sarg ließ ich mich, nachdem ich dem Heiligen" ebenfalls meine Huldigung und Verehrung gezollt hatte, auf einer Bank vor dem Gnadenaltar nieder.
2.
Der beim heiligen Antonius in Padua wiedergefundene Sohn.
Als ich am Grab des heiligen Antonius betete, vernahm ich plötzlich dicht neben mir lautes Schluchzen und gar innige Bittworte an den heiligen Antonius.
An meiner rechten Seite hatte sich ein greises, ärmlich gekleidetes Mütterchen auf den Boden geworfen. Sie stieß beständig, unterbrochen von hervorstürzenden Tränen, halblaut hervor:
"O großer Heiliger, lass - mich ihn - doch - wiederfinden, meinen - Sohn! Du hilfst ja - besonders - gern uns Menschen - ein verlorenes - Gut - wiederzuerlangen -. O, mein - höchstes, mein einziges Gut - ist verloren: mein - Antonio - Sohn - Antonio! O - hilf, Heiliger! Führe - mir - Antonio - wieder in die - Arme!"
Und sie küsste den Boden, die unglückliche Mutter. Sie rang die Arme zu dem Heiligtum empor; sie flehte immer eindringlicher, inniger, schluchzender.
Ich fühlte Mitleid mit der Greisin und beschloss, ihr dieses Gefühl zu beweisen und sie - womöglich - in ihrem herben Leid zu trösten.
Deshalb wartete ich, bis sie sich von den Knien erhob, um ihr aus dem Heiligtum zu folgen.
Auf dem Vorplatz der Basilika wischte sie sich die Tränen von den gefurchten Wangen und setzte sich auf einen Stein.
Ich trat auf sie zu - mit freundlichem Gruß:
"Guten Tag, Mütterchen! Sie weinten vor dem Heiligtum so heftig und trugen dem "Heiligen" recht inständige Bitten vor. Kann ich Sie vielleicht trösten oder etwas für Sie tun?"
Sie schaute mit tränenverschleierten Augen erstaunt zu mir empor und neigte dankend ein wenig ihr Haupt.
"Sie sind sehr gütig", versetzte sie mit der Höflichkeit, die auch dem gewöhnlichen Italiener eigen ist. "Ich danke Ihnen sehr. Aber tun können Sie nichts für mich. Überhaupt vermag kein Mensch mir beizuspringen in meiner Bedrängnis. Und deshalb habe ich mein ganzes Hoffen auf den Heiligen gesetzt."
"Auf den Heiligen, Mütterchen?"
"Ja, Herr. Der kann und wird auch wohl helfen. Ich vertraue fest auf ihn."
Ich nickte ihr beistimmend zu, weshalb sie fortfuhr - eifrig, hastig:
"Ich bin Witwe und habe nur ein Kind, einen sonst braven und sehr ergebenen Sohn von 18 Jahren. Er ist die Sonne meines armen Daseins, mein einziges Glück, meine einzige Lebensfreude."
"So, so", bewies ich ihr meine Aufmerksamkeit, mein lebhaftes Interesse.
"Bis vor kurzem", erzählte die Greisin weiter, "hielt Antonio auch zu seinem Mütterchen, als er mit einem Mal eine Art Hinausweh bekam."
"Hinausweh?"
"Ja, einen unwiderstehlichen Drang, die Welt zu sehen. Ich bat, ich beschwor ihn, von solchen Gedanken abzulassen, mich nicht zu verlassen. Und er schien auch meinem Drängen nachzugeben, bis er plötzlich eines Morgens verschwunden war. In einem zurückgelassenen Schreiben bat er um Verzeihung ob seines Ungehorsams: er habe dem inneren Sehnen nach Veränderung in der Lebensweise nicht länger widerstehen können. Er werde aber stets meiner Gedenken und auch fern von mir allzeit ein guter Sohn bleiben."
Sie schwieg. Neue Tränen entflossen ihren halberloschenen Augen.
Schließlich setzte sie mit einem herzerschütternden Seufzer ihren Bericht fort:
"Seit dieser Zeit lebe ich ganz freudlos dahin, voller Gram und Sorge um mein Kind. Nichts vermag mich zu trösten; nichts kann mich aufrichten."
"Ich fühle Ihnen dies wohl nach", versetzte ich teilnahmsvoll. "Forschen Sie denn nicht nach dem Sohn?"
"O doch, mein Herr. Viel und eifrig. Durch die Behörden und durch befreundete Personen."
"Und Sie erfuhren nichts von Antonio? Er blieb verschollen?"
"Völlig verschollen. Alle Mühe erwies sich als vergeblich. Unser Vaterland ist groß und die Spur von Antonio ist wie vom Winde verweht."
"Wie unangenehm, wie betrübend für Sie, Mütterchen!"
"Ja, ja, mein Herr! Und jetzt verstehen Sie auch, warum ich mein alleiniges Vertrauen auf den "Heiligen" geworfen habe! Er ist ja doch so mächtig am Thron Gottes und hat schon gar manchem seiner Verehrer geholfen - warum sollte er gerade mir, einer verlassenen, trostlosen Mutter, den heißersehnten Sohn nicht wieder zuführen können?"
"Sie haben recht, Mütterchen, ganz recht."
Die Greisin wurde nun immer beredter:
"Ja", versicherte sie, "unser "Heiliger" wird helfen - sicher, ganz sicher. Wenn er bis jetzt noch nicht geholfen hat, so liegt das, wie mir unser Pfarrer sagte, lediglich an mir: ich war der Hilfe des "Heiligen" noch nicht ganz würdig. Ich muss mich so lange vervollkommnen, so lange unablässig und vertrauensvoll flehen, bis ich jene Würdigkeit erlangt habe."
In meinen Augen stieg es heiß empor: welche Innigkeit des Vertrauens zum heiligen Antonius; welche Ergebenheit in Gottes und des "Heiligen" Willen!
"Für heute", plauderte die Greisin unentwegt weiter, "hatte ich nun besonderes Vertrauen auf die Hilfe unseres "Heiligen" gesetzt."
"Warum gerade für heute?"
"Je nun - heute ist doch unseres Herrn und Heilands Himmelfahrt! An diesem Fest aber pflegte ich seit Jahren mit Antonio zusammen zum Heiligtum hierher zu wallfahrten. Und da mein Sohn stets mit großer Liebe an dieser Wallfahrt hing, so schmeichelte ich mir mit der Hoffnung, der "Heilige" werde jenen Umstand benutzen, mir Antonio an seinem Gnadenort wiederzugeben."
"Ein ganz guter Gedanke, lobte ich - als plötzlich etwas ganz Unerwartetes geschah: die Greisin schnellte von ihrem Stein auf, beschattete sich mit der Rechten die Augen und spähte scharf nach der Straße aus, die zu der Basilika hinaufführt.
Da ein jauchzender Schrei - und sie lief mit ungeahnter Schnelligkeit auf einen jungen, ärmlich und staubig aussehenden Menschen zu, der mit einem Wanderstab daherkam und eben in den ummauerten Vorplatz der Basilika einbog.
"Antonio, Antonio!"
"Mutter, Mütterchen!"
Mit diesen Jubelrufen fielen sich die Greisin und der Wanderer in die Arme. In den nächsten Augenblicken vernahm ich nichts als das Freudenschluchzen der beiden glücklichen Menschen.
Als der erste Sturm des Wiedersehensglücks vorüber war, hörte ich den Sohn der Mutter versichern, dass es ihn schon lange gereut, sie verlassen zu haben und dem unbestimmten Drang nach der Fremde gefolgt zu sein. Allein er habe sich gescheut, nach Hause zurückzukehren und deshalb beschlossen, den Wallfahrtstag zum "Heiligen" abzuwarten und hier der Mutter Verzeihung zu erbitten.
"Und nicht wahr, Mütterchen", schloss Antonio innig seine Worte, "du gewährst mir diese Verzeihung um der Liebe zu unsrem "Heiligen" willen? Nie, nie will ich auch wieder die Torheit begehen, ob eines ungewissen, nebelhaften Glückes in der Fremde das sichere, geruhsame Leben an der Seite der geliebten Mutter zu verscherzen."
Die Greisin antwortete zuerst gar nichts. Aber sie küsste den wiedergefundenen Sohn mehrmals auf Stirn und Wange, um ihn schließlich mit sich fort zur Basilika zu ziehen.
"Auf, auf, Antonio!" schluchzte sie im Überschwang ihrer Freude hervor. "Auf zum Heiligen, zur Basilika, um für die Erhörung meiner Bitte zu danken!"
Und als sie, Hand in Hand mit dem Sohn, an mir vorbeikam, nickte sie mir lebhaft zu und versicherte:
"Sehen Sie, mein Herr, wie recht ich hatte mit der Behauptung, der "Heilige" helfe wohl immer! Auch mir hat er nun offensichtlich geholfen, nachdem er mich dieser Hilfe würdig befunden hat: er hat mich Antonio wiederfinden lassen."
"Und zwar auf ganz natürlichem, auf dem einfachsten Weg", stimmte ich ihr bei.
"So ist es", versetzte die Greisin. "Gelobt sei unser großer "Heiliger"!"
Als Mutter und Sohn unter dem großen Portal der Basilika verschwunden waren, trat ich den Rückweg zum Bahnhof an.
Ich hatte das Bewusstsein, selten in meinem Leben so viel Anregung, Erbauung und Begeisterung für Gott und seinen großen Heiligen von Padua empfangen zu haben als an diesem Himmelfahrtstag an der Ruhestätte des "Heiligen".
________________________________________________________________________

14. Gerettet - Von Ernst Schultheiß
Es mögen nun schon zehn Jahre verflossen sein, als an einem Sommerabend mehrere Bewohner eines sauerländischen Gebirgsdorfes beim Glas Bier saßen.
Plötzlich trat die Frau des Wirtes in das Zimmer, säuberte den Tisch und sprach: "Es kommt ein Fremder, der wahrscheinlich bei uns einkehren will, und hier sieht es nicht sehr einladend aus. Bei der vielen Arbeit im Garten und Feld kann man nicht alles blitzeblank halten."
Einer der Gäste sagte: "Es wird wahrscheinlich ein Beamter von der Regierung sein, um hier eine Vermessung vorzunehmen."
"Glaube es kaum", fiel der Aufseher vom Hammerwerk ein, "eher ist es ein Tourist, der hier in den Bergen umherkraxelt, dem lieben Gott die Zeit stiehlt und obendrein seine Schuhsohlen abläuft."
Der Fremde trat ein. Seinen Hut hatte er mit dunkelrotem Heidekraut besteckt. Auf dem Rücken hing ein vollgestopfter Rucksack und in der Hand trug er einen knorrigen Gebirgsstock.
"Guten Abend, Herrschaften! Wirt, einen Schoppen Bier, aber ein wenig plötzlich."
Der Schreiner Franz puffte seinen Nachbarn in die Seite und bemerkte: "Spricht der aber komisch, als wenn er sich die Zunge zerbrechen wollte."
"Der ist ein Berliner, die haben ihre eigene Aussprache und bilden sich ein, recht helle zu sein."
"Leute", begann der Fremde, "habt ihr hier aber eine schöne Gegend. Die herrlichen Waldungen, die gewaltigen Bergkuppen, die langgezogenen Wiesentäler und die prachtvolle Aussicht."
"Davon können wir aber nicht backen", entgegnete der Berghöfer, "wir haben hier zu viele Steine, ein rechtschaffener Lehmboden wäre uns schon lieber als der Wald."
"Das ihr den Wald nicht schätzt, habe ich vorhin schon entdeckt. Birken und Lärchen sind abgehauen und zu beiden Seiten des Weges in die Erde gesteckt."
"Ist wegen der Fronleichnamsprozession", sagte der Wirt etwas schüchtern.
"Aber deswegen den Wald verschandeln kann ich nicht begreifen", fiel der Fremde ein.
Der Förster Schneidersmann tat einen mächtigen Zug aus seinem hölzernen Pfeifenkopf, donnerte mit der Faust auf den Tisch und ließ sich vernehmen: "Der Jungwald steht so dicht, dass er aufgeräumt werden muss, und warum sollte man nicht einige Stämmchen zur Ehre Gottes verwenden?"
"Ach, so steht die Sache", entgegnete der Fremde. "Übrigens, Herr Gastrat, ich möchte hier einige Tage verweilen, das lässt sich doch einrichten?"
"Dann muss ich erst mit meiner Frau sprechen", erwiderte der Wirt und entfernte sich.
Die Frau hatte natürlich schon hinter der Tür gelauscht. Sie machte Einwendungen. Nach ihrer Ansicht hatte der Fremde eine eigene Auffassung von der Religion, auch trat er ihr zu schnodderig auf.
"Ist einerlei, wenn er nur gut bezahlt", entschied der Wirt.
Der Fremde konnte bleiben. Die Gäste hatten sich nach und nach verzogen. Nur der Steinbrecher Kupka blieb noch im Gastzimmer zurück. Der war von auswärts, die Leute munkelten, dass er schon im Zuchthaus gesessen habe und gingen ihm wegen seines scheuen und verschlagenen Benehmens aus dem Weg.
"Na, Herr Nachbar", sagte der Berliner, "rücken Sie etwas näher, trinken Sie noch einen Schoppen mit."
Das hörte Kupka gern. Beide ließen sich in ein Gespräch ein.
Der Fremde hatte bald herausgefunden, dass der "Nachbar" nicht viel auf Gott und Religion gab.
"Hier sind die Leute wohl überfromm?"
"Das kann der Herr morgen selbst sehen", entgegnete Kupka, "dann ist Prozession."
"Wollen uns mal augenscheinlich überzeugen. Wirt, zahlen!"
Der Fremde zog seine Börse, in der die Goldstücke klirrten.
Der Steinbrecher horchte auf, in seinen Augen lag ein unheimlicher, gieriger Blick.
Am anderen Morgen donnerten in aller Frühe die Böller. Frohe Menschen eilten in Festesstimmung zur Kirche. Hell klangen die Glocken in die Maienluft. Dem Wirtshaus gegenüber war ein Altar errichtet. Ein altes Mütterchen kam und zündete die dicken Wachskerzen an.
Die Prozession wurde von den Schulkindern eröffnet und sie beteten die Litanei. Dann folgten die Jungfrauen und Frauen. Weißgekleidete Mädchen streuten Blumen und Rosenblätter auf den Weg. Vier ältere Männer trugen gesenkten Hauptes den Baldachin, unter dem der Priester das Allerheiligste trug. Weihrauchwölkchen durchzogen die würzige Luft. Alle fielen auf die Knie. Die Silberglöcklein ertönten, Böller krachten. Der Priester gab den Segen mit dem Sanktissimum. Ein unvergesslicher Augenblick voller Andacht und Würde.
Weiter bewegte sich die Prozession durch wogende Felder und blumige Wiesen.
"Schön ist der Aufzug, dass muss man zugeben", sagte der Fremde, der hinter der Gardine seines Zimmers stand, "aber in unsere aufgeklärte Zeit passt das nicht mehr."
Da bemerkte er, wie Kupka in das Wirtshaus trat. "Der ist also noch nicht angesteckt", dachte der Berliner, "den Mann kann man gebrauchen." Er begab sich in das Gastzimmer.
"Wollen wir nicht einen Gang durch die freie Natur machen, Herr Nachbar?"
Kupka war einverstanden. Unterwegs wurde er von dem Berliner belehrt, dass es keinen Gott gäbe. Alles sei von selbst entstanden. Was man sonst den Leuten sage, wäre eitel Flunkerei. Kupka horchte auf und kalkulierte, warum man dann dem Reichen sein Geld nicht nehmen solle? Wenn er es nicht gutwillig hergeben will, nun dann . . .
Der Spaziergang dehnte sich immer weiter aus. Man gelangte in eine finstere Schlucht, wohin sich selten eines Menschen Fuß verirrte. Der Steinbrecher hatte nur einen Gedanken: die Geldbörse des Fremden. Sein Puls hämmerte, das Gehirn fieberte.
Gegen Mittag schritt der Förster Schneidersmann, der sich an der Prozession beteiligt hatte, seinem hoch im Wald gelegenen Forsthaus zu, Als er in der Nähe der Schlucht vorbeikam, raste sein Hund durch das Gebüsch und fing laut an zu bellen. Da stimmt etwas nicht, denkt der Waidmann und begab sich rasch in die Schlucht.
Ein furchtbarer Anblick. Der riesenstarke Steinbrecher hatte den Fremden überwältigt und ausgeraubt. Er konnte keinen Laut von sich geben, denn im Mund steckte ein dicker Knebel.
Der Förster richtete ihn auf und holte in seiner Flasche einen Trunk kühlen Wassers.
"Sehen Sie", sprach er später zu dem Fremden, "was würde wohl aus Ihnen geworden sein, wenn ich nicht des Weges gekommen wäre? Und das wäre ich nicht, wenn keine Prozession, über die Sie gelacht und gehöhnt haben, stattgefunden hätte."
Der Fremde schwieg. Er verblieb noch einige Zeit und bevor er abreiste - er musste so lange warten, bis ihm aus der Heimat Geld geschickt war - übergab er dem Wirt einen größeren Betrag zur Ausstattung für die Fronleichnamsprozession des nächsten Jahres.
________________________________________________________________________

15. Die Bitte ans heiligste Herz Jesu - Von Erhardt Krafft
1.
Mitten auf der staubigen Landstraße, die zu dem berühmten Herz-Jesu-Heiligtum Paray-le-Monial in Frankreich führt, eilt ein Handwerksgeselle dahin. Sein Antlitz ist blass, vergrämt; die schadhafte Fußbekleidung ist mit hohem Staub bedeckt, die Kleidung armselig - offenbar ist der junge Mann arm, sehr arm. Glühend brennen die Sonnenstrahlen auf ihn nieder, so dass ihm dicke Schweißtropfen auf die Stirn treten. Jetzt ist er in Paray-le-Monial angelangt. Er kann bald die Stufen besteigen, die zu dem vielbesuchten Heiligtum hinaufführen. Hastig segnet er sich beim Eintritt mit Weihbronnen, überfliegt mit den Augen den großen Prachtraum des Gotteshauses und stürzt dann geradezu dem Gnadenaltar zu, da er niemand anders in der Kirche wahrnimmt. Vor dem Altar sinkt er auf die Knie nieder; er streift das bestaubte Ränzlein vom Rücken, um es neben sich zu legen, und hebt dann Arme und Blicke zu dem wundersam schönen Marmorbild des göttlichen Heilandes empor, das in reichgeschmückter Umgebung steht und mit der Linken aufs Herz weist, gleich als ob es alle Menschenkinder auf dessen unendliche Güte und Barmherzigkeit hinweisen will. Und der Wanderbursche versteht diesen Hinweis; aus seinem Herzen quillt Seufzer auf Seufzer zu dem Gnadenbild empor. Sein Mund ringt heftig nach Worten, bringt aber immer nur wieder die Laute "Mutter, Mutter" hervor.
Da regt es sich plötzlich hinter einem der schlanken Strebefeiler des Kirchenschiffes: eine tiefverschleierte, schwarzgekleidete Dame, die dort ihre Andacht verrichtete und von dem Wandergesellen beim Eintritt in das Gotteshaus nicht bemerkt worden war, erhebt sich aus ihrer knienden Stellung, um auf den trostlosen Beter zuzugehen. Ihr Antlitz, das ebenfalls Spuren des Grames zeigt, drückt inniges Mitgefühl aus. Leise tupft sie dem Wanderburschen auf die Schulter - wie aus schweren Träumen fährt er empor und wendet ihr sein tränenüberflutetes Gesicht zu.
"Kommen Sie mit mir vor die Kirche!" flüstert ihm die Dame wohlwollend zu.
Er folgt ihrer Aufforderung, wenn auch mit einigem Staunen.
"Sie leiden sehr? Es brennt Ihnen ein Schmerz heftig auf der Seele?" beginnt im Vorhof des Heiligtums die Dame zu dem jungen Mann.
"Ja, meine Dame. Ich bin bodenlos unglücklich. Ich stehe am Rand der Verzweiflung." Ein Schluchzer unterbrach die Fortsetzung seiner Antwort; er schlug die Hände vors Gesicht und weinte abermals bitterlich.
"Aber beruhigen Sie sich doch!" bat die Dame. "Und wollen Sie mir nicht den Grund Ihrer Tränen mitteilen? Sie haben so rührend-innig das Herz Jesu um Hilfe gebeten - da benutzt unser göttlicher Heiland vielleicht mich als Werkzeug seiner Hilfeleistung."
Der Bursche nahm die Hände vom Gesicht - seine Züge waren offen, ehrlich und gutmütig, wenn auch rau. "Ach, gute Dame", versetzte er, "wie dankbar bin ich Ihnen für Ihr Mitgefühl! So viele Leute habe ich schon um Hilfe in meiner Not angesprochen. Alle, alle wandten sich kalt, mitleidlos von mir ab: wer sollte auch einem armen, landfahrenden Handwerksgesellen Vertrauen oder gar Interesse entgegenbringen? Desto wohler finde ich mich berührt von Ihrer mir freiwillig gespendeten Güte. Ich will Ihnen deshalb meine ganze Notlage klarlegen."
"Bitte, bitte, junger Mann! Haben Sie nur Vertrauen zu mir! Ich werde es rechtfertigen."
"Ich bin der Sohn einer armen, ganz armen Witwe aus Nordfrankreich. Ich begab mich zur Ausbildung in meinem Handwerk - ich bin Kunstschlosser - im Frühjahr auf die Wanderschaft in den Süden unseres Vaterlandes. Meine liebe Mutter war völlig einverstanden hiermit. Sie erfreute sich ja bei meiner Abreise noch großer Rüstigkeit, so dass an eine Notlage ihrerseits nicht zu denken war. Froh meiner stets fortschreitenden Ausbildung, im allgemeinen eines hinreichenden Auskommens mich erfreuend, trafen mich ganz ungeahnterweise hier in der Nähe von Paray-le-Monial zwei starke Schicksalsschläge: ich blieb lange Zeit ohne die eifrig gesuchte, ernährende Beschäftigung und erhielt zugleich die Schreckensnachricht, dass mein Mütterchen plötzlich gefährlich erkrankt sei und in ihren Todesnöten beständig nach mir jammere.
Ich war wie betäubt von diesem Doppelunglück. Ich versuchte alles, um die weite Reise nach dem Norden zu ermöglichen und ans Krankenlager meiner geliebten Mutter zu gelangen. Alles vergeblich! Niemand will sich meiner Not erbarmen. Und die Reise zu Fuß anzutreten, hat keinen Sinn. So befinde ich mich in der furchtbaren Lage, dem Ruf meiner vielleicht schon mit dem Tod ringenden Mutter nicht folgen zu können. Dies bricht mir aber fast das Herz ab, und so wandte ich mich zu der letzten Zufluchtsstätte um Hilfe: zum gnadenreichen Herzen Jesu in Paray-le-Monial." Ein tiefer, weher Seufzer hob bei diesen Schlussworten des Wanderburschen Brust. Wie ein Kind zur Mutter sah er dabei hilfeheischend zu der Dame auf.
Und diese Hilfe wurde ihm auch zuteil - besser, als er es zu hoffen gewagt hatte. "Ihre Geschichte rührt mich", entgegnete die Dame mit leise bebender Stimme. "Und Ihren Schmerz um die leidende, nach Ihnen in vergeblicher Sehnsucht sich verzehrende Mutter kann ich sehr wohl begreifen: auch ich verlor ja dieser Wochen mein Mütterchen, mein Teuerstes auf der Welt, durch den Tod, so dass ich in große Trauer versetzt worden bin. Zum zweiten aber ergriff mich gar sehr Ihr großes Vertrauen auf das hochheilige Herz Jesu, das an dieser Gnadenstätte ja besonders huldreich sich zeigt; das auch Ihr Gebet erhört hat. Bitte, wie viel Franken benötigen Sie zu Ihrer Heimreise?"
Ein halbunterdrückter Freudenruf entschlüpfte der beklemmten Brust des jungen Mannes: "Sie wollen die große Güte haben", presste er mit Mühe hervor, "mir den Fahrpreis nach der Heimat vorzustrecken?"
"Nicht vorzustrecken, sondern zu schenken, junger Mann. Für die Ausführung eines solch edlen Vorhabens darf man schon eine kleine Summe Geldes opfern."
"O, Sie edle, edle Dame! Mein ganzes Leben will ich Ihnen dankbar sein!"
Im Überschwang des Glücksgefühls ergriff der Wanderbursche die fein behandschuhte Rechte der Wohltäterin, um sie an seine Lippen zu führen.
Doch sie wehrte freundlich lächelnd diesen glühenden Dank ab und zog ihre Börse.
"Also, was kostet ein Billett im Schnellzug von hier zu Ihrem Mütterchen?" bat sie zum anderen Mal.
Der junge Mann nannte die Summe. Und ohne Zögern entnahm die Dame ihrer Börse einen Fünfzigfranken-Schein, um ihn mit gebefroher Miene dem Bedürftigen hinzureichen.
"So", plauderte sie dabei, "der Überschuss, der Ihnen nach Entrichtung der Fahrtaxe von diesen fünfzig Franken verbleibt, wird Ihnen gute Dienste tun für Ihre Verpflegung auf der Reise."
Des jungen Mannes Lippen bewegten sich vergeblich, um Dankesworte hervorzustammeln: seine hohe Erregung ließen Worte nicht zu. Mit beiden Händen ergriff er deshalb von neuem nach der Rechten der Menschenfreundin und hielt sie eine Sekunde zitternd umspannt. Dann aber eilte er, immer noch wortlos, wieder dem Heiligtum zu.
Die Dame aber kehrte ebenfalls zu ihrem stillen Andachtsplätzchen hinter dem Strebepfeiler des Kirchenschiffes zurück, ohne auch jetzt wieder von dem jungen Mann bemerkt zu werden.
2.
Gerade in dem Augenblick, wo die Dame dem Handwerksgesellen die Geldgabe in die Hand drückte, war der Mesner des Gnadenortes am Fenster seines gegenüberliegenden Diensthauses erschienen. Er erschrak: das bestaubte, sehr heruntergekommene Aussehen des jungen Menschen, die hohe Eleganz der Dame und deren ausnehmend große Gabe - der Mesner sah ganz deutlich die Fünfzigfranken-Note in ihrer Hand - ließ ihm sofort einen Verdacht durch die Seele ziehen: hier musste eine besonders aufdringliche und freche Bettelei, wenn nicht gar eine Belästigung oder Bedrohung durch einen Strolch vorliegen!
Nun war aber - wie auf großem Anschlagblatt im Vorraum der Kirche deutlich zu lesen war - wegen des zahlreichen Gesindels in jener Gegend jedes Betteln polizeilich streng verboten. Und so glaubte der Mesner, seine Pflicht zu tun, wenn er den eben wahrgenommenen Vorfall der Behörde melde; wenn er durch die Verhaftung des vermeintlichen Bettelburschen ein für anderes Vagabundenvolk abschreckendes Beispiel statuieren lasse.
Derart sah sich unser armer Wanderbursche beim Verlassen des Heiligtums zu seinem höchsten Schrecken von einem "Agenten der öffentlichen Sicherheit" empfangen und wegen "unbefugter Bettelei an dem Gnadenort" verhaftet. Vergeblich beteuerte der junge Mann seine völlige Unschuld; vergeblich erzählte er dem Beamten wahrheitsgetreu seine Not und deren Abwendung durch die gütige Dame. Der Polizist lachte ihm ins Gesicht, als er mit beißendem Spott sagte: "Genug der Worte! Übergenug! Oder meinen Sie etwa, dass ich einem Landstreicher Glauben schenke, wenn er mir irgend eine erfundene rührselige Geschichte erzählt? Wenn er behauptet, eine Dame habe ihm schon daraufhin fünfzig Franken geschenkt? Lächerlich! Bodenlos lächerlich!"
"Aber hier sind meine Papiere", warf der Wandergeselle ein. "Sie werden alles in Ordnung bei mir finden! Sie - - - - -"
"Schweigen Sie mit Ihrem törichten Gerede!" fiel ihm der Beamte rau ins Wort. "Folgen Sie mir auf die Sicherheitswache! Das Weitere wird sich dort finden."
In des jungen Mannes Augen schossen von neuem die hellen Tränen: so nahe an der Erfüllung seines brennendsten Herzenswunsches, zur kranken Mutter heimfahren zu können, - und nun auf ganz unschuldige Weise zur Polizei geschleppt! Um dort vielleicht längere Zeit zurückgehalten zu werden, so dass er sein Mütterchen gar nicht mehr am Leben treffen würde! O, wenn doch nur die Wohltäterin noch da wäre! Die würde seine Unschuld sicherlich bezeugen! Aber sie war wohl weggegangen - und wohin, wusste niemand.
Gerade in dem Augenblick, als der "Agent" den Wanderburschen mit barschem Handgriff am Arm packte und ihn mit sich fortzerren wollte, tat sich das Portal des Gotteshauses auf und ließ die Dame herausschreiten.
Nachdem die Dame die Angaben des Wanderburschen als volle Wahrheit bestätigt und hinzugefügt hatte, dass sie ihm die Fünfzigfranken-Note aus eigenem Antrieb wegen seiner rührenden Sohnesliebe und seiner Frömmigkeit zum heiligsten Herzen Jesu geschenkt hatte, ließ sich der Beamte zur Besichtigung von seinen Papieren herab. Da sie den jungen Menschen als sehr braven, strebsamen und ehrlichen Handwerker schilderten, gab ihn der "Agent" frei und entschuldigte sich wegen seines Fehlgriffs.
Der Wanderbursche aber ließ sein Herz nochmals in Dank gegenüber der gütigen Dame ausströmen und eilte, nach einem letzten heißen Dankesblick auf das Herz-Jesu-Heiligtum, in raschen Schritten dem Bahnhof zu, um bald darauf seiner Heimat und seinem kranken Mütterchen entgegenzueilen.
________________________________________________________________________

16. Ein Apfel (Eine Legende) - Von Stephardt
Ungefähr vierzig Jahre nach der glorreichen Himmelfahrt des lieben Heilandes klopfte eines schönen Tages ein Mann an die Himmelspforte und bat um Einlass. Der heilige Petrus öffnete als Himmelspförtner ein Fenster, um zu sehen, wer da sei. Er war nicht wenig überrascht und unangenehm berührt, als er einen Juden draußen erblickte.
"Was willst du?" fragte er.
"Bitte, lass mich in den Himmel hinein."
"In den Himmel? Was, du, ein Jude, willst in den Himmel hinein? Da sage mir vor allem einmal, ob du die heilige Taufe empfangen hast oder nicht."
"Heilige Taufe? Was ist das?"
"Es ist das heilige und notwendigste Sakrament, durch dessen Empfang man ein Kind Gottes wird, sich der Gnaden der Erlösung durch Jesus Christus teilhaftig macht und sich das Erbrecht auf das Himmelreich erwirbt. Hast du dieses heilige Sakrament empfangen?"
"Ich weiß nicht, was ein heiliges Sakrament ist, und so werde ich es wohl nicht empfangen haben. Von meinen Kinderjahren an bin ich durch die Welt gereist, habe gehandelt und gearbeitet, habe aber nie etwas gehört und erfahren von dem, wonach du mich jetzt fragst. Und so wird es wohl geschehen sein, dass ich die Taufe nicht empfing. Aber ich bin bereit, alles zu tun, was du von mir verlangst, alles, was notwendig ist, um in den Himmel zu kommen. Bitte, öffne das Tor und lass mich gelangen an den Ort, nach dem ich mich schon lange gesehnt habe."
"Das wäre nett", entgegnete St. Petrus, der Himmelspförtner. "Nein, nein, das gibt es nicht; die Sache geht nicht so leicht, wie du dir denkst. Das wäre mir eine schöne Geschichte, auf Erden ein lustiges Leben führen und dann mir nichts dir nichts in den Himmel hineinspazieren. Nein, das gibt es nicht. Ohne Taufe kein Himmel, und damit fertig."
"Aber ich habe immer ein ehrbares Leben geführt", wagte der Jude noch einzuwenden, "ich habe den Handel betrieben, ohne die Menschen zu betrügen, ich habe den Armen geholfen, ich habe . . ."
" . . . das eine Notwendige vergessen", unterbrach St. Petrus den Sprechenden, "das eine Notwendige, den Empfang der heiligen Taufe, der uns das Himmelstor öffnet, der uns den Schlüssel dazu gibt."
"Aber ich habe doch nie etwas davon gehört."
"Es war gewiss mehr als einmal Gelegenheit dazu", rief St. Petrus; "aber das Judenvolk ist ein hartes Geschlecht, es will nichts vom Wahren Glauben wissen."
"Ist der mosaische Glaube nicht der wahre Glaube? Ist nicht wahr, oder gilt nicht mehr, was Mose uns gelehrt hat?"
"Der mosaische Glaube war nur ein Vorbild, das gelten sollte, bis das eigentliche Bild selbst kam. Jetzt gilt nicht mehr der mosaische Glaube, sondern der christliche Glaube, zu dem man sich durch Empfang der hl. Taufe bekennt."
"Aber das habe ich gar nicht gewusst", rief der Jude, "niemand hat es mir gesagt."
St. Petrus machte ein Zeichen, als wollte er sagen, dass er der Geschichte nicht recht traue und schloss sein Guckfenster. Der Jude blieb draußen stehen und wurde nicht eingelassen.
Nun lag neben der Himmelspforte ein großer Stein am Weg. Er schien dahin gelegt zu sein, um denen, die aus dem Pilgertal zum Himmel kamen, ein Ruheplätzchen zu bieten. Der alte Jude ließ sich traurig auf ihm nieder und stützte das greise Haupt in die Hand, um nachzudenken, was nun zu tun sei. Nach einer Weile weckte ihn lieblicher Gesang aus seinem Sinnen. Es waren die Engel, die vor Gottes ewigen Thron das nie verklingende "Heilig, heilig, heilig" sangen. Der Jude schaute auf. Jetzt bemerkte er auch die blühenden Bäume, die ihre Zweige über die Mauern des Paradieses streckten und alles mit lieblichem Duft erfüllten. Das Lied der Engel aber klang fort, so schön und lieblich, so aus dem Herzen kommend und zu Herzen gehend, dass der Jude noch nie solch herrlichen Gesang gehört hatte. Er hätte ihn gerne aus größerer Nähe angehört, und er war tieftraurig, dass ihm dies nicht vergönnt war, dass er nur von fern zuhören konnte.
Da kam ein Mann des Weges. Er war voll göttlicher Majestät und blickte bei seinem Näherkommen den Juden voll Liebe und Mitleid an. Der Jude wusste nicht, wie ihm bei diesem Blick geschah. Er erhob sich unwillkürlich von seinem Sitz und blickte dem Kommenden voll Ehrfurcht entgegen. Dabei kam es ihm plötzlich vor, als habe er dieses Antlitz voll Liebe und Majestät schon einmal gesehen; aber es musste schon lange her sein, lange, gewiss schon mehr als sechzig Jahre.
Doch ehe der Jude Zeit fand, genauer nachzudenken, war der unbekannte Mann schon herangekommen. Liebliches Lächeln ruhte auf seinen Lippen und in seinen Wundermilden Augen, als der Mund sich öffnete und den einsamen Mann fragte: "Benjamin, bist du es?"
"Ja, Herr, ich bin Benjamin. Aber woher weißt du, dass ich so heiße? Wie kennst du meinen Namen?"
"Ich weiß alles und ich kenne alle Menschen, groß und klein, jung und alt, alle sind sie mir gar gut bekennt."
"Du weiß alles und kennst alle Menschen? Wie ist das möglich?" Der Jude schaute groß auf und dabei erinnerte er sich plötzlich, wo er dieses Antlitz schon gesehen hatte: In Nazareth musste es gewesen sein, dem kleinen Städtchen des Judenlandes, im Haus der frommen Mirjam. "Bist du nicht das Kind von Nazareth, mit dem ich vor vielen Jahren spielen durfte? Hieß deine Mutter nicht Maria, und war dein Vater nicht Joseph, der fromme Zimmermann?"
"Ja, Benjamin, ich bin dieses Kind."
"Aber du bist jung und schön, während ich alt und schwach geworden bin; du stehst in der Blüte der Jahre, während ich ein Greis bin. Wie kommt das? Es ist lange her, dass ich Nazareth verließ."
"Ja, es ist lange her; aber ich erinnere mich noch sehr gut, wie du im Alter von zwölf Jahren aus Nazareth fortgingst."
"Zwölf Jahre? Ja, so alt war ich damals. Ich begleitete meinen Vater einige Jahre lang auf Reisen, und als er starb, trat ich an seine Stelle. Die Erbschaft verlangte meine Anwesenheit in Ägypten. Ich blieb dann für immer dort und habe seitdem eigentlich nichts aus Nazareth und sehr wenig aus Palästina gehört."
"In Nazareth und Palästina, mein lieber Benjamin, hat sich gar vieles zugetragen. Auch ich hatte meine Schicksale, und vieles von dem, was in unserem Heimatstädtchen und im Land geschah, betraf meine Person. Aber ich habe dich nie vergessen, Benjamin . . . . Weißt du noch, wie du mir eines Tages einen dicken, rotwangigen Apfel schenktest? Du hattest ihn von deiner Base bekommen und wolltest ihn gerade essen, als ich des Weges kam und dir meinen Hunger und meinen Durst klagte."
"Du hast wirklich ein gutes Gedächtnis. Ich habe deinen Hunger und Durst und meinen Apfel längst vergessen; ich erinnere mich wirklich nicht mehr, dass ich dir jemals diese kleine Gabe zuteil werden ließ."
"Ich aber erinnere mich noch sehr gut", entgegnete der Mann mit den blauen Augen und dem seelenvollen Blick, "ich vergesse nichts. Mehr als zwanzig Jahre später in einer feierlichen, schmerzlichen Stunde meines Lebens hatte ich wieder Durst, bitteren, sehr bitteren Durst. Aber du, mein lieber Benjamin, warst nicht mehr da, dass du mir einen Apfel hättest geben können. Und als ich laut über meinen Durst klagte, verspottete man mich und gab mir Galle und Essig gemischt zu trinken. Es war ein bitterer Trank . . ."
"O", rief der alte Jude sichtlich bewegt dazwischen, "hat man dich so leiden lassen? Das hätte ich sehen müssen! So wahr ich Benjamin heiße, das hätte ich nicht ruhig zugelassen. Das müssen steinerne Herzen sein, die einen Leidenden noch verhöhnen und verspotten. Aber sage, woher hattest du denn den Durst?"
"Vom Blutverlust, Benjamin, von der Glut des Leidens. Du musst wissen, dass ich am Kreuz gestorben bin."
"Am Kreuz gestorben? Am Holz der Schmach? Wie ist das möglich?"
"Benjamin, ich bin für andere gestorben, ich habe die Schuld anderer auf mich genommen."
Bei diesen Worten wurde das Antlitz des schönen Mannes immer lieblicher, und je länger Benjamin, der Jude, es betrachtete, desto seliger wurde ihm ums Herz. Dabei lag plötzlich sein ganzes Leben mit allem seinem Tun und Lassen vor seinen Augen. Wie in einem getreuen Spiegel sah er seine Liebe zum Verdienst, sein unordentliches Verlangen nach Reichtum, und sein einziges Streben, mehr und mehr zu besitzen. Auch den Apfel, den er einst dem Kind von Nazareth geschenkt hatte, sah er vor sich und erkannte dabei, dass er am besten getan haben würde, wenn er alles verlassen hätte, um dem Jugendfreund durchs Leben zu folgen. Da war es ihm, als lege man alles auf eine Waage und als habe das, was er getan, gar kein Gewicht. Nur der Apfel war schwer. In Gedanken darüber fing Benjamin an, bitter zu weinen. "Wie schade, wie schade", sagte er dabei, "dass ich dich aus den Augen verlor, dass ich so früh von dir getrennt wurde."
"Warum denn, Benjamin?"
"Warum? Ich wäre dir immer gefolgt, ich wäre mit dir gegangen, ich hätte auf dein Wort gehört, ich hätte dir gedient und hätte versucht, jedes Übel von dir fernzuhalten. Dann wäre ich sicher den richtigen Weg gegangen. O, wenn ich es jetzt noch könnte."
"Möchtest du das wirklich? Willst du in die Welt zurückgehen und dich reich, geehrt und geachtet sehen, wie der kühnste Traum es kaum zu erreichen glaubte? Oder willst du mir in Armut, Elend und Not folgen? Überlege es wohl, Benjamin."
Der Jude wandte sein Auge nicht ab von dem Antlitz des Sprechenden. Dieses Antlitz voll hehrer Majestät schien immer schöner zu werden, zugleich aber schien es sich immer mehr zu entfernen und wie in einem Nebelmeer zu verschwinden. Dafür aber ließ sich der helle Klang von Gold und Silber hören, der immer näher kam, immer lieblicher und verlockender klang. Es war, als hätten tausend Gold- und Silberstücke Sprache bekommen, und als riefen sie alle mit lauter Stimme: "Im Reichtum ist Ehre, im Reichtum ist Macht. Uns folge, uns schließe dich an. Was willst du in Not und Elend gehen? Hier winkt dir Reichtum, Ehre und Macht."
Da raffte der Jude sich auf. Sein Jugendfreund, das selige Glück, das er bei seinem Anblick empfand, schienen ihn zu verlassen. Was waren im Vergleich zu diesem aller Freuden der Welt, alles Gold und Silber? Wie Nebel im hellen Sonnenschein, wie der Schnee, wenn der Frühling kommt, schwanden sie dahin. Da streckte er plötzlich seine Arme aus und rief: "O, bleibe bei mir, o, bleibe bei mir; verlass mich nicht und führe mich, wohin immer du willst. Ich folge dir auf allen deinen Wegen, ich verzichte auf Gold und Silber, ich werde dich verteidigen, ich werde deinen Durst stillen, ich werde gerne mit dir sterben. Aber lass mich immer dein Antlitz schauen, und blicke auch du mich an. Ich kann nicht mehr leben ohne dich. O verzeihe mir, verzeihe mir tausendmal, wenn ich je etwas getan habe, was dich betrüben musste."
Da näherte der Jugendfreund sich wieder. Er reichte mit holdseligem Lächeln dem Juden die Hand, die er mit unendlicher Freude ergriff und sagte: "Benjamin, ich bin Jesus Christus, Gottes Sohn, der als Erlöser der Welt für die Sünden der Menschen starb. Nun habe ich Besitz genommen vom Reich meiner Herrlichkeit. Komm mit mir!" Die Pforten des Paradieses taten sich plötzlich von selbst auf und Jesus führte den Juden in das Himmelreich.
Sankt Petrus blickte groß auf, und als die beiden wirklich die Schwelle des Himmels überschritten, wagte er kleinlaut zu sagen: "Aber, Herr, er ist ja ein Jude, er hat . . ."
Doch der Herr entgegnete mild: "Lass es gut sein Petrus. Er hat seine Sünden mit Tränen der Reue abgewaschen, er ist getauft durch das Verlangen, mir zu folgen. Und weißt du nicht, Petrus, dass ich versprochen habe, jeden Trunk Wasser zu vergelten? Benjamin gab mir als Kind einst einen Apfel; ich will es ihm mit dem Himmelreich belohnen."
Und Jesus, der Vergelter alles Guten, zog mit den Juden, der ihm einst einen Apfel geschenkt hatte, in den Himmel ein.
________________________________________________________________________

17. Die Geschichte eines Mönches, eines Königs und eines Revolutionärs - Nach Ségur von T. Carbonaro
Diese Erzählung ist bis auf die kleinsten Einzelheiten wahr. Ich habe das Material dazu in einem leider vergriffenen Werk gefunden, woraus die erhabene Gestalt des Franziskanerpaters Ludwig von Casoria hervorleuchtet, der im Jahr 1885 im Ruf der Heiligkeit gestorben ist.
Der König Ferdinand I. von Neapel, ein gerechter, fester, sehr frommer und darum von den Revolutionären bestgehasster Mann, war dem Pater Ludwig sehr gewogen. Als der König erfuhr, dass der heiligmäßige Mann nach Afrika reist, um dort junge Männer zu gewinnen, die er zum Priesterstand und zur Bekehrung der Afrikaner bestimmen kann, bot er ihm eine große Geldsumme an. Der demütige Pater schlug sie aus und reiste mit dem Versprechen ab, gleich am Tag seiner Rückkehr den König zu besuchen.
Auf dem Kai von Alexandrien in Ägypten war er einem erbitterten Revolutionär begegnet, Danieli genannt, der zu lebenslänglicher Galeerenstrafe verurteilt worden war. Der König hatte sie jedoch in lebenslängliche Verbannung umgewandelt.
Danieli erkannte den Pater, und durch Hass und Unglück verblendet, schlug er ihm brutal ins Gesicht und rief: "Bringe das von mir deinem Herrn und Freund Bomba!"
Pater Ludwig entfernte sich langsam, ohne eine Miene zu verziehen, als wenn er nichts gefühlt und nichts gesehen hätte. Mit der Gnade Gottes sammelte er viele junge Afrikaner, und als er acht Monate später nach Neapel zurückkam, begab er sich geradewegs mit den jungen Männern in den Palast, wo König Ferdinand ihn mit der ganzen königlichen Familie erwartete.
Der Monarch kam ihm einen Schritt entgegen und wollte ihn umarmen; der Pater jedoch, der seit acht Monaten darüber nachgedacht hatte, wie er sich an Danieli rächen kann, fiel ihm zu Füßen.
"Majestät, vor allem sei mir gestattet, Sie um eine Gnade zu bitten - die größte vielleicht, um die ich einen Menschen auf Erden bitten kann!"
"Was brauchst du? Sprich!" sagte der König. "Du weißt, wie sehr ich dich liebe! Habe ich dir je etwas abgeschlagen?"
"Majestät, mein Gesuch überschreitet alles Maß, und ich werde meine Bitte nur dann zu äußern wagen, wenn Sie mir sagen: Was immer für eine Gnade du verlangst, sie sei dir im voraus gewährt."
Der König umarmte den Pater und sprach: "Rede ohne Furcht! Wenn man deine Aufregung sieht, so sollte man wirklich meinen, dass du die Hälfte meines Reiches verlangst!"
"Mehr als das, Majestät!" sagte endlich der Pater, von der Erregung überwältigt. "Um was ich Sie bitte, das ist nichts Geringeres als die Begnadigung Danielis, der seit mehreren Jahren in Ägypten in der Verbannung lebt."
"Wer? Danieli?" unterbrach ihn der König, dessen Augenbrauen sich finster zusammenzogen. "Diesen Menschen, der zu den Galeeren verurteilt war und dessen Strafe ich in lebenslängliche Verbannung verwandelt habe, und der zum Dank dafür nicht aufhört, Verschwörungen gegen mich anzuzetteln?"
"Ja, der ist es!" antwortete der wieder ruhig gewordene Pater.
""Was hat er denn für dich tun können, Mann Gottes, dass du vergisst, was du deinem König, deinem Freund, schuldig bist, um ihm auf Umwegen die Gnade zu entreißen, die du von seiner Gerechtigkeit nicht hättest erlangen können?"
"Majestät, so gering und elend ich auch sein mag, ich möchte Sie veranlassen, die schönste Tugend, die Verzeihung der Beleidigung, zu üben!"
"Schon gut, schon gut!" rief Ferdinand, indem er seinen Zorn wie eine Versuchung abschüttelte. "Ich nehme mein Wort nicht zurück, obschon du mich hinterlistigerweise überrumpelt hast. Nur will ich, dass du mir sagst, was dich bewogen hat, dich einer so schlechten Sache mit so viel Wärme anzunehmen!"
Diesmal erreichte die Verlegenheit des heiligen Mannes ihren Höhepunkt. Wie hätte er sagen können, dass er von Danieli eine Ohrfeige und den schrecklichen Auftrag erhalten hat, sie dem König zu übermitteln. Das widerstand seiner Demut, seiner Ehrfurcht vor der königlichen Majestät.
"Unmöglich!" murmelte er endlich. "Möge es Ihnen genügen, zu erfahren, dass Danieli mir einen großen, sehr großen Dienst geleistet hat, und dass meine Dankbarkeit gegenüber ihm derjenigen gleichkommt, die ich bis zu meinem letzten Seufzer für Ihre Majestät hegen werde."
Ferdinand, der irgendeinen geheimen Tugendakt dahinter vermutete, drang nicht weiter in ihn, sondern sagte lächelnd: "Ich muss also auch dich begnadigen, aufrührerischer Untertan, der du dich weigerst, deinem König zu gehorchen! Sprechen wir nicht mehr davon und schieben wir die Mahlzeit der afrikanischen jungen Männer, die auf uns warten, nicht länger auf."
Der König hielt Wort. Am anderen Tag gab er Befehl, Danieli amtlich bekannt zu geben, dass ihm, auf die persönliche Vermittlung des Pater Ludwig hin, vollständige Begnadigung gewährt sei. Auch befahl er dem Polizeipräfekten, ihm den Begnadigten gleich nach seiner Rückkehr aus dem Exil zuzuführen. Er wollte von Danieli erfahren, was der Ordensmann ihm verheimlicht hatte. Danieli, zuerst verwirrt, zeigte sich seiner beiden Wohltäter würdig, und indem er sich vor dem König niederwarf, gestand er alles.
Weniger von der Schmach ergriffen, die ihm selbst widerfahren war, als von der Seelengröße des Pater Ludwig, hob der König den reuigen Verbrecher auf und sprach zu ihm: "Alles ist vergessen! Der Mann Gottes hat mir meine Christenpflicht vorgeschrieben. Da wir beide beleidigt worden sind, so müssen wir auch beide verzeihen. Er hat dir dein Vaterland wiedergeschenkt; ich gebe dir aus meiner Privatkassette eine Leibrente."
So endete die Geschichte, worin der König, der Mönch und der bekehrte Verbrecher sich alle gleich groß zeigen: der Mönch durch Heiligkeit, der König durch Güte, der Sünder durch Reue.
Der Epilog ist ebenso rührend wie die Geschichte. Nachdem Danieli den Palast verlassen hatte, suchte er den Pater Ludwig auf, und als er in der Stadt mit ihm zusammentraf, warf er sich ihm zu Füßen, die er mit Küssen und Tränen bedeckte. Der heilige Mann hob ihn auf, richtete die sanftesten Worte an ihn und hielt ihn lange ans Herz gedrückt. Ja, ich kann sagen, dass er ihn da festhielt: denn Danieli beschloss, die Welt zu verlassen. Er trat als einfacher Laienbruder in das Kloster von Palma, dessen Oberer Pater Ludwig war. Er lebte da in Tränen süßer Buße unter den Augen seines vielgeliebten Vaters; nach Ablauf seiner Zeit starb er daselbst als Auserwählter.
(Ludwig wurde am 18.4.1993 von Papst Johannes Paul II. seliggesprochen und am 23.11.2014 von Papst Franziskus heiliggesprochen.)
________________________________________________________________________

18. Der alte Brief - Von Hermann Weber
Vor kurzem besuchte ich einen alten Freund in der Großstadt; er ist Tischlermeister und nennt ein umfangreiches Geschäft sein eigen. Ich kam am Abend gänzlich unerwartet zu ihm und fand ihn zwischen seinen alten Andenken und Erinnerungssachen kramen.
Auf seinem Tisch lagen die sonderbarsten Gegenstände, wie sie von jedem sinnigen Menschen aufbewahrt werden: verblichene Photographien von Jugendfreunden, kleine Erinnerungen an die Militärzeiten, Andenken, die man auf der Reise gesammelt hat usw., die für gewöhnlich den Fremden nicht interessieren.
Aus einem besonderen Fach entnahm der Freund jetzt aber einen sorgfältig in Tuch eingehüllten flachen Gegenstand von viereckiger Form, den er mir mit bedeutsamem Blick zureichte.
"Mein Retter in letzter Stunde!" sagte er dabei.
Befangen von dem ernsten Aussehen des sonst so frohgemuten Mannes, öffnete ich die Verhüllung und erblickte ein augenscheinlich sehr oft gelesenes altes Schriftstück, das indessen so vergilbt war, dass man die Schriftzüge kaum noch entziffern konnte; an der Größe und Form des Papieres sah ich aber, dass dieses Andenken ein von schwacher, ungeübter Hand geschriebener Brief war, der wohl zum Leben meines Freundes in besonderer Beziehung stand.
Um Aufklärung bittend, gab ich das Schriftstück zurück, und eine kurze Zeit später erzählte mir der gereifte Mann eine Erinnerung aus seiner Jugend, in der dieser vergilbte Brief eine wichtige Rolle spielte.
"Da ich die Eltern früh verloren habe, kam ich zu Verwandten, die mich vielleicht nur darum aufnahmen, weil mein verstorbener Vater eine kleine Summe erspart und diese für meine Erziehung festgelegt hatte", begann mein Freund. "Zwischen fünf älteren, robusten Jungen wuchs ich auf und sah und hörte wenig Gutes. Meine Pflegeeltern kümmerten sich wenig um unser Treiben, und so konnte es nicht ausbleiben, dass ich bald die Gewohnheiten der großen Jungen angenommen hatte und ihre bösen Streiche sorglos mitmachte. So wurde ich mit der Zeit ein aufgeweckter, frühreifer Junge, wusste überall meinen Vorteil wahrzunehmen und verspürte wenig Lust zu ernster Arbeit.
Als ich aus der Schule entlassen war, gaben mich meine Pflegeeltern bei einem Tischlermeister in die Lehre. Zuerst war mir alles neu und interessant und ich griff wacker mit zu, doch bald erlahmte mein Eifer; wenn ich dann an die lustige Jungenzeit zurückdachte, hätte ich ohne weiteres fortlaufen mögen, doch wusste ich recht gut, dass ich bei den Pflegeeltern dann kein Unterkommen gefunden hätte.
So hielt ich meine Lehrzeit aus. Als ich dann Geselle geworden war, sparte ich mir einige Mark, packte heimlich meine Sachen und reiste hierher, denn das Leben in der Großstadt hatte immer einen besonderen Reiz für mich gehabt. Was hatte ich nicht alles gehört und gelesen von dem Treiben in den großen Städten, von ihren Vergnügungen und mannigfachen Zerstreuungen! Dieses alles wollte ich jetzt auch genießen und mich dann um Arbeit bemühen.
Es kam aber alles anders, als ich es mir ausgemalt hatte.
Schon in der ersten Nacht, als ich in einem Gasthof mit mehreren Fremden auf einem Zimmer schlief, um einige Groschen zu sparen, entwendete man mir meine gesamte Barschaft und meine Taschenuhr. Meine Anzeige bei der Polizei war erfolglos. Unbekannt in der großen Stadt, bemühte ich mich jetzt um Arbeit, doch konnte ich etwas Passendes sofort nicht finden.
Zuerst verkaufte ich nun meine besten Kleidungsstücke und als dann die geringe Summe, die ich dafür erhalten hatte, verbraucht war, trug ich auch mein Werkzeug zu dem Händler. Die Lust zur Arbeit hatte ich verloren und sank rasch tiefer und tiefer, weil mir von Jugend auf die innere Festigkeit fehlte.
Verzweifelnd und heruntergekommen schlenderte ich eines Tages durch die Straßen und geriet auf einen Marktplatz, der von kaufenden Personen stark besucht war. Ich schaute umher, um vielleicht durch kurze Tätigkeit einige Groschen zu verdienen, denn ich hatte seit dem vorhergehenden Abend nichts mehr gegessen, doch ich sah niemand, der meine Hilfe begehrt hätte.
Zwei Schritte von mir entfernt kaufte eine ehrwürdige alte Frau mit schneeweißem Haar ihr Gemüse ein und packte es in eine Markttasche; neben sich stellte sie arglos ein kleines Paket, das sie wohl zur Post bringen wollte, denn es war sorgfältig umschnürt und mit einer Adresse versehen. Der Versucher flüsterte mir einen Gedanken ein.
Die alte Frau sah wohlhabend aus; konnte das Paketchen nicht Geld oder Geldeswert enthalten? War es denn unmöglich, dass ich mit einem raschen Griff meiner Not ein Ende machen konnte?
Hastig forschend schaute ich umher, doch waren die Leute viel zu sehr mit ihren Einkäufen beschäftigt, um auf mich zu achten. Jetzt bückte ich mich und machte mir scheinbar an einem Schuh zu schaffen, wobei mir das Herz wie ein Hammer gegen die Rippen pochte - dann hatte ich das Paket erfasst und schob es zitternd unter meinen Rock. Schnell richtete ich mich jetzt auf und verschwand unter der kaufenden Menge, die meine verabscheuungswürdige Tat nicht bemerkt hatte.
In einem dunklen Hauseingang öffnete ich das Paket. Es enthielt getrocknete Fleischwaren, eine kleine Summe Geld und einen Brief, den ich zu mir steckte, um ihn zu lesen, wenn ich meinen Hunger gestillt hatte. Das Packpapier verbarg ich in meiner Tasche, um es später fortzuwerfen.
An einsamer Stelle las ich dann neugierig den Brief. Er war an den Sohn der alten Frau gerichtet und weckte seltsame Gefühle in meiner Brust.
Zum ersten Mal in meinem Leben vernahm ich die Stimme einer guten Mutter, die zu ihrem Kind redet. Sie ermahnte den fernen Sohn, treu zu bleiben in allen Gefahren des Lebens, das Gute zu tun und das Böse zu meiden, und so rein und tugendhaft zurückzukehren, wenn seine Dienstzeit abgelaufen ist, wie er von ihr gegangen war.
Ich wusste nicht, wie mir geschah. Wieder und wieder las ich die wenigen Worte, die mir die heißen Tränen über die Wangen liefen und ein Schmerzgefühl in mir emporstieg, das mich zu ersticken drohte. Wie eine Hülle fiel es von meiner Seele; bittere Reue hatte mich ergriffen.
Einer solch edlen Frau durfte ich keinen Kummer bereiten; ich musste wieder gut machen, was ich gefehlt hatte.
Rasch hatte ich den Brief, das Geld und die übriggebliebenen Fleischwaren zusammengepackt, umwickelte alles mit dem zerknitterten Papier und machte mich auf den Weg. Auf der Adresse hatte ich den Namen und die Wohnung der guten Mutter als Absender gelesen und wollte jetzt zu ihr gehen und sie um Verzeihung bitten; dann mochte das Unglück über mich hereinbrechen.
Eine halbe Stunde später stand ich vor der alten Frau, die mich erstaunt und gerührt betrachtete, als ich mein Bekenntnis beendet hatte; auf die Knie aber hätte ich niederstürzen mögen, als sie mit gütiger Stimme sagte, dass sie mir verzeihe und mir beistehen wolle, um wieder auf den rechten Weg zu kommen.
Kaum fähig zu sprechen, erbat ich nur den Brief, der mir ein Leitstern sein soll fürs ganze Leben; sie reichte ihn mir gleichzeitig mit einem kleinen Geldbetrag und hieß mich dann gehen und am folgenden Tag wiederkommen.
Mit seltsam froher Zuversicht legte ich mich am Abend zur Ruhe nieder; ich wusste, das der starke Gott, der meine Reue gesehen und meine Vorsätze gehört hatte. mich nicht untergehen lassen würde.
Die gute Frau ist mir eine wahre Mutter geworden.
Sie schenkte mir einige Kleidungsstücke ihres Sohnes und streckte mir auch eine kleine Summe Geld vor, damit ich die erste Not überstehen konnte. Von ihren Wünschen begleitet, begann ich das neue Leben. Nach und nach arbeitete ich mich empor, war sparsam und bescheiden und brachte es bald soweit, dass ich ein kleines Geschäftchen selbstständig übernehmen konnte.
Der Sohn der alten Frau wurde mir ein treuer Freund, mit dem ich noch heute eng verbunden bin; seine greise Mutter habe ich beständig wie eine Heilige verehrt, und als ihre Stunde schlug und man sie zur letzten Ruhe hinausbrachte, weinten wir beide an ihrem Grab.
Der Brief aber, den sie einst mit zitternder Hand an den fernen Sohn schrieb, ist mir das teuerste Andenken, das ich besitze.
________________________________________________________________________

19. Der Lohn des Opfers - Von Silesia
Aus dem Tal herauf tönte der Klang der Abendglocke. Er drang an das Ohr einer etwa fünfundzwanzigjährigen jungen Frau, die im Baumgarten des Lindenhofes beschäftigt war, getrocknete Wäschestücke von der Leine zu nehmen. Alsbald hielt Therese in ihrer Beschäftigung inne, trat an den Lattenzaun, der den Garten von der Dorfstraße trennte, und betete den Engel des Herrn. Während sie noch in Andacht versunken hinüber zu dem Kirchlein blickte, das sich aus dem Grün stattlicher Bäume freundlich abhob, näherte sich die Gestalt eines jungen Mannes. Es war ein frischer, kräftiger Bursche, Ende der zwanziger Jahre, mit einem biederen, treuherzigen Gesichtsausdruck.
Als er das Mädchen gewahrte, flog ein Lächeln der Freude über sein Antlitz und seine Schritte beschleunigend, rief er: "Grüß Gott, Therese! Das nenne ich Glück, dich hier zu treffen!"
"Grüß Gott, Paul", lautete die Antwort, und man konnte bemerken, dass sich auch des Mädchens eine freudige Erregung bemächtigte, als es den jungen Mann vor sich sah. Bald aber wich dieser Ausdruck aus ihren Zügen, als der junge Mann, nähertretend, fragte: "Nun, wie ist`s, Therese, hast du dich entschieden?"
"Nein, Paul, ich komme nicht. Es kann nicht sein", kam es ernst von des Mädchens Lippen.
"Es kann nicht sein? - Also wirklich nicht?" Langsam und zögernd kamen diese Worte von des jungen Mannes Lippen und sein hübsches Gesicht verfinsterte sich. "Aber, Therese, wie kannst du mir das antun? Du weißt doch, dass ich keinen höheren Wunsch kenne, als dich als meine Frau auf meinen Hof führen zu können, und jetzt sagst du, es kann nicht sein!?"
"Paul, du kannst versichert sein, dass ich gerne, sehr gerne deine Frau geworden wäre", entgegnete das Mädchen traurig. "Aber es kann nicht sein. Die Pflicht fordert von mir, dass ich hier bleibe."
"Die Pflicht? - Möchte wissen, was dich die Kinder aus deines Vaters zweiter Ehe angehen", lautete die in vollster Bitterkeit gegebene Antwort. "Das ist zu zweit gegangen, meine ich."
"Nein, Paul, das ist es nicht", erwiderte das Mädchen.
"Sieh`, das Leben meiner Stiefmutter ist nur noch auf Tage berechnet. Dann stehen die drei Kinder allein, ganz allein in der Welt. Bleib` ich nicht hier, wird der Hof verkauft und den Geschwistern geht die Heimat verloren. Ich habe es dem Vater versprochen und jetzt auch der Mutter, dass ich die Kinder nicht verlassen werde, ihnen die Heimat erhalten will."
Unwillkürlich war der bittere Zug aus des jungen Mannes Antlitz verschwunden.
"Rechtschaffen bist du, Therese, das ist wahr", sagte er bewundernd, "nur dass ich gerade das Opfer bringen und dich aufgeben muss, kommt mir so sehr schwer an."
"Meinst du vielleicht, Paul, ich brächte kein Opfer?" fragte das Mädchen leise. "Aber aus diesem Grund wird das Verdienst, das wir haben, um so größer sein." In diesem Augenblick näherte sich eine Magd schnellen Schrittes vom Haus her.
"Therese, schnell, schnell, die Bäuerin verlangt nach Ihnen", rief sie. "Die Schwester meint, es ginge zusehends abwärts mit ihr."
Einen Augenblick lagen die Hände der jungen Leute ineinander. Ein "Behüt` Gott" von hüben und drüben. Dann eilte das Mädchen ins Haus, indessen der junge Mann langsam und bedrückt den Weg zurückging, den er fröhlichen Mutes herabgekommen war.
"Ist mir`s doch, als hätte der Hagel meine Felder verwüstet, seit ich Therese verloren hab`", sagte er vor sich hin. "aber dennoch kann ich nicht anders sagen, als dass ich sie jetzt noch viel höher schätze wie vordem. Eine Kleinigkeit ist`s nicht, sich für seine Familie zum Opfer zu bringen. Wer macht`s ihr wohl nach?"
Drei Tage später wurde die Lindenbäuerin begraben . . . .
Außer dem Trauerfall wird lebhaft der Umstand besprochen, dass Therese die Werbung des jungen, reichen und angesehenen Berghofbauern ausgeschlagen habe, um den drei Kindern aus der zweiten Ehe ihres Vaters, dem neunjährigen Franz, dem siebenjährigen Joseph und der vierjährigen Marie, die Heimat zu erhalten.
"Sie wird tüchtig wirtschaften müssen, denn der Lindenbauer hat in den letzten Jahren vor seinem Tod viel zugesetzt. Das Gut ist stark verschuldet und ein Frauenzimmer allein; - wer weiß, ob sie es schafft."
All diese Vermutungen hörte Therese nicht. Vom Grab der Stiefmutter hinweg war sie noch einmal in die Kirche gegangen. Dort kniete sie vor dem Tabernakel nieder und bat Gott, ihr Opfer in Gnaden annehmen zu wollen, und ihr seinen Segen zu dem schweren Werk zu geben. das sie entschlossen war, zu bringen.
Seit jenem Tag ist manches Jahr vergangen. Achtzehnmal wechselten Frühling und Herbst.
Es ist zur frühen Sommerzeit, als eines Tages lebhaft bewegtes Leben auf dem Lindenhof herrscht. Mägde eilen geschäftig einher, die an sich herrschende Sauberkeit noch zu erhöhen. Zwei Knechte sind beschäftigt, am Tor und an der Haustür frische Birkenbäumchen einzupflanzen, und ein junges Mädchen hängt Kränze aus lichtem Tannengrün auf. Aus der Küche dringen lockende Festtagsgerüche und in den wohnlich eingerichteten Zimmern des ersten Stockwerks wölben sich die hochgetürmten Daunenbetten.
Eben hat die Lindenbäuerin, wie Therese seit dem Tod der Stiefmutter genannt wird, noch einmal alles genau gemustert. Jetzt geht sie in ein Zimmer, das eine schöne Aussicht auf die Kirche im Tal gewährt. Dort stellt sie auf einem Schreibtisch Papier, Tinte und Feder zurecht und rückt ein schönes Kruzifix ins rechte Licht. Dann öffnet sie einen Schrank und lässt ihre Blicke auf einer völlig neuen Priestergewandung ruhen.
In diesem Augenblick ruft unten eine Stimme: "Sie kommen, sie kommen!"
Und mit jugendlicher Hast eilt Therese trotz ihrer vierzig Jahre hinab in den Hof, auf dem soeben ein offenes Wägelchen einbiegt.
"Franz, Joseph, Gott grüß euch!" ruft Therese, und nun wird sie von zwei jungen Leuten aufs herzlichste begrüßt. Der ältere, in Lodenjoppe und Spitzhütchen, zeigt das Bild des kräftigen Landwirts, während der jüngere in seiner schwarzen Kleidung den Neupriester verrät.
Und nun tretet näher", mahnt Therese, "die lange Fahrt wird euch Hunger gemacht haben."
Bald sitzen die Geschwister, einschließlich des jüngeren Schwesterleins, fröhlich um den Tisch und nun geht`s ans Erzählen.
Der junge Landwirt hat in einer fernen Stadt eine militärische Übung mitgemacht und im Anschluss daran der Priesterweihe des jüngeren Bruders beigewohnt. Alle die festlichen Vorbereitungen aber gelten dem morgigen Tag, an dem der Neupriester in der Kirche des Heimatortes Gott sein Erstlingsopfer darbringen soll. Ein sinnender Ernst lagert auf den Zügen des jungen Mannes, als er seine Hand der treuen Hüterin seiner Jugend entgegenstreckt.
"Wie soll ich, wie sollen wir alle dir danken, Schwester Therese, was du uns getan hast?" sagt er. "Treu wie die beste Mutter hast du für uns gesorgt. Hast dich gemüht, uns unser irdisches Besitztum zu erhalten und zugleich dich bestrebt, uns für Höheres heranzubilden. Möge Gott es dir vergelten, was du uns getan hast."
Wortlos legten die Geschwister ihre Hände auf die harte, arbeitsgewohnte Hand der älteren Schwester. In deren Augen standen Tränen. Vor ihrer Seele glitt jener Abend im Baumgarten draußen vorüber. Hatte sie damals in Selbstlosigkeit ein Opfer gebracht, wurde ihr heute reichlicher Lohn dafür.
________________________________________________________________________

20. Nehmt mich zum Vorbild! - Von Franz Clute-Simon
In der altindischen Fabelsammlung Pantschatantra finden wir eine beachtenswerte Erzählung, die etwa folgendermaßen lautet:
Eines Morgens trafen sich an einer Quelle, die unweit einer Karawanserei sprudelte, drei Wanderer. Der eine von ihnen war ein Künstler, der andere ein Greis mit ehrfurchtgebietendem Antlitz, der dritte ein Knabe, der einem verirrten Lämmlein nachspürte. Über dem Becken der Quelle war eine Inschrift, uralt und deshalb halbverwittert, welche hieß: Nehmt mich zum Vorbild!
Während die drei Wanderer sich ausruhten, sprachen sie über die Bedeutung jener Mahnung. "Dieser Quell", sagte zuerst der Künstler, "nimmt seinen Lauf durch ein langgedehntes Tal; er fließt durch Seen, nimmt Bäche und Flüsse in sich auf und wird zuletzt zum großen Strom. Die Inschrift lehrt uns, dass man rastlos arbeiten und vorwärts streben muss, um sich zu bereichern."
"Ich", entgegnete der Greis, "finde einen anderen Sinn in diesem Spruch; der Quell erquickt freigebig alle, die sich ihm nähern. Sein Beispiel mahnt uns, unseren Mitmenschen nützlich zu sein, wo und wie wir immer können."
Der Knabe hatte schweigend den beiden anderen zugehört. Als sie ihn aber jetzt aufforderten, auch seine Ansicht über die Inschrift und ihre Auslegung kundzutun, antwortete er ohne Zögern: "Das Wasser einer Quelle ist nichts, wenn es nicht ganz rein ist. Getrübt wird es zum Ekel, und selbst die Tiere verschmähen es. Die Schrift bedeutet also: Wenn du geachtet sein willst, sei rein!"
Eine tiefsinnige Fabel, von reichem Inhalt für uns Christen nicht minder als für die indischen Anhänger des Brahma.
Die Jagd nach Reichtum und Besitz, nach Ehre und Ansehen ist auch für so manche aus den Nachfolgern Christi der Ansporn zu rastlosem Schaffen, Ringen und Streben, wobei aber der wichtigere Teil, die Sorge für Seele und Jenseits, ganz oder zu sehr aus den Augen verschwindet. Und doch heißt schon der alte Römerspruch: "ora et labora", "bete und arbeite", und die hl. Schrift sagt im Evangelium: Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zugegeben werden. Das sei deshalb für uns die erste Mahnung der Quelleninschrift, dass wir uns vor allem Schätze sammeln im Himmel, die weder Rost noch Motten verzehren und Diebe nicht ausgraben, noch stehlen. Der Dichter Rückert sagt so schön:
Was du Ird`sches willst beginnen, heb` zuvor
Deine Seele im Gebet zu Gott empor!
Einen Prüfstein wirst du finden im Gebet,
Ob dein Ird`sches vor dem Göttlichen besteht.
Dem Greis ähnlich sind die, die die Bedeutung des göttlichen Gesetzes erfasst haben und befolgen: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! Aber sehr oft handeln auch die noch nicht ganz im Sinne Christi und seiner Lehre, wenn sie nämlich, wie es häufig vorkommt, in der lobenswerten Sorge für das eigene und fremde Heil und Wohl zu Mitteln greifen und Wege beschreiten, die sie nur verteidigen und rechtfertigen können mit dem berüchtigten Satz: Der Zweck heiligt die Mittel.
Erst wer so handelt, wie der dritte Wanderer, der Hirtenknabe, die Inschrift deutet, wer in allen seinen Handlungen, in Gedanken und Wünschen nach reinen, edlen Motiven verfährt und nur unbefleckte Wege geht, der befolgt im rechten Sinn die Mahnung der Inschrift, der hört bei allem, was er denkt und tut, den göttlichen Heiland, die Quelle aller Lebensweisheit, sprechen: "Nehmt mich zum Vorbild!"
________________________________________________________________________

21. Bruderliebe - Von Elsbeth Düker
Stets war Franz der guten Mutter Liebling gewesen, ein freundliches Kind und so still und sinnig. Als bildhübscher junger Mann war Franz nicht wie die anderen jungen Leute seines Alters; er blieb für sich oder ging an Sonntagen lieber mit seinen drei Schwestern aus, als dass er sich zu den lebhaften Kameraden gesellt hätte. Franz war wohl ein geborener Junggeselle und blieb es bis zu seinem Tod in den siebziger Jahren. Doch eine echte Franziskusseele steckte in dem jungen Mann: Er konnte sich über alles so herzlich freuen, über die schöne Gottesnatur, die liebe Sonne, über all die frohen Menschen, die ihm am Weg begegneten, und schon als Kind brachte er jedes Blümchen, das er fand, oder bunte Steinchen und Federchen glückstrahlend seiner lieben Mutter.
Alle Menschen hatten den guten Jüngling gern, dem die Unschuld aus den sanften Augen leuchtete. Und als er Neigung zum Kaufmannsstand zeigte, fand sich gleich ein altes Ehepaar, das ihn in sein blühendes Geschäft aufnahm, mit der sicheren Aussicht, es ihm später abzutreten.
Noch lebte die alte Mutter und freute sich dieser guten Lebensstellung ihres Jüngsten, wie auch die Schwestern es taten.
Da kam unverhofft aus dem fernen Nord-Amerika schlimme Kunde von dem ältesten Bruder, der dort im Staat Kansas schon seit vielen Jahren ein gutes Geschäft betrieb. Er war verheiratet und hatte neun Kinder. Diese Bruder schrieb von Aufruhr und Krieg im Land, Krieg gegen die Sklaverei, und bat seinen jungen Bruder, den er ledig und los daheim wusste, mit bewegten Worten, doch herüberzukommen und statt seiner in den Krieg zu ziehen.
Der gute Franz besann sich nicht lange, sein großes Lebensopfer für den bedrängten Bruder zu bringen. Er ließ Mutter und Schwestern trauernd zurück, ließ sein Geschäft und damit die sichere Lebensstellung fahren und dampfte über den Ozean. So konnte der verheiratete Bruder bei seiner zahlreichen Familie bleiben und sorgen, dass sein Geschäft in den bösen Kriegszeiten erhalten bliebe.
Voll Dankbarkeit schloss der amerikanische Bruder den Ankömmling in seine Arme, der alsbald schon nach seiner Ankunft in der Neuen Welt als Ersatzmann für den Bruder in den Krieg hinauszog.
Welche Gefahren und Strapazen lauerten dort im fremden Land auf den guten Franz, der in der langen Kriegszeit gar oft dem Tod in verschiedener Gestalt in die Augen sehen musste.
Einst krepierte eine Granate über seinem Kopf, so dass er nur wie durch ein Wunder dem Tod entging; doch Gesicht und Gehör haben die Folgen dieses schrecklichen Ereignisses nie wieder ganz verloren.
Ein anderes Mal befand sich Franz während des traumlosen Schlafes der Erschöpfung in höchster Lebensgefahr. Ein wilder Mann von seiner Truppe, die aus den verschiedensten Elementen zusammengesetzt war, nur einige in demselben Streben, gegen die unwürdige Sklavenherrschaft bis auf das Blut zu kämpfen, ruhte an seiner Seite gleichfalls auf einer Wolldecke. Plötzlich springt der Wilde, der wach geworden ist, auf und reißt den schlaftrunkenen Franz mit aller Kraft von seinem Lager. Ohne sich mit Worten verständlich machen zu können, zeigt der zitternde Mann auf eine handlange Schlange, eine Viper, die sich gerade anschickt, unter Franzens Wolldecke hervor auf den friedlich Schlummernden zuzukriechen. Hätte sie ihn auch nur ein klein wenig mit ihren Giftzähnchen verletzt, so wäre er in einer halben Stunde schon tot gewesen - gestorben im fremden Land und ohne die heiligen Sakramente.
Jedoch die schlimmste Not, die Franz mit Übernahme der Vertretung seines Bruders auf sich genommen hatte, machte sich erst geltend, als er zu der schrecklichen Geißel des Krieges sich noch das Gespenst der Hungersnot gesellte. Das musste furchtbar gewesen sein! Und als diese Not auf das höchste gestiegen war, begab sich Franz in das nahe Gehölz. Und hier, allein mit seinem Gott, betete er inbrünstig:
"Du lieber, himmlischer Vater, erbarme dich doch unserer schrecklichen Not! Siehe, ich habe mich doch nun für meinen Bruder aufgeopfert, aus christlicher Nächstenliebe. Soll das nur geschehen sein, damit ich nun mit meinen armen Kameraden hier des schrecklichen Hungertodes sterben soll ohne die Gnadenmittel meiner heiligen Kirche? Das wirst du in deiner Güte doch nicht zulassen."
Kaum hatte Franz geendet und näherte sich wieder dem Lagerplatz, so vernahm er das unerklärliche Jubelgeheul der Mannschaft, die einem Proviantwagen entgegenstürzte, der mit Schiffszwieback angefüllt war. Wer beschreibt die Freude der armen halb verhungerten Krieger!
Endlich nahm auch der Krieg ein Ende, und Franz kehrte trotz der zweiunddreißig Gefechte, an denen er teilgenommen hatte, zu seinem Bruder zurück. Dieser sowohl wie seine Familie überhäuften den edlen Wohltäter mit Dankbezeugungen. Von der Regierung wurde ihm in der Nähe von seines Bruders Besitzung ein Stück Land zuerteilt, das er urbar machen und sich zur Farm anbauen sollte. Es gelang ihm alles nach Jahren angestrengten Fleißes, doch vermisste er stets den Segen des gewohnten regelmäßigen Gottesdienstes.
Nach fast vierzig Jahren war das Heimweh, das ihn nie verlassen hatte, so stark geworden, dass es den alten Franz in seine Heimat zurückführte, trotzdem sein Bruder und die vielen Kinder ihn gern in ihrer Nähe behalten hätten.
Die Kindessehnsucht seines frommen Herzens nach dem schönen katholischen Gottesdienst, dessen jahrelanges Entbehren ihn trotz äußeren Wohllebens doch innerlich verarmt und verödet hatte, trieb ihn eines Tages, als alles geregelt war, zurück in die alte Bischofsstadt, die die Tage seiner Kindheit und Jugendzeit gehütet hatte. Natürlich traf er die Eltern längst nicht mehr auf Erden an. Doch fand er seine drei lieben alternden Schwestern noch, wovon die älteste Barmherzige Schwester war. Eine andere wirkte als katholische Lehrerin; und der führte die jüngste Schwester den Haushalt. Hier fand der alte Mann den ersehnten friedlich-stillen Lebensabend, bis ihn eine schwere Krankheit nach guter Vorbereitung hinübernahm. Mit großer Ausdauer und Freude lernte Franz noch in den letzten Lebensjahren das Holzschnitzen. Und manches schöne Möbelstück im Haushalt der Schwestern gibt Zeugnis von der Kunst, zu der er es noch in hohen Jahren gebracht hatte.
Nun deckt seit kurzem die Heimaterde seinen müden Leib; und kein prahlendes Denkmal erzählt der Nachwelt von dem stillen großen Opfer seiner Bruderliebe, an dem Franz gewiss im Jenseits die größte Freude haben wird.
________________________________________________________________________

22. Das Pünktchen
Ein halbes Jahr vor seinem Tod hielt der berühmte Jesuitenpater Pachtler einmal in einer Gemeinde geistliche Exerzitien ab. Mit großer Innigkeit sprach der greise Pater von der Rettung unserer unsterblichen Seele, das sei unser letztes Ziel; wenn dies erreicht sei, sei alles erreicht. Er sprach von der Eitelkeit des Irdischen. Um seinen Zuhörern dies recht tief einzuprägen, fuhr der Pater also fort: "Wenn die Seele beim Tod sich vom Leib getrennt hat, dann muss sie weit, weit fort von hier in ein unbekanntes Land. Wenn sie dann auf die Erde zurückblickt, so erscheint sie ihr nurmehr wie ein kleiner Punkt, und auf diesem kleinen Punkt ist noch ein viel kleineres Pünktchen, um dessentwillen die Seele vielleicht den Himmel verlor." Ernst klangen seine Worte in die Ohren seiner Zuhörer, die mit gespanntester Aufmerksamkeit dem greisen Redner die Worte von den Lippen nahmen. Kaum wagte jemand zu atmen - man sah das rührende Schauspiel, wie die Seelen in der Stille des eigenen Innern sich abmühten, um fertig zu werden mit einer übermächtigen Leidenschaft oder einem Gewohnheitsfehler, der abgelegt werden sollte, wenn sie nicht das kleine "Pünktchen" werden sollten, um dessentwillen die Seele den Himmel einst verlieren würde! Vielleicht sah der eine oder andere solch ein kleines "Pünktchen" in seinem Leben, das so, im Licht der Ewigkeit betrachtet, zur Lawine anwuchs, die seine Seele in den Abgrund zu ziehen drohte. Ein "viel kleineres Pünktchen" wird uns beim Tod alles sein, was nicht einen Wert für die Ewigkeit hat. O fürchterliches Erkennen! Eine nichtige Ehre, ein ungerechtes Gut, eine sündhafte Freude, oder jene Lust, die ich genug genannt habe, wenn ich sage, dass ich sie nicht nennen will - alles schrumpft am Ende zusammen zu dem furchtbaren "kleinen Pünktchen". Selbst ein Lebensglück, ein Gut, dessen Besitz jetzt unsere ganze Welt zu sein scheint, das so groß, so begehrenswert uns erscheint, dass wir alles andere dafür lassen möchten, sehen wir beim Tod ohne Vergrößerungsglas als das "kleine Pünktchen", das uns ewig von Gott trennt.
Sehen auch wir uns in unseren Herzen und Leben um, ob da nicht auch ein solches "kleines Pünktchen" sich findet; wenn, so lassen wir die Zeit nicht vorübergehen, ohne es fortzuräumen.
________________________________________________________________________

23. Wohlzutun ist Christenpflicht - Von Georg Bleibetreu
Der gute alte Herr mit dem weißen Bart war im Städtchen allgemein bekannt. Vater Hellmut wurde er gewöhnlich genannt, und die meisten Leute kannten weder den Vornamen noch den Nachnamen des alten Herrn. Aber man musste, dass der Herr mit dem weißen Bart ein mitleidiges Herz besaß und auch für die Armen und Notleidenden etwas übrig hatte. Davon konnte schon manche arme Arbeiterfamilie erzählen. Aber er wirkte im stillen und mied jede Ehrung und verbot jedem, seinen Namen in die Öffentlichkeit zu bringen. Herr Hellmut war früher Kaufmann in der Großstadt gewesen, und da er stets auf dem Posten und das Glück ihm hold war, so hatte er ein hübsches Sümmchen zurückgelegt. Aber ein Schmerz drückte den Mann doch sehr, und das war, dass die Ehe kinderlos lebt. Das Geld musste also an entfernte Verwandte fallen. Als seine Frau krank wurde und starb, da stand der Mann allein in der Welt da und wusste nicht recht, was er machen sollte. An dem Geschäft hatte er fortan keine Freude mehr, und noch weniger Gefallen fand er jetzt an dem unruhigen Leben in der Großstadt. Er sehnte sich nach Ruhe und Erholung in einem stillen Winkel. Bald war ein Käufer für sein Geschäft gefunden und der Tag rückte heran, da er aus dem Getriebe der Großstadt herauskam. Als Ruhesitz hatte er sich ein freundliches Landstädtchen in Westfalen ausgewählt, weil er hier in seiner Jugendzeit mehrere Jahre gewohnt hatte. Hier hatte er nämlich als Lehrling in einem altbekannten Geschäft drei Jahre lang gelernt und so Leute und Stadt näher kennen gelernt. Hier wollte er nun auch die letzten Tage in Ruhe und Frieden verbringen. So reiste er dahin ab und war froh, als er sich fern dem Getriebe der Großstadt fühlte.
In der Großstadt hatte Herr Hellmut zwar seinen Glauben nicht verloren, noch war er lau in seinen religiösen Pflichten geworden, aber die Geschäftsarbeiten gestatteten ihm doch weniger die Kirche an den Wochentagen aufzusuchen, als er wohl gewünscht hätte. Nun aber konnte er häufiger zum Gotteshaus eilen und dem erhabenem Opfer beiwohnen. Und das tat er auch. Jeden Morgen sah man den alten Herrn mit dem weißen Bart in einer Bank vor dem Josephsaltar knien, und es war ergreifend, ihn in tiefer Andacht versunken zu sehen. An diesem Bild konnte sich fürwahr jedermann erbauen.
Der Heiland sagte einst: "Es ist schwer, dass ein Reicher in das Himmelreich eingehe." Nicht wegen des Reichtums ist es schwer, sondern weil die meisten von ihnen sich von dem Mammon nicht trennen können und das Geld nicht so anwenden, wie sie es eigentlich tun sollten. Niemand kann aber bekanntlich zwei Herren dienen. Gottes und des Mammons Freund zugleich kann niemand sein. Wer zu sehr an dem Geld klebt, wer in den irdischen Dingen und Geschäften ganz aufgeht, der vergisst bald für sein ewiges Heil etwas zu tun. Für den Leib und das Irdische alles, für die Seele und den Himmel wenig oder gar nichts!
Ganz anders dachte Hellmut. Er klebte nicht an dem Geld, sondern gab reichlich Almosen. Das sprach sich schnell herum und an Bittstellern war fortan kein Mangel mehr. Auch der Herr Pfarrer hatte bald ein allerliebstes Brünnlein entdeckt. Wenn er nämlich in Geldnöten war, oder wenn eine arme Familie den Ernährer verlor, oder wenn Witwen und Waisenkinder in ihren dünnen Kleidern und Röckchen froren, dann griff der Herr Pfarrer zum Knotenstock und ging zu Hellmut hinüber. Mit der größten Freundlichkeit wurde er hier empfangen, - und das will für einen Bettler bekanntlich viel sagen - und wenn der Herr Pfarrer auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fiel, endlich musste er es ja doch sagen, und dann lachte der alte Herr gar freundlich und verschwand für einige Augenblicke im Nebenzimmer. Bald kehrte er zurück und der nun folgende Händedruck tat nicht nur dem direkten Empfänger wohl, sondern noch viel mehr den Armen und Notleidenden der Gemeinde. So trocknete der Mann gar manche Träne im Stillen, denn niemand erfuhr seinen Namen und mancher hat vielleicht gedacht: unser Herr Pastor muss doch ein großes Einkommen haben, denn sonst könnte er nicht so reichliche Almosen austeilen.
In der Pfarrkirche gab es noch keine bunten Fenster. Eines Tages aber wurden die alten Chorfenster fortgenommen und durch neue ersetzt. Das waren Prachtstücke. In dem Glas waren herrliche Figuren sichtbar und darunter standen auch die Namen der Heiligen. Durch die buntbemalten Scheiben flutete das Sonnenlicht und glitzerte und schillerte sich an den Wänden und auf dem Boden wieder. Nun betete es sich noch einmal so gut in dem Kirchlein. Bald folgten die übrigen buntbemalten Fenster nach. Die Kirche wurde schön ausgemalt, sie erhielt neue Stationen, neue Beichtstühle, eine neue Kanzel, ja sogar eine neue Orgel. Wer war der freundliche Spender gewesen? Jeder Leser wird es bereits erraten haben. Kein anderer war es als der alte Herr mit dem weißen Bart.
In der nächsten Nähe des Ortes lag ein kleines Bauerngut. Der Besitzer, der ehedem zu den wohlhabendsten Leuten des Ortes zählte, hatte den Krebsgang eingeschlagen. Das Schnapstrinken hatte ihn auf diese elende Bahn gebracht. Im Laufe der Zeit war ihm ein Teil seines Besitzes nach dem anderen Verkauft worden, und nun stand als letzte Habe sein Landhäuschen, umgeben von 10 Morgen Land und einem reizenden Obst- und Gemüsegarten, unter dem Hammer. Der alte Herr hatte von dem Verkauf gehört und sofort stieg ein guter Gedanke in ihm auf. Er ging zum Herrn Pfarrer hinüber und meinte, das Häuschen eigne sich vorzüglich zu einer kleinen Wohltätigkeitsanstalt. Die Lage und die Umgebung sei dazu wie geschaffen. "Wir wollen es erwerben!" Der Herr Pfarrer war damit einverstanden und schon nach kurzer Zeit wurde das Anwesen für Herrn Hellmut am Gericht registriert und der schenkte es der katholischen Gemeinde.
Nun brach eine neue Sorge über den Herrn Pfarrer herein, denn er wusste eigentlich nicht, was er mit dem Grundstück anfangen sollte. Während er so darüber nachdachte und durch das Fenster zum Fliederstrauch hinüberblickte, der aus dem nahen Garten seinen lieblichen Duft herübersandte, klingelte es. Bald meldete die Wirtin, dass ein Kind des Maurers Heuser dort sei und den Herrn Pfarrer bitte, sofort zu ihrem Vater zu kommen: es sei ein Unglück geschehen. In wenigen Augenblicken sehen wir den Herrn Pfarrer bereits auf dem Versehgang. Als er in die ärmliche Stube trat, fand er einen Schwerkranken, ja einen Sterbenden vor sich. Der Maurer hatte bei der Arbeit neben das Gerüstbrett getreten, war herabgestürzt und hatte schwere innere Verletzungen davongetragen. Fünf kleine, unerzogene Kinderchen umstanden das Krankenlager, wovon das älteste Mädchen eben 9 Jahre alt geworden war. Die Kinder konnten die Tragweite des Unglücksfalles noch nicht übersehen. Noch waren die Wangen kaum trocken geworden von den Tränen, die sie am Sarg der teuren Mutter vergossen hatten, und schon wieder erfüllte tiefer Schmerz ihr kleines Kinderherz. Vor drei Wochen war die gute, fromme Mutter gestorben. Viel zu früh für die kleine Kinderschar. "Erziehe mir die Kinder gut", so hatte sie auf dem Sterbebett zu ihrem Mann gesprochen, und zu den Kindern hatte sie mehr als einmal gesagt: "Betet jeden Tag für den Vater, damit er auf gutem Weg bleibe, wie bisher, und euch erziehe für Gott und den Himmel!" Nun ruhte die brave, treue Frau unter dem kleinen Erdhügel und der Todesengel umwehte mit seinen Fittichen bereits das Haupt des Vaters, und auch er sollte bald an der Seite der Mutter ein Ruheplätzchen finden. Mit kindlicher Frömmigkeit empfing der Verunglückte die Sterbesakramente und sprach die Gebete andächtig nach. Noch lag ein Wunsch auf seinen Lippen. Bald zupfte es den Priester an seinem Ärmel und er beugte sich zu dem Sterbenden nieder. Da flüsterte ihm dieser mit leiser und schwacher Stimme zu: "Herr Pfarrer, wer wird nun für meine Kinder sorgen?" Und der Geistliche zeigt mit dem Finger nach oben, dann auf sich. Der Sterbende schien es zu verstehen und es war, als umspielte seine Lippen ein sanftes Lächeln.
Der Schwerverletzte hatte ausgekämpft. Der Herr Pfarrer saß wieder daheim in seiner Stube. Wohl gingen allerlei Gedanken durch seine Seele, aber um die Verwendung des Grundstückes machte er sich keine Sorgen mehr. Das musste unbedingt ein kleines "Waisenhaus" geben, Der freundliche Herr mit dem weißen Bart half über die nächsten Schwierigkeiten, nämlich über die Geldnot, hinweg. Die Einrichtung und der teilweise Umbau kostete zwar manchen Taler, aber es geriet, und als die ersten Pfleglinge zogen die fünf Kinder des verunglückten Maurers in das neue Waisenhaus ein. Bald wuchs die Zahl der Kinder und das Haus war bald zu klein.
Eines Tages hieß es: Herr Hellmut hat sein ganzes Vermögen verloren. So war es in der Tat. Er hatte das Geld in ein Unternehmen gesteckt und verlor es bis auf den letzten Heller. So wanderte er traurigen Herzens zum Pfarrhaus. Hier wurde er mehr als freundlich empfangen und der Herr Pfarrer wollte ihn zeitlebens bei sich behalten. Aber das lehnte der alte Herr ab. "Nur eine Bitte habe ich noch an Sie", so sprach er zum Pfarrer. "Nehmen Sie mich als Aufseher für Ihr Waisenhaus an!" Gern wurde seinem Wunsch entsprochen. So weilte er denn fürderhin wie ein Vater unter der fröhlichen Kinderschar. Er, der früher so oft das Kinderglück vermisst hatte, war nun Vater so vieler Kinder geworden. Aber nun gab es auch Vatersorgen für ihn und nichts betrübte ihn mehr, als dass er nun keine Almosen mehr austeilen konnte. "Wie froh bin ich", äußerte er einst zu dem Herrn Pfarrer, "dass ich wenigstens noch diese Kleinigkeit zur Ehr Gottes geopfert habe."
________________________________________________________________________

24. In heimatlicher Erde - Von Joseph Grabenschröer
Heimat! Süßes, ewig liebes Fleckchen Erde! Die Dichter nennen dich Freude und Glück, nennen dich Liebe und Friede. Sind das wirklich deine Namen? Nein, Heimat, du bist nicht selige Freude und jubelndes Glück, bist nicht innige Liebe und stiller Friede. Du bist mehr, weit mehr! Aber wie soll ich dich nennen? Ich weiß es nicht, ich habe nur einen einzigen Namen für dich: - Heimat! Heimat! Süßes, ewig liebes Wort! Welch quälendes Sehnen und verzehrendes Verlangen erweckt dein Klang in dem, der von dir geschieden in fernem Land unter fremden Menschen wohnt.
Heimweh! Du verschonst niemand, alt und jung, arm und reich, gut und böse, alles, alles ziehst du zurück in die Heimat.
Auch ihn, den schuldbewussten Wanderer, der jetzt unter glühender Julisonne durch den heißen Heidesand sich hinschleppt, hast du ergriffen, ergriffen mit all deiner Qual, mit all deinem Sehnen.
Ein schmuckloses Heidedörfchen war das Ziel des Wanderers. Aus fernem Land war er zurückgekehrt. Was kümmerte ihn seine Schuld, mochte ihn die irdische Gerechtigkeit seinetwegen in ihre Hände bekommen. Nur einen Wunsch hatte der Schuldbeladene noch - zurück zur Heimat. Zurück zur Stätte seiner Jugendspiele, zurück zum Vaterhaus, wo einst liebende Herzen in banger Sorge für ihn schlugen, zurück zum - Muttergrab, und dann - der Wanderer denkt schaudernd an seine Zukunft.
"Längst ist in mir erstorben der Wunsch nach jedem Glück;
Doch möcht` ich gern noch einmal zum Muttergrab zurück!
Möcht` dort noch einmal beten, ausweinen meinen Schmerz,
Dort wünsch` ich mir zu sterben beim - toten Mutterherz."
An diese Worte denkt unwillkürlich der schuldige Wanderer, sie waren ihm eine Erinnerung aus seiner Kindheit Tagen.
"Ach", seufzte er, "wenn ich doch auch sterben könnte, sterben könnte in der Nähe des toten Mutterherzens, um endlich, endlich Ruhe zu finden.
Freilich, Ruhe hatte er bis jetzt wenig gehabt. Bald nach dem Tod seiner Eltern war der Wanderer als hoffnungsvoller Jüngling unter fremde Leute gekommen und hatte ein Handwerk erlernt. Sein Fleiß, sein sonniges, heiteres Wesen, seine Leutseligkeit hatten ihm bald viele Herzen gewonnen - zu seinem Unglück. Von falschen Freunden wurde der junge Mann gar bald verführt; er lernte gar Schlimmes, ach, auch das Allerschlimmste. Sein erarbeitetes Geld wurde weggeworfen, er erkaufte sich damit Sünde und Laster. Er machte Schulden und geriet in Not. In seiner Not, seiner Verzweiflung lud er nun noch weitere schwere Schuld auf sich. Die weltliche Gerechtigkeit suchte ihn. Deshalb floh er von einem Ort zum andern. Nirgends fand er Ruhe; kein Plätzchen bot ihm längere Sicherheit. Manchmal suchte der Ruhelose sich aufzuraffen von seinem Elend, doch ihm fehlte der Mut, ihm war die wichtigste Stütze verloren Gegangen - der Glaube.
So verflossen für ihn im unsteten Wanderleben die Jahre. Aus dem blühenden Jüngling war ein alternder Mann geworden. Seine Haare waren weiß; seine Kraft war dahin. Da erwachte in ihm der Gedanke an seine Heimat. Dahin zurück - dort Ruhe finden - ewige Ruhe, das war sein letzter, sehnlicher Wunsch. Nun hatte er seine letzte Kraft angestrengt; er war zurückgewandert in die heimatlichen Fluren. Immer näher kam er der Heimat, und nun sieht er sie da liegen. Ums Herz wird`s ihm gar so eigen. Wie drängen ihm die Erinnerungen in die Seele. Aus seliger, unschuldiger Kinderzeit steigen Bilder auf vor seinem Geist, gar so liebe und traute Bilder, die vergessen waren im ruhelosen Wanderleben.
Horch! Da ertönte das Glöcklein des einfachen Kirchleins. Auch der Heimatlose hört es. Ihm war es, als riefen diese Klänge eine längst vergessene Stunde zurück, die Stunde des glückverheißenden Kinderglaubens.
Mühsam schleppt sich der Wanderer weiter. Er merkt es, seine Kräfte werden schwächer, immer schwächer. Ob er noch sein Ziel erreicht?
Sieh, dort das einfache Holzkreuz am Scheideweg! Dort will er ein wenig rasten. Dann will er weiter - noch ein Viertelstündchen - und dann wird er sein Ziel erreicht haben. Müde, kaum imstande, sich aufrecht zu halten, lehnt er sich an das einfache Holz des Heidekreuzes. Sein Auge kann er nicht abwenden von den Gefilden der Heimat. Ja, dort sieht er das Kreuz des Friedhofes. Nicht weit davon - so denkt er - liegt jener kleine Hügel, unter dem dein treues Mutterherz schlummert. Wie, wenn dieses Herz dich jetzt sehen könnte! Dieser Gedanke verursachte ihm namenlose Qual in seinem Innern. Er möchte weinen, aber sein Auge ist vertrocknet; er möchte beten, aber sein Glaube ist verloren. Nichts ist ihm übrig geblieben als der Bettelstab in seiner Hand, das erdrückende Schuldbewusstsein und das leidbeladene Herz in seiner kranken Brust.
"kann mir denn keiner mehr helfen?" In herzzerreißendem Jammer kamen diese Worte über des Bettlers verdorrte Lippen.
Da fällt sein Blick auf den einfachen Christus-Körper am Holzkreuz.
"Ja, Herr Jesus, du, du allein kannst mir helfen - Herr, erbarme dich meiner - gewähre mir auch den letzten Trost - deine Gnade und Vergebung." Der Qualvolle hatte das schlichte Kreuz umklammert, und in heißem, vertrauendem Flehen drangen die Worte aus seiner Seele.
Und der Herr erhörte das inständige Bitten seines verirrten Kindes Dem Wanderer wurde es ein wenig leichter im Herzen, und es war ihm, als hörte er vom Kreuz herab die trostreiche Verheißung:
"Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Wunsch soll erfüllt werden. Mein Sohn, noch heute wirst du bei mir im Paradies sein!" -
Als am Abend ein Schäfer seine Herde heimwärts trieb, fand er nicht weit vom einfachen Heidekreuz den sterbenden Bettler am Weg liegen. Bald wurde er in sein stilles Heimatdörfchen gebracht. Hier starb der Wanderer - mit Gott versöhnt. So war eines armen Erdenpilgers letzter Wunsch erfüllt worden - er hatte Ruhe gefunden, ewige Ruhe und schlief den letzten Schlaf in heimatlicher Erde.
________________________________________________________________________

25. Der Irre von Buchental - Erzählung aus der Zeit des Bauernkrieges von Johannes Buse
In der Frühe eines Herbstmorgens des Jahres 1524 ist es. Ein feuchter, schleierhafter Nebel lagert in den Tälern und Niederungen; nur mit Mühe kann man in dem Zwielicht die zunächst liegenden Dörfer und Weiler erkennen, hoch oben aber auf dem waldigen Berg verklären die Sonnenstrahlen die noch fast rauchenden Ruinen der alten Winnenburg, die von dem Vandalismus einer den Gesetzen des Reiches hohnsprechenden Horde erzählen.
Zwei Jahre etwa sind es, seit der alte Winnenburger in die Gruft seiner Ahnen hinabgestiegen, zwei hoffnungsvolle Söhne, Lothar und Kurt, seiner trauernden Gemahlin zurücklassend. Lothar, der bereits 26 Jahre zählte, trat das Majorat an; Kurt aber, der jüngere, der kaum das 22. Lebensjahr erreicht hatte, wollte nicht "als Knecht seines Bruders" an der Scholle kleben bleiben und zog, ungeachtet der Bitten und Warnungen seiner frommen Mutter, davon.
Die alte Burgfrau, die sich nach dem Tod ihres Gemahls ganz verlassen fühlte, gab sich nun ganz dem Gebet hin, um so, in Andacht vereinigt mit Gott, ihren Lebensabend ruhig zu beschließen. Um dieses erhabene Ziel noch leichter und sicherer zu erringen, zog sie sich in das nahegelegene Frauenkloster Buchental zurück, wo eine Schwester ihres verstorbenen Gemahls als Äbtissin waltete.
Allmählich brach sich das unter der Asche glimmende, von dem Wittenberger Augustinermönch Luther angefachte Feuer Bahn durch die deutschen Gaue, fast alle Stände mit sich fortreißend zum Kampf gegen die kirchliche Herrschaft. Fürsten, Grafen, Ritter und Edle trennten sich von der alten wahren Kirche Christi und bekannten sich zum neuen "lauteren" Evangelium, ihren Untertanen hiermit den Anstoß zu weiteren Übertritten gebend. Besonders war es der niedere Volksstand, Tagelöhner, Handwerker und vornehmlich Bauern, der sich die Bibelerklärung des Doktor Martinus zu seinen eigenen Gunsten auslegte. Zu Tausenden oft scharten sie sich zusammen, raubend und mordend die Lande durchziehend. Kirchen, Klöster und Edelsitze wurden vom Pöbel ausgeraubt, zerstört und dem Erdboden gleich gemacht.
Dieses Schicksal war auch der Winnenburg widerfahren. Graf Lothar hatte sie bis zum Äußersten gehalten. Dann aber brach der Widerstand unter der Wucht des Angriffs. Wie Bestien stürmten die Bauern durch die Gänge, jedes lebende Wesen mit Äxten, Keulen und Morgensternen niederschlagend. Nach wenigen Minuten war die gesamte Besatzung, auch Graf Lothar, der Rotte zum Opfer gefallen; von der alten stolzen Feste blieb nichts übrig, als die jetzt von der Sonne beschienenen Ruinen. -
Mit dem Rücken an den Stamm einer alten Eiche gelehnt, steht ein noch junger Mann am Rand des Waldes und lässt seine Augen auf den Trümmern der alten Winnenburg ruhen. Es ist eine kleine, gedrungene Gestalt, die mit ihren stechenden Augen, die von buschigen Brauen überschattet werden, einen unheimlichen Eindruck macht. Eine schon an mehreren Stellen schadhafte Lederhose reicht bis zu den Knien herab, während ein aus Zwilchzeug gefertigtes Wams den Oberkörper umschließt. Ein breitrandiger Hut, mit einer Hahnenfeder besteckt, bildet die Ergänzung des abenteuerlichen Kostüms. Es ist dies der Führer einer Bauernschar, es ist Kurt von Winnenburg, der noch vor wenigen Tagen die Zerstörung seines väterlichen Stammgutes geleitet und selbst seinem Bruder Lothar im Tod noch das Schwert in das erstarrende Herz gestoßen hat. - Immer noch weilen seine Blicke auf den Trümmern der Burg, wobei ab und zu ein höhnisches Lächeln um seine unschönen Züge huscht. Plötzlich fühlt er sich auf der Schulter von einer Hand berührt.
"Ei, Kurt, schon wieder am träumen?" redet ihn gleichzeitig eine Stentorstimme an.
Sich umwendend, blickt Kurt in das von wirr herabhängenden Haaren umrahmte Gesicht seines Freundes und Vertrauten Jost. - "Jost, wie du mich erschreckt hast."
"Hahaha! Auch noch erschreckt? - Bist ja recht zimperlich geworden, seitdem du den roten Hahn auf die Zinnen der Winnenburg gesetzt hast."
Eine dunkle Glut steigt in Kurts Gesicht auf, während ihn Jost scharf fixiert.
"Jost", spricht Kurt erregt, indem er die zu seinen Füßen liegende Hellebarde ergreift, "entweder bleibst du mir mit deinem dummen Geschwätz endlich vom Leib, oder wir beide bleiben keine guten Freunde, merk dir`s!"
"Das muss ich sagen, Kurt, bist ein hitziger Bursche", entgegnete Jost lachend, um gleich darauf in energischem Ton fortzufahren: "Nun aber mach der Untätigkeit ein Ende. Zwei Tage schon liegen wir hier. Die Leute des Wartens müde; ein unzweideutiges Murren macht sich unter ihnen bemerkbar."
Diese Worte bringen Leben in die Gestalt des Bauernführers. Erregt gestikulierend antwortet er: "Wer hat die Schuld? - Sind nicht schon alle Edelsitze auf sechs Stunden im Umkreis dem Erdboden gleichgemacht? - Sind nicht schon alle Kirchen und Güter ausgeraubt und geplündert?"
"Alles geschah nur, um der neuen Lehre den Weg zu bahnen."
"Nun wohl, hier sind dem lauteren Evangelium alle Hindernisse aus dem Weg geräumt; uns bleibt nichts zu tun übrig, als weiter in das Land zu ziehen und anderwärts das zu beginnen, was wir hier vollendet haben."
"Magst du recht haben, Kurt, und doch ist auch hier für uns noch zu tun. Wer das Unkraut vertilgen will, muss es bei der Wurzel fassen. Oder sollen wir unsere mühsam geebneten Wege den papistischen Dienern wieder anheimfallen lassen?" Zornig funkeln Josts Augen bei diesen Worten, in seinen Zügen ist eine raubtierartige Gier zu lesen.
"Sprich deutlicher, Jost, ich verstehe dich nicht"; entgegnete Kurt.
"Du verstehst mich nicht? - Willst mich nicht verstehen! - Schau dort", spricht der erregte Bauer, mit der Rechten ins Tal weisend, wo die Türme des Klosters Buchental aus dem herbstlichen Blätterschmuck hervorleuchten, "was ist das?"
"Was soll die dumme Frage? - Das Kloster Buchental kennt jedes Kind."
"Nun wohl, sollen wir es als Zuchtstätte des römischen Glaubens verschont lassen?"
Über das Gesicht des Bauernführers fliegt ein Zug des Schmerzes.
"Werden sie, die Nonnen, das Volk nicht bald wieder auf den Weg des alten Glaubens lenken, während wir keine Mühe und Opfer gescheut haben, um dem lauteren Evangelium hier Eingang zu verschaffen? - Würden wir nicht Wölfe zu Schafmeistern machen? - Sprich, Kurt!"
"Was können uns die Weiber schaden?" - wagt der Angeredete einzuwenden.
"Das fragst du noch? - Nun ja, ich weiß, weshalb du zauderst: ist nicht eine Winnenburgerin dort Äbtissin?"
"Die Schwester meines seligen Vaters."
"Muss uns ganz gleichgültig sein" antwortete Jost barsch.
"Jost, sie ist außer mir die Letzte aus dem Stamm derer von Winnenburg. - Soll denn das alte, rumreiche Geschlecht mit einem Mal mit Stumpf und Stil vernichtet werden?"
"Dann mag sie von ihrem römischen Aberglauben ablassen."
Kurt blickt sinnend in die Ferne und lässt seine Augen auf dem stillen Frauenkloster ruhen.
"Wenn morgen früh der Hahn kräht, ist die ganze Sippe vom Erdboden vertilgt, oder sie bekennt sich zum lauteren Evangelium unseres Doktor Martinus."
Wie ein elektrischer Strom durchzuckt es die Glieder Kurts. "So willst du mir doch die Letzte rauben, die meinen Namen trägt? - Bist du es nicht gewesen, der mich antrieb, die Burg meiner Väter zu zerstören, unter deren Trümmern die begraben liegt, die jedem Kinderherzen nahesteht - die Mutter? Bist du es nicht gewesen, der mich antrieb, dem einzigen Bruder das Schwert ins todesstarre Herz zu stoßen? - Pfui, Jost, ich möchte dich verabscheuen . . ."
"Wenn du nicht an mich gebunden wärest", unterbricht ihn Jost, teuflisch lachend. "Ein Wort von mir genügte, und unsere Leute würden dich, ihren Führer, mit den grausamsten Qualen zu Tode peinigen, wenn nicht gar auf dem Scheiterhaufen verbrennen. - Darum nimm Vernunft an, zerreiß die Bande, die dich an die Äbtissin ketten, und sei in Zukunft auch das, was du bisher gewesen bist: ein Feind aller papistischen Gräuel!"
Kurt antwortet nicht; das Haupt gesenkt, stiert er zu Boden. Ein fürchterlicher Kampf wütet in seinem Innern. Obgleich er schon eine geraume Zeit mit dem Pöbel geraubt, geplündert und gemordet hatte, erfüllt ihn doch der Plan seines Genossen Jost mit Entsetzen. Er sieht sich als Knabe mit der Tante im Klostergarten, noch fühlt er ihre segnende Hand auf seinem Scheitel ruhen, und nun soll er diese ehrwürdige Matrone zwingen, den neuen Glauben anzunehmen oder . . . Er wagt nicht weiter zu denken. Und doch, er sieht es ein, er muss, um sein Leben zu retten, so niederträchtig handeln. Beim Aufstand der Bauern hat er sich, angelockt durch deren freies Leben und die zahlreichen Erbeutungen, ihnen als "Bauer" angeschlossen. Niemand weiß, wer er in Wirklichkeit ist; als "Genosse Kurt" ist er bei den Bauern bekannt, die ihn schon in den ersten Wochen zu ihrem Führer ernannten. Einem jedoch hat Kurt alles anvertraut: Jost, der nun dieses Vertrauen als Waffe benutzt, um den Führer in Schach zu halten.
"Nun, wie hast du dich besonnen?" nimmt Jost wieder das Wort, nachdem er eine Weile vergeblich auf Antwort gewartet hat.
Zitternd richtet Kurt sein Haupt empor. "Nun wohl, ich muss!"
"Das ist einmal recht gesprochen", entgegnet Jost, wobei er Kurt einen derben Schlag auf die Schulter versetzt. "Konnte auch nicht denken, dass du anders handeln würdest."
"Gezwungen nur folge ich dem Willen. - Mein letztes Werk!"
"Dein letztes Werk? - Hahaha! - Das hast du schon oft gesagt. Wenn erst der Wein aus dem Klosterkeller durch deine Kehle rinnt, wirst du anders denken."
"Jost, du bist ein Teufel!"
"Mag sein", gibt dieser lachend zur Antwort, "nun aber sage mir, wenn wir aufbrechen sollen, damit ich unseren Leuten Nachricht geben kann."
"Wenn die Sonne untergegangen ist", gibt Kurt eintönig zur Antwort, worauf er wieder in dumpfes Brüten verfällt.
Jost aber schreitet schnell in den Wald hinein, wo er bald eine Rotte Bauern erreicht, die, ein Fass Wein in der Mitte, auf dem Boden hingestreckt liegen. Mit wüstem Gesang begrüßen sie die ihnen durch Jost zuteil gewordene Antwort ihres Führers. Goldene Kelche und Ziborien, die aus Kirchen geraubt waren, wurden mit Wein gefüllt und kreisen dann unter der rohen Horde, während einige vor Trunkenheit lallende Stimmen ein triviales Lied in den schönen Morgen hineinschreien.
* * *
Abend ist es. - Die Dunkelheit breitet bereits ihre schwarzen Schatten über die Landschaft, stiller Frieden liegt auf der ganzen Natur.
Deutlich heben sich die Umrisse des Klosters Buchental vom Abendhimmel ab. In dem Klostergebäude herrscht Ruhe, die Fenster des hübschen gotischen Kirchleins aber sind hell erleuchtet, und der Schall eines kräftigen Gebetchores dringt ins Freie. Weihevoll, fast flehend, steigen die Gebete der frommen Klosterfrauen aus dem stillen Heiligtum zum Schöpfer des Weltalls empor, als wollten sie Schutz erbitten für die angebrochene Nacht. Allein das Schicksal des Klosters ist besiegelt.
Einer Schlange gleich, zieht ein düsterer Schatten durch das Tal auf das Kloster zu: es ist die von Kurt geführte Bauernschar. Kurt und Jost an der Spitze, ziehen die Wüstlinge zu dem stillen Gottesgarten, um hier die Blumen zu knicken, die zu Gottes Ehre dort wachsen und blühen. Bald ist die rohe Horde an der das Kloster umgebenden Mauer angelangt; ein paar wüste Schläge mit einem Kolben gegen das alte Holztor, und es bricht zusammen. Über dessen Trümmer dringen die Bauern in den stillen Klosterhof, um bald in den Gebäulichkeiten zu verschwinden.
Schrecken und Grauen erfasst die zum Chorgebet vor dem Altar knienden Nonnen, als wüste Männerstimmen und Waffengeklirr in die Kirchenhallen dringt, denn dies bedeutet nichts anderes für sie als Raub und Mord. Anfangs malt sich Furcht und Schrecken auf dem Gesicht der alten Äbtissin. Sie ist unschlüssig. Soll sie mit ihren geistlichen Töchtern fliehen? Soll sie diesen Unmenschen Widerstand entgegensetzen? Beides wäre unnütz. Körperlich gebrochen, wie sie scheint, stützt sie sich auf ihre zur Seite kniende Schwägerin, die Gräfin von Winnenburg. Dann richtet sie sich zu ihrer ganzen Höhe empor und wendet sich an die ängstlichen Nonnen: "Meine Töchter, unsere Heimsuchung naht, jetzt hat unsere Entscheidungsstunde geschlagen. Sollen wir nun unsere dem Herrn allein geweihten Seelen diesen Wüstlingen überliefern?"
"Für Jesus leben und sterben wir!" schallt ihr wie aus einem Munde die Antwort ihrer geistlichen Kinder entgegen.
Wie verklärt erscheint nun das Antlitz der alten Äbtissin, als sie ihre Hand zum Segen erhebt und die Worte spricht: "Der Herr segne euch und bewahre eure Seelen!"
"Amen!" hallt es im Chor durch das stille Gotteshaus.
Das Chorgebet wird fortgesetzt. Flehentlicher denn je steigen die Gebete empor, aller Augen sind auf das große Altarkreuz gerichtet. Die Gräfin von Winnenburg kann die hervorbrechenden Tränen nicht bannen. - Ob sie vielleicht ahnt, wer der Führer dieser Räuberhorde ist? - Doch sie kann es ja nicht wissen. Seitdem ihr Sohn die Burg seiner Väter verließ, hat sie nichts wieder von ihm vernommen. -
Kurt steht auf dem geräumigen Klosterhof mit dem Rücken an die Mauer gelehnt, gedankenvoll blickt er bald durch das Kirchlein, bald auf das Kloster. Welch ein Kontrast: aus diesem dringen Flüche und Verwünschungen der Bauern, die ihre Raubgier befriedigen und die geweihten Hallen entheiligen, aus jenem steigen fromme Gebete flehentlich empor zum Himmel.
Da - mit einem Mal steigen an verschiedenen Stellen des Daches kleine weiße Wölkchen auf, denen bald gierig züngelnde Flammen folgen. Sie nehmen bald größere Dimensionen an und nun gleicht das Kloster einem Flammenpfuhl, der mit seinem grellroten Schein den zweiten Hof geisterhaft beleuchtet. Bald finden die Flammen den Weg zum Dach des Kirchleins und hüllen Schiff und Turm in Feuer ein. Unter diesen Gluten aber beten die frommen Ordensfrauen um Rettung ihrer Seelen. - Schon sinkt das Dach des Klosters, da stürzt die Bauernrotte aus dem Gebäude, ihre Beute ist ein Fass Wein, wie er von den Nonnen zu Krankenzwecken gebraucht wird.
"Scheinst recht gute Beute gemacht zu haben!" ruft Kurt dem wie wild dahinrasenden Jost zu.
Betroffen bleibt der Angeredete stehen, mit grimmiger Miene in das vom Feuer beleuchtete Gesicht Kurts blickend. "Dort", sagt er in rauem Ton, indem er auf das brennende Kirchlein zeigt, "werde ich mir holen, was ich im Kloster vergebens gesucht habe."
"Es ist zu spät, Jost", sagt Kurt mit einem Anflug von Hohn.
"Nicht für mich, und keine Macht der Hölle soll mich finden."
"Jost, bleibe zurück!" warnt Kurt.
"Nimmer, Feigling! Magst du dich auch schnöde zurückhalten, so weiß ich doch, wohin meine Wege führen. Glaubst wohl, ich merkte nicht, dass du die Weiber retten willst? Allein schau dort, ihr Totenlichtchen brennt, und kommt mir`s in den Sinn, wird es auch das deinige werden." Dann wendet er sich zum Gehen und schreitet auf die Kirchentür zu.
"Verfluchter Gleisner!" schreit Kurt ihm nach, dann schreitet auch er auf das Gotteshaus zu, um Josts Handlungen zu beobachten.
Drinnen aber im Kirchlein beten die Nonnen gerade die Psalmen. Von langen weißen Schleiern umhüllt, knien die Bräute Christi am Altar, während glühendheißer Rauch sie zu ersticken droht.
Jost ist an der Pforte angelangt, reißt die eichene Tür auf und stürzt in das Gotteshaus, während Kurt seine Bewegungen mit den Augen verfolgt. Allein, kaum ist der Wüstling in das Kirchlein getreten, da klirren die Fenster, und herein schlägt die rote Flamme in langen, schauerlichen Zügen. Erschreckt bleibt Jost in der Mitte des kleinen Gotteshauses stehen.
Die vor dem Altar kniende Gräfin von Winnenburg hat sich erhoben und richtet ihre Blicke auf den Ausgang der Kirche, in deren Tür die Gestalt Kurts sichtbar ist. In diesem Augenblick begegnen sich die Blicke des Sohnes und der Mutter. Gleichzeitig werden zwei gellende Aufschreie laut. "Kurt, mein Sohn!" - "O Mutter!" schallt es vom Altar und vom Eingang der Kirche her. Dann wird es still und man hört nichts wie das Knistern und Prasseln der Flammen. Während die Gräfin von Winnenburg an der Seite der Äbtissin zusammenbricht, stürzt Kurt rückwärts aus der Tür und bleibt wie leblos auf dem Klosterhof liegen.
Leichenblass steht Jost in der Kirche. Unschlüssig mit sich selbst, weiß er nicht, ob er vorwärts oder rückwärts gehen soll. Da kracht das Gewölbe, der Estrich sinkt, prasselnd wirbeln die Flammen empor. Noch einmal ertönt ein schwaches Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto durch die rauchgeschwärzten Hallen, dann stürzt das weite Dach der Kirche ein, unter den Trümmern die Klosterfrauen begrabend und sie so rettend vor Schmach und Schande.
* * *
Die Sonne steht schon hoch am Himmel, als Kurt aus seiner Betäubung erwacht. Unstet lässt er seine Augen umherschweifen, alles kommt ihm vor wie ein Traum, doch die rauchenden Trümmer des Klosters, die er vor sich erblickt, belehren ihn, dass hier die Wirklichkeit gewaltet hat. Jetzt tritt die ganze Szene wieder vor seine Augen; er sieht die Blicke seiner Mutter bittend und zugleich vorwurfsvoll auf sich gerichtet, er hört ihren Ruf: "Kurt, mein Sohn!" - O, diese Erinnerungen, sie pressen ihm die Seele zusammen. - Er ist zum Mörder seiner Mutter geworden. - Heftig schluchzend, vielleicht das erste Mal wieder seit langer, langer Zeit, verbirgt Kurt sein Gesicht in die Hände und ein über das andere Mal ruft er den Namen "Mutter!", allein nichts antwortet ihm, wie das dumpfe Echo. Dann zerrauft er sein Haar, schreitet durch die öden Trümmerhaufen, als ob er etwas suche, und kehrt dann nach erfolglosem Beginnen wieder zurück. - Einsam steht nun der Bauernführer an dem schauerlichen Grab seiner Mutter, das auch das Grab Josts, seines Genossen und Vertrauten geworden ist. Wo sind sie geblieben, seine Freunde und Anhänger? Wie der Rauch im Wind sind sie spurlos verschwunden, ihn seinem Schicksal überlassend. - Bittere Reue zieht in Kurts Herz ein. Er verflucht die Stunde, wo er der Winnenburg den Rücken gekehrt, wo er sich dem Aufstand der räuberischen und mörderischen Bauern angeschlossen hat. O wie gern möchte er nun alles ungeschehen machen. Wie gern möchte er nun mit seinem Herzblut das Leben seines ermordeten Bruders, seiner teuren Mutter erkaufen, doch "zu spät" scheint ihm jeder Windstoß zuzurufen, und das Wort "Mörder!" glaubt er auf jedem grünen Blatt zu lesen. Überall lässt ihm seine leicht erregte Phantasie die gemordeten Opfer erscheinen, ihn peinigend und quälend.
Doch das Vertrauen auf Gottes Güte und Barmherzigkeit, der einzige Hoffnungsanker, woran sich der reumütige Sünder nach seinem Fall klammert, schlägt auch in Kurts Seele aufs neue tiefe Wurzeln. Was er nun schon seit fast zwei Jahren bekämpft, was er als "Aberglauben und Torheit" bezeichnet hat, ergreift er nun wieder in seiner Verlassenheit und Seelenqual. Er betet wieder, betet mit der ganzen Inbrunst seiner Seele. Jetzt erkennt er mit einem Mal die so kräftige Wirkung des Gebetes, jetzt hofft er durch den Arm des Gebetes Gottes Gnade und Verzeihung zu finden für sein bisheriges Sündenleben. -
Jahre sind vergangen. Unter der Leitung des Hauptmanns Georg Truchsess von Waldburg hat ein schwäbisches Bundesheer die schlechtbewaffneten und zum offenen Krieg nicht geübten Bauernhorden auseinandergetrieben. Der Bauernkrieg gehört der Vergangenheit an.
Aus den rauchgeschwärzten Trümmerspalten des Klosters Buchental wachsen Moose und Blattpflanzen hervor; keine menschliche Hand hat die Steine zu neuen Bauten wieder zusammengefügt. Kein menschlicher Fuß betritt die Stätte, wo sonst Gottes Lob aus dem Mund frommer Frauen erklungen, nur das Käuzchen haust in den Mauerhöhlen und lässt seinen schauerlichen Ruf zum Grausen der abergläubischen Bewohner erschallen. Zieht ein Wanderer des Weges, so lässt er seine Augen nur scheu und flüchtig über die Trümmer gleiten und beschleunigt dann seine Schritte, um nur so schnell wie möglich aus dem Bereich des Schreckens zu kommen. -
Vielleicht einen Steinwurf von den Trümmern entfernt, liegt zwischen Buchen und Eichen versteckt eine aus Brettern und Baumpfählen zusammengefügte Hütte: die Wohnung Kurts von Winnenberg, des ehemaligen Bauernführers. Nach dem Klosterbrand hat er den stillen Buchenhain bezogen, von dem das Kloster seinen Namen hat, um hier am Grab seiner Mutter durch Gebet und Abtötung zu büßen, was er an dieser Stelle dereinst verschuldet. Niemand vermutet in ihm den noch vor einigen Jahren vor Gesundheit und Kraft strotzenden Kurt von Winnenburg, noch jung an Jahren, gleicht er doch schon einem Greis. Sein gebeugter Gang, seine eingefallenen gefurchten Wangen, die tiefliegenden Augen, dies alles deutet auf die Seelenschmerzen hin, die Kurts Körper seit jener Schreckensnacht erschüttert haben. Wie er die Menschen meidet, so meiden diese ihn. Zwar haben sich die in der Nähe Wohnenden an seinen Anblick längst gewöhnt, seiner abgesonderten Lebensweise und seiner scheinbaren Menschenfurcht wegen wird er allgemein für irrsinnig gehalten. Abergläubische und Furchtsame glauben in ihm sogar einen Dämon zu erblicken, dem die Aufgabe zugefallen ist, die Schätze des durch Brand zugrunde gegangenen Klosters zu bewachen. -
Wieder ist eine Zeit vergangen. Seit einigen Tagen hat man den Einsiedler nicht mehr gesehen. Einige beherzte Männer suchen seine Hütte auf - sie ist leer. Wie sie nun ihre Schritte über die Ruinen des ehemaligen Klosters lenken, sehen sie an der Stelle, wo der Hochaltar gestanden hat, einen menschlichen Körper am Boden liegen: es ist der Gesuchte. Wie sie nähertreten, sehen sie, dass er tot ist. Lang ausgestreckt, das Gesicht zum Himmel gewandt, in den erstarrten Händen ein Kreuzchen haltend, so hat er auf dem Trümmergrab seiner Mutter sein Totenbett gefunden. Hier, wo er sündigte, hat er auch gesühnt. -
An der Stelle, wo man den leblosen Körper gefunden, ist er auch begraben. Mit den Trümmern der durch ihn zerstörten Kirche hat man ihn bedeckt. Mit seinem Tod verschwand auch bei den Abergläubischen die Furcht. Eine mitleidige Seele errichtete auf seinem Grab ein schlichtes Holzkreuz, das die eingeschnittenen Worte trug: Hier ruht der Irre von Buchental.
________________________________________________________________________
26. Seltsame Wege
Nach einer wahren Begebenheit von Margarete Cochet
Zu Anfang des 17. Jahrhunderts bot Frankreichs Hauptstadt einen andern Anblick als in unseren Tagen. Statt der heutigen breiten, baumbepflanzten Boulevards, denen entlang sich mächtige Paläste erstrecken, sah man nur enge, kleine Straßen, schmutzige, niedrige Häuser, deren Aussehen gewiss nicht einladend auf den Zuschauer wirkten. Doch darin lag nicht allein der Grund, weshalb Paris zu damaliger Zeit keineswegs als begehrenswerter Aufenthaltsort galt; vielmehr war es der Umstand, dass seine Einwohner weder bei Tag noch bei Nacht ihres Lebens sicher waren. Zwar regierte Heinrich IV. mit eiserner Hand, dennoch gelang es auch ihm nicht, das Band von den Räubern und Verbrechern, die man allgemein für Zigeuner hielt, zu befreien. Sie wussten so geschickt zu Werke zu gehen, dass man ihrer trotz strengsten Maßregeln nicht habhaft zu werden vermochte. Am meisten ausgesetzt waren natürlich die Schlösser in der Umgebung der Stadt.
Es war im Jahr 1604, als Luise de Marillac mit ihren beiden Brüdern ihr Landschloss verließ, um sich nach Paris zu begeben. Sie hatten allerdings keine lange Reise zurückzulegen, um zu ihrem Ziel zu gelangen, dennoch war sie mit manchen Beschwerden verbunden, schon aus dem Grund, weil die Wege schlecht waren und man nur langsam und mühsam vorwärts gelangen konnten. Ja, bald erreichten die Reisenden eine Stelle, an der sie sogar genötigt waren, den Wagen zu verlassen, um der Gefahr zu entgehen, umgeworfen zu werden. Sie hatten kaum eine kleine Strecke zu Fuß zurückgelegt, als sie sich plötzlich von einer Schar Zigeunerkinder umgeben sahen. In ihrer wilden, unbändigen Art drängten sie sich an die jungen Leute heran, ihnen schreiend und verlangend die Hände entgegenstreckend.
Luisens Brüder hatten Mühe, die stürmische, kleine Bande zu vertreiben, indes das junge Mädchen mit besonderer Aufmerksamkeit einen kleinen Jungen betrachtete, dessen feines, blasses Gesichtchen mit den großen, blauen Augen seltsam von denen seiner Gefährten abstach. Es lag etwas Rührendes, Mitleiderweckendes in dem traurigernsten Blick dieser Kinderaugen, die Luise scheu auf sich gerichtet sah. Sie griff in ihre Tasche und drückte dem Jungen eine Münze in die Hand, ihre milde Gabe mit einigen freundlichen Worten begleitend. Das Kind sah sie einen Augenblick betroffen und erstaunt an, dann beugte es sich über die kleine Hand seiner Wohltäterin und drückte hastig einen Kuss darauf. In der nächsten Minute war es verschwunden.
Der Abend war schon ziemlich vorgerückt, als die Geschwister Marillac in ihrem Schloss zu Paris anlangten. Eilig wurde ein bescheidenes Abendessen eingenommen, dann suchte jeder, von der Reise ermüdet, sein Zimmer auf, um sich so schnell als möglich zur Ruhe zu begeben.
Luise de Marillac, ein liebliches Mädchen von fünfzehn Jahren, zeichnete sich unter anderem durch eine tiefe, aufrichtige Frömmigkeit aus. In ihrem Herzen brannte insbesondere eine innige Andacht zu Maria, der Rosenkranzkönigin, und es gehörte daher auch zu ihren größten Freuden, täglich den Rosenkranz, ja manchmal sogar den ganzen Psalter zu beten. Nur heute fühlte sie sich o müde und erschöpft, dass sie nach einem Augenblick des Schwankens beschloss, ihre gewöhnliche Andacht einmal zu unterlassen, um sie am folgenden Tag mit doppeltem Eifer nachzuholen.
Schon stand sie im Begriff, ihren Entschluss auszuführen und sich zu entkleiden, um ihr Bett aufzusuchen, als sich eine Stimme in ihrem Innern vernehmen ließ.
War es auch recht, was sie tat? . . . Zehn Minuten, eine Viertelstunde höchstens, und sie würde der Rosenkranzkönigin ihren gewöhnlichen Tribut an Liebe und Lob dargebracht haben, und dann ruhig, mit dem Bewusstsein, selbst auf Kosten eines kleinen Opfers ihrer Andacht treugeblieben zu sein, einschlafen können.
Dieser inneren Stimme konnte sie nicht widerstehen. Sie ergriff ihren Rosenkranz und kniete auf ihren Betstuhl nieder, über dem ein prachtvolles Bild der Rosenkranzkönigin hing.
Noch war sie in ihrem Gebet versunken, als es ihr plötzlich vorkam, in ihrem Zimmer schwache Atemzüge zu vernehmen. Fast unwillkürlich wandte sie den Kopf und blickte in die Richtung ihres Bettes. Was sie da bemerkte, ließ das Blut in ihren Adern erstarren.
Zwei Augen blickten sie unter dem Bett an, verschwanden jedoch so plötzlich, dass Luise das Ganze für eine Täuschung hätte halten können, wenn nicht ein dumpfer Lärm, der wohl von dem Anstoßen des Kopfes an die Bettstelle herrührte, sie eines Besseren belehrt hätte.
Nein, hier war kein Zweifel möglich; unter ihrem Bett lag einer der Räuber versteckt, von denen man sich in Paris die furchtbarsten Schreckenstaten erzählte. O Gott, was sollte sie tun? Um Hilfe rufen war ausgeschlossen, die anstoßenden Gemächer waren unbewohnt und es hätte lange gedauert, bis man ihr Schreien gehört hätte; sie würde sich im Gegenteil dadurch nur einer noch größeren Gefahr aussetzen. An ein Fliehen war ebenfalls nicht zu denken, denn der Betstuhl, auf dem sie kniete, war so weit von der Tür entfernt, dass der Räuber sich gewiss auf sie stürzen würde, bevor sie sie erreichen könnte.
Das junge Mädchen zitterte am ganzen Körper. In diesem Augenblick äußerster Not fiel sein Auge auf das Muttergottesbild, und fast unbewusst flüsterte es:
"Du meine teure Mutter Gottes, schütze dein Kind in dieser Stunde der Gefahr!"
Kaum hatten sich diese Worte ihrer angsterfüllten Seele entrungen, als Luise, wie von einer höheren Macht getrieben, laut und mit zitternder Stimme in ihrem Gebet fortfuhr:
"Und, teure Mutter, ich bitte dich auch um deine Fürsprache für alle jene, die im Begriff stehen, deinen göttlichen Sohn und dich zu beleidigen. Stehe ihnen in dem Augenblick der Versuchung bei und erbitte ihnen die Kraft, dem Bösen zu widerstehen."
Eben hatte Fräulein de Marillac das letzte Wort ausgesprochen, als ein leises Geräusch an ihr Ohr drang und sie entsetzt die Augen schließen ließ. Sie wusste selbst nicht, woher sie den Mut nahm sie jedoch bald wieder zu öffnen. Wer vermag ihr Erstaunen zu schildern, als sie statt des gefürchteten Räubers, plötzlich neben sich kniend den kleinen Zigeunerjungen erblickte, dem sie wenige Stunden vorher eine Geldmünze geschenkt hatte.
Ein Seufzer der Erleichterung, aber auch des Schmerzes zugleich, entfuhr ihrer gequälten Brust. Sie war aufgesprungen und maß das Kind mit ernsten, vorwurfsvollen Blicken, deren beredte Sprache der Kleine nur allzu gut verstand. Er streckte ihr bittend die mageren Händchen entgegen und rief mit tränenerstickter Stimme:
"O Fräulein, im Namen dieser Mutter Gottes, zu der Sie eben gebetet haben, verzeihen Sie mir, haben Sie erbarmen mit mir!"
Nur mühsam gewann Luise de Marillac ihre Fassung wieder und ihre Stimme zitterte noch, als sie ausrief:
"Du unglückliches Kind, in welcher Absicht bist du hergekommen?"
"Ich habe nur einen mir gegebenen Befehl ausgeführt."
"Wessen Befehl?"
"Derjenigen, die mich erhalten", entgegnete der Junge.
"Wer erhält dich und zwingt dich das Böse zu tun?"
"Die Leute, mit denen ich lebe und denen ich gehorchen muss, wenn ich nicht von ihnen totgeschlagen werden soll. Und doch habe ich wohl noch nie so sehr gelitten, als vorhin, da ich Sie erkannte und mir bewusst wurde, bei meiner Wohltäterin eingedrungen zu sein", schloss das Kind mit schmerzlich bewegter Stimme.
"Wie meinst du das, Kind?" fragte Luise, nun bereits etwas ruhiger geworden. Wieder beschlich sie dieses Gefühl tiefen Mitleids, das sie bei der ersten Begegnung mit dem Jungen empfunden hatte.
"Sehen Sie, Fräulein, es ist nämlich so: wenn jemand mir etwas Böses antut, so vergelte ich es ihm auch mit Bösem, doch tiefe Dankbarkeit empfinde ich zu dem, der mir Gutes getan hat. Und diese Dankbarkeit erfüllte mein Herz, als Sie mir, dem verachteten, von allen zurückgestoßenen Zigeunerjungen heute so freundlich entgegenkamen. O ja, dafür danke ich Ihnen viel mehr als für das Almosen. Denn Almosen bekomme ich öfters, aber niemals noch sprach jemand so sanft und lieb zu mir, wie Sie es taten. Das machte mich so unsagbar glücklich! Wie groß war aber eben deshalb mein Schrecken und mein Entsetzen, als ich vor einer Weile erkannte, dass gerade Sie die Bewohnerin dieses Hauses sind!"
"Es war also deine Absicht, uns irgend ein Leid anzutun?" fragte das junge Mädchen.
"Ja. Ich hatte den Befehl erhalten, in einem günstigen Augenblick meine Kameraden durch ein verabredetes Zeichen herbeizurufen."
"Und dann?"
"Das übrige ist leicht zu erraten. wie ich mich bereits überzeugt habe, ist hier die Dienerschaft nur in geringer Zahl vertreten, auch birgt das Haus nur zwei männliche Wesen, meine Gefährten hätten daher bald jeden Widerstand besiegt."
"Es war also eure Absicht, uns zu berauben, ja vielleicht sogar zu ermorden?" rief Luise blass vor Entsetzen bei dem Gedanken an die drohende Gefahr. Unwillkürlich streckte sie die Hand nach der Glocke aus und Zog die Schnur.
Mit weitaufgerissenen Augen hatte der Junge diese Bewegung des jungen Mädchens verfolgt.
"O Fräulein, wollen Sie denn mein Verderben?" klang es traurig von den zuckenden Lippen des Kindes.
"Wieso? Was willst du damit sagen?"
"Wenn Ihre Leute mich hier sehen, werden sie mich töten, und selbst wenn sie es nicht täten, so werden es meine Kameraden tun."
"So fliehe, fliehe schnell, es ist noch Zeit", rief Luise, von den Worten des Jungen ergriffen.
"Wohin soll ich? Ich habe nirgends ein Heim und keinen Menschen, der mir Zuflucht gewähren würde. Darum ist es in der Tat auch gleichgültig, ob man mich hier oder dort tötet", versetzte der Kleine bitter. Und ein kleines ledernes Säckchen, das er am Hals zu tragen schien, hastig herunternehmend, reichte er es dem jungen Mädchen mit den Worten: "Bevor ich sterbe, hätte ich jedoch noch eine Bitte. Nehmen Sie dieses Säckchen, Fräulein, in Erinnerung an einen kleinen, unglücklichen Zigeunerjungen und als Beweis seiner Dankbarkeit. Es ist das einzige was ich besitze, und . . ."
Der Junge hatte den Satz noch nicht vollendet, als die Tür hastig aufgerissen wurde und Luisens jüngster Bruder auf der Schwelle erschien.
Wie angewurzelt blieb er stehen und ließ seinen halb erstaunten, halb erschrockenen Blick von seiner Schwester zu dem kleinen Jungen schweifen.
Ehe er jedoch Zeit gefunden hatte, irgend eine Frage zu stellen, war das junge Mädchen bereits an ihn herangetreten und setzte ihn von dem Vorgefallenen in Kenntnis.
Ein Ruf des Entsetzens entfuhr den Lippen des Jünglings.
"Der Junge muss gefesselt und morgen früh der Polizei übergeben werden", erklärte er im Ton höchster Aufregung, und streckte bereits die Hand aus, um das Kind zu erfassen.
"Bruder, lassen wir Gnade vor Recht walten", wehrte Luise dem jungen Mann sanft ab. "Bedenken wir, dass der arme Kleine noch ein Kind ist, den leider niemand etwas Gutes lehrte, dem niemand mit gutem Beispiel voranging. Üben wir Barmherzigkeit an ihm, wie es einst der liebe Heiland mit den Sündern getan hat. Vielleicht gelingt es, ihn auf gute Wege zurückzuführen und seine Seele zu retten."
"Du glaubst, Schwester, dass noch etwas Gutes aus diesem verworfenen, kleinen Geschöpf werden kann? Ich bin der Meinung, dass alle Mühe, einen braven Jungen aus ihm zu machen, ganz vergebens wäre."
Der kleine Zigeunerjunge, der bisher mit tief über der Brust gesenktem Kopf dem Gespräch der Geschwister Marillac gelauscht hatte, richtete nun seinen Blick voll und offen auf den jungen Mann.
"Versuchen Sie es, stellen Sie mich auf die Probe", sagte er mit fester Stimme. "Ach, vielleicht stände es heute nicht so traurig um mich, wenn jemand mich gelehrt hätte zu beten", fügte der Kleine mit tränenerstickter Stimme hinzu.
Auch die Augen der beiden Geschwister schimmerten jetzt feucht. Ein flehender Blick Luisens traf ihren Bruder. Er verstand die beredte, wenn auch stumme Bitte, die aus ihm sprach.
"Nun wohlan, Kleiner, wir wollen es also versuchen und dich hier behalten, bis wir nach reiflicher Überlegung einen Entschluss in Bezug auf deine Zukunft gefasst haben. Dennoch muss ich dich aus Vorsicht, deiner Gefährten wegen, einige Tage in strengstem Gewahrsam behalten. Bist du mit allem einverstanden?" fragte der junge Mann, den Jungen aufmerksam musternd.
Ein Blick voll unendlicher Dankbarkeit war die Antwort des Kindes, indes es die Hand seiner Wohltäterin ergriff und sie heiß und innig an seine Lippen drückte.
Nachdem Michel de Marillac seine Schwester aufgefordert hatte, sich zur Ruhe zu begeben, da er alle nötigen Maßregeln treffen würde, um das Schloss vor dem Überfall der Zigeuner zu schützen, entfernte er sich in Begleitung des Jungen.
Allein zurückgeblieben, zog Luise aus ihrer Tasche das lederne Säckchen hervor, das der kleine Zigeunerjunge ihr übergeben hatte, und besah es mit einem Gemisch von Neugierde und Interesse zugleich. Es war von seltener Schönheit und enthielt ein Pergament, auf dem man die Umrisse eines Heiligenbildes und den Namen "Agnes" ziemlich deutlich erkennen konnte.
"Seltsam!" murmelte das junge Mädchen mit steigendem Interesse, "wie kommt nur dieser Zigeunerjunge zu diesen Gegenständen, und welch Geheimnis mag wohl damit verbunden sein?"
Am folgenden Tag verbreitete sich in der ganzen Stadt das Gerücht von dem Vorfall im Schloss Marillac. Überall wurde davon gesprochen. Erst die Nachricht von einem dreifachen Mord, der in Paris verübt worden war, lenkte die Aufmerksamkeit der Stadteinwohner von diesem Vorkommnis ab, um sie der neuen Schreckenstat zuzuwenden. Auch die Königin Maria von Medicis wurde von ihr in Kenntnis gesetzt, und alsbald sandte sie ihren Sekretär Le Gras nach Frankreichs Hauptstadt, um sich an Ort und Stelle von dem Vorgefallenen unterrichten zu lassen.
Le Gras benützte seinen Aufenthalt in Paris, um der Familie de Marillac, mit der er eng befreundet war, einen Besuch abzustatten.
Noch unter dem Eindruck des ausgestandenen Schreckens und des seltsamen Abschlusses des nächtlichen Vorfalls beeilte sich Luise, ihm alles zu erzählen, und zeigte ihm auch bei dieser Gelegenheit das bewusste Ledertäschchen.
Kaum hatte der Sekretär der Königin es erblickt, als sich eine tiefe Blässe über sein Antlitz legte. Hastig griff er nach dem Täschchen, und nachdem er es sowohl als seinen Inhalt aufmerksam geprüft hatte, wandte er sich an Luise mit den Worten:
"Könnte ich den Jungen sehen?" Ein ängstlicher Blick des jungen Mädchens, den er richtig zu deuten wusste, ließ ihn schnell hinzufügen:
"Seien Sie ohne Sorge, Fräulein Luise, es soll ihm nichts geschehen; es ist nur unbedingt nötig, dass ich ihn spreche."
Wenige Minuten später wurde der kleine Zigeunerjunge hereingeführt. Le Gras ging eilig auf ihn zu und seine Stimme klang unsicher, als er den Kleinen fragte:
"Von wem hast du dieses Täschchen, mein Kind? Fürchte dich nicht und sage mir offen die Wahrheit."
"Es ist mein Eigentum", antwortete der Junge ruhig, "doch weiß ich nicht, wer es mir gegeben hat."
"Wer sind deine Eltern?"
"Auch dies ist mir unbekannt."
"Wie kommst du zu den Zigeunern?" fragte Le Gras mit steigender Erregung.
"Ich entsinne mich dessen nicht. Einer der Unsrigen erzählte mir nur einmal, ich wäre noch ein kleines Kind gewesen, als ein Zigeuner mich aus dem Wasser zog und in sein Lager brachte."
Der Junge wollte noch etwas hinzufügen, allein Le Gras unterbrach ihn mit vor Aufregung zitternder Stimme:
"Woher aber hast du dieses Täschchen? Ich muss es unbedingt erfahren."
"Es hing an meinem Hals, als man mich auffand, und seitdem habe ich mich niemals davon getrennt."
Unfähig sich länger zu beherrschen, zog Le Gras den Kleinen stürmisch an seine Brust und sagte aufs Äußerste ergriffen:
"Dann bist du mein so lange und so schmerzlich vermisstes Brüderchen! . . . Der Name, der auf dem Pergament noch deutlich zu entziffern ist, ist der Name unserer Mutter, die dir unmittelbar nach deiner Taufe das Säckchen um den Hals hing. Das darin enthaltene Bild der allerseligsten Jungfrau sollte dir Schutz und Schirm im Leben sein. Und . . . Gott sei innig gedankt, die Himmelskönigin hat ihre Aufgabe wie immer treu erfüllt."
Das fromme junge Mädchen ahnte in jener Stunde nicht, dass Gott sie einst zu seinem besonderen Dienst erwählen und sie ihm noch manch verirrtes Schäflein zuführen würde!
So seltsam die Wege des kleinen Andre Le Gras gewesen sind, so seltsam waren auch die Wege, die Luise nach göttlichem Ratschluss zu gehen bestimmt war.
Im Jahr 1613 heiratete sie Antoine Le Gras, den Sekretär der Königin Marie von Medicis und den Bruder ihres Schützlings. Allein schon im Alter von 34 Jahren (1625) verlor sie ihren Gatten und zog sich ganz von der Welt zurück. Ihr mit Liebe zu der Menschheit erglühendes Herz ließ sie sich gänzlich dem Dienst der Armen, der Kranken und der verlassenen Kinder weihen.
Mit dem heiligen Vinzenz von Paul gründete sie 1634 die Kongregation der Barmherzigen Schwestern, deren erste Oberin sie wurde.
Doch auch für sie nahte endlich die Stunde, da sie den Lohn ernten sollte für ihre Arbeit im Weinberg des Herrn. Sie starb im Jahr 1662.
Wie liebevoll mag die Rosenkranzkönigin ihr in ihrem letzten Stündlein beigestanden haben, die ihr im Leben so treu gedient und so oft die Bitte an sie gerichtet hatte:
"Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes."
________________________________________________________________________

Wilhelm Achtermann - Die Pietà im Dom von Münster
27. Wilhelm Achtermann, ein deutscher Künstler und Verehrer der Mutter Gottes - Von Silesia
Im August des Jahres 1799 wurde in einem Dorf nahe bei Münster in Westfalen dem Schreinermeister Achtermann ein Sohn geboren, der in der Taufe den Namen Wilhelm empfing. Niemand ahnte damals, dass nach hundert Jahren der Name dieses Jungen, Wilhelm Achtermann, mit größter Hochachtung als der eines der hervorragendsten deutschen Bildhauer genannt werden würde. Die Eltern Wilhelm Achtermanns waren sehr arm, so arm, dass sie oft genötigt waren, in Tagelohn zu gehen, und es war wohl anzunehmen, dass ihr Sohn es auch zu keiner viel höheren Stellung im Leben bringen würde. Kaum hatte der Junge das Alter dazu erreicht, musste er schwer in Feld und Garten arbeiten. War das schon in ziemlich anstrengendem Maß daheim der Fall, so wurde ihm noch viel mehr aufgebürdet, als er zu einem Onkel kam, der ein kleines Landgütchen besaß. Dieser sah in dem Jungen keinen Verwandten, sondern hielt ihn gleich einem Sklaven. Außer sich konnte der strenge Mann geraten, wenn er bemerkte, dass Wilhelm beim Kühehüten draußen auf dem Feld an einem Stück Holz herumschnitzte, bis allerhand nette Sachen unter seinen geschickten Händen entstanden. Gewöhnlich vernichtete er sie daraufhin und Wilhelm erhielt außerdem noch eine harte Strafe dafür.
Als der Oheim starb, vermietete Achtermann sich zu einem anderen Bauern und hier wurden ihm dieselben Anstrengungen zugemutet. Als seine Gesundheit diesen Anstrengungen nicht mehr standzuhalten vermochte, kehrte er in die Heimat zurück, und hier wurde Wilhelm im Alter von achtzehn Jahren Schreinerlehrling. Jetzt hatte der junge Mann endlich einen Beruf gefunden, der ihm seiner Veranlagung nach einigermaßen entsprach. Freilich widerstrebte es ihm, aus dem Material in seinen Händen nur einfache Möbel herzustellen, doch hinderte ihn jetzt wenigstens niemand daran, sich in den Feierstunden seiner Lieblingsneigung, dem Holzschnitzen, hinzugeben. Da er sehr gefällige Kreuze und kleine Statuen fertigte, erlangte er bald einen gewissen Ruf und man kaufte seine Schnitzereien gern. Trotzdem würde Achtermann aber niemals auf die Künstlerlaufbahn gelangt sein, wenn sich nicht zwei günstige Umstände verbunden hätten, die ihm den Weg zu ihr ebneten.
Eines Tages wurde in der Werkstätte, der er angehörte, das Gehäuse für eine Orgel der Kirche zu Recklinghausen bei Münster bestellt. Wilhelm, dem die Ausführung dieser Arbeit zum größten Teil übertragen war, ließ sie sich angelegen sein und wendete all das, was von künstlerischem Gefühl in ihm lebte, daran, die Schnitzereien so fein, sorgfältig und zart auszuführen, dass, als das Orgelgehäuse aufgestellt war, sein Auftraggeber, der Pfarrer von Recklinghausen, ganz erstaunt war. Er riet Wilhelm Achtermann, sich vom Handwerk ab- und der Kunst zuzuwenden, erkannte der geistliche Herr doch mit Kennerblick, dass ein außergewöhnliches Talent in dem schlichten Schreinergesellen schlummere. Er wäre auch gar nicht abgeneigt gewesen, dem Rat seines Gönners zu folgen, doch wie sollte es wohl der gänzlich mittellose und in den Jahren schon vorgeschrittene Geselle anfangen, zum Kunststudium zu gelangen?
Da schickte der liebe Gott einen zweiten günstigen Umstand, der endgültig entscheidend für Achtermanns weiteren Lebensweg werden sollte.
Als Achtermann seinen Militärpflichten nachgekommen war, nahm er abermals in Münster in einer Schreinerwerkstadt Stellung. Hier traf es sich, dass er für den Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, Herrn von Vincke, eine kostbare altertümliche Kommode auszubessern erhielt. Leider war sie so gebrechlich, dass eine Engelsfigur, die die Kommode schmückte, abbrach, und da sie durch und durch morsch war, durch nichts mehr zusammenhielt. Der Schreinergehilfe erschrak darüber sehr, wohl wissend, wie viel dem vornehmen Mann an dem alten Möbelstück lag. Da in des jungen Mannes Brust ein frommes, gottesfürchtiges Herz schlug, wandte er sich in seiner Verlegenheit an die beste Ratgeberin. Er machte eine Wallfahrt zur Mutter Gottes von Telgte bei Münster. Hier kam ihm der Gedanke, die zerbrochene Engelsfigur an der Kommode durch eine neue zu ersetzen, die er selbst schnitzen wollte. Gesagt, getan! Bald machte Wilhelm sich an die Arbeit und die Engelsfigur geriet so vortrefflich, trug die Kennzeichen einer so hohen Kunstfertigkeit an sich, dass beim Abliefern der Kommode Herr von Vincke, dem der Geselle sein Missgeschick offenbarte, über die Figur ganz erstaunt und erfreut war. Er fragte Achtermann, wo er sich diese Kunstfertigkeit angeeignet hat.
Der schlichte Schreinergeselle konnte aber nur antworten, dass er das alles aus sch selbst gelernt und er nicht die mindeste Anleitung dazu erhalten habe.
"Mein Sohn, in dir steckt ein großer Künstler", sagte Herr von Vincke und klopfte Wilhelm wohlwollen auf die Schulter, "möchtest du deine Anlagen wohl weiter ausbilden? Getraust du dir wohl, irgend eine Person aus Holz zu schnitzen?"
"O gewiss, Herr, ich glaube wohl, dass ich das vermöchte", erwiderte Wilhelm bescheiden.
"Dann wollen wir weiter sehen", entschied Herr von Vincke, "freilich müsstest du dann von der Heimaterde scheiden und nach Berlin übersiedeln, denn dort leben unsere größten und bedeutendsten Bildhauer."
Der gute Schreinergeselle war mit allem zufrieden, was sein Gönner ihm vorschlug, und brachte ihm einige kleine Schnitzereien, die Herr von Vincke nach Berlin zu senden versprach.
Nicht lange währte es, so traf von dort eine Antwort ein. Der berühmte Bildhauer Rauch hatte dem hochmögenden Herrn Oberpräsidenten zugesagt, seinen Schützling in seiner Kunstwerkstätte aufzunehmen.
So machte Wilhelm Achtermann, der inzwischen einunddreißig Jahre alt geworden war, sich auf den Weg nach Berlin, begleitet vom Segen seines Vaters und ausgestattet mit Empfehlungsbriefen seines Gönners, jedoch mit recht schmalem Beutel. Aus letzterem Grund war er genötigt, die weite Reise zu Fuß zurückzulegen, und manche Strapazen hatte der Sohn der roten Erde damals schon zu bestehen. Dennoch kam er im Herbst 1830 glücklich in Berlin an und suchte alsbald die Werkstätte des berühmten Rauch auf, an den er den Empfehlungsbrief des Oberpräsidenten bei sich trug.
Der vornehme Bildhauer glaubte aber in die Erde sinken zu müssen, als er in dem Schützling Herrn von Vinckes einen gänzlich ungebildeten, ärmlich gekleideten älteren Bauernburschen erblickte.
Aufs höchste enttäuscht, rief er seinen Mitarbeiter, den ebenfalls schon berühmten Bildhauer Rietschel herbei und sagte: "Sehen Sie nur, was man uns hier sendet! Ich denke einen gebildeten Menschen zu erblicken und muss erleben, dass Herr von Vincke uns einen Bauern empfiehlt, der nicht einmal hochdeutsch reden kann."
Rietschel, ein leutseliger Herr, lächelte freundlich und meinte, man könne es doch wenigstens versuchen mit ihm. Darauf führte er ihn zum Direktor der Königl. Kunstakademie Schadow, und als der sich über die Person Achtermanns orientiert hatte, wurde er in Gnaden angenommen.
Jetzt begann für Wilhelm Achtermann eine harte und strenge Lehrzeit. Hart in mancher Beziehung. Seine Armut machte sich drückend fühlbar, dass er oft tagelang kaum trockenes Brot zu essen hatte. Zwar war ihm von seinem Gönner, dem Oberpräsidenten, ein Staatsstipendium von jährlich 300 Talern ausgestellt worden. Doch nach zwei Jahren wurde es ihm wieder entzogen. Da Wilhelm Achtermann nämlich fest an seiner streng religiös-katholischen Überzeugung hielt, war er manchen Leuten in Berlin, die einer entgegengesetzten Richtung huldigten, nicht angenehm. Dass man ihm die materielle Unterstützung entzog, sollte die Strafe für seine nur richtige Handlungsweise sein.
Hunger und Durst waren aber nicht imstande, den angehenden Künstler in seinem Streben zu beeinflussen. Er ließ nichts außer acht, seine Kenntnisse nach allen Richtungen hin zu vervollkommnen. Offenbar ruhte Gottes Segen auf ihm, und als er seine ersten größeren Werke, eine lebensgroße, in Holz geschnitzte Engelsfigur und ein in Sandstein ausgeführtes Kruzifix, die ihm bereits einen gewissen Ruf verschafften, günstig verkauft hatte, konnte er sich seinen höchsten Wunsch erfüllen und das Ziel seiner Sehnsucht, Italien, aufsuchen.
Nachdem Achtermann sieben Jahre in Berlin sich seinen Studien gewidmet hatte, machte er sich, dem niemand mehr den ungeschlachten westfälischen Bauernburschen ansah, auf den Weg nach Rom.
In Brüssel verkaufte er ein Kruzifix, von dem Papst Gregor XVI. urteilte, dass es ein Werk ist, das Achtermann in die Reihe der ersten Künstler Deutschlands stellt.
In Rom entfaltete sich das Schaffenstalent Achtermanns auf religiösem Gebiet zur höchsten Blüte. Hier war es, wo jene Werke entstanden, die ihm für alle Zeiten einen unsterblichen Namen erwarben. Freilich musste der Künstler auch hier mit des Lebens Not und Sorge kämpfen. Zum Ankauf der großen, zu seinen Werken erforderlichen Marmorblöcke aus den Lagern von Carrara gehörte viel Geld, und der deutsche Künstler hatte gerade von diesem so gar keinen Überfluss. Jedoch zeigte sich auch hier, dass Gott denen, die ihm dienen und seinen Namen zu verherrlichen suchen. in besonderer Weise seine Gnade und Güte erzeigt.
In verschiedenen Fällen, wenn der Künstler infolge Hungers nahe daran war, vor Schwäche zusammenzusinken, sandte die Vorsehung Hilfe. Einmal boten ihm deutsche Landsleute, einfache Handwerksgesellen, die den großen Bildhauer in der deutschen Kirche antrafen, woselbst er seine Drangsal dem Herrn offenbarte, ihre Ersparnisse an. Ein anderes Mal, als er in halber Verzweiflung in seiner Werkstätte saß und vor Schwäche nicht mehr zu arbeiten vermochte, kam ein vornehmer Mann und kaufte ihm für eine große Summe das herrliche Kruzifix ab, das der Künstler soeben vollendet hatte.
Allgemach besserten sich die äußeren Verhältnisse des Künstlers und nun kam die Zeit heran, da er jene Werke schaffen sollte, die ihm nicht allein europäischen Ruf, sondern auch den des größten religiösen deutschen Bildhauers eintrugen. Seit jenen Tagen, da er als Knabe im Dom zu Münster weilte, schwebte ihm ein Bild der schmerzhaften Mutter Gottes vor, vor dem er gern seine Andacht verrichtet hatte. Dieses Bild durfte keinen Anspruch erheben, den Regeln der Schönheit zu entsprechen. Aus diesem Grund war es eine Lieblingsidee Achtermanns geworden, dieses wenig ansprechende Bild durch ein Werk seiner Hand, so schön es sein Künstlervermögen hervorzubringen imstande war, zu ersetzen.
Kaum hatte man in Münster, woselbst alle Kreise den Flug von Achtermanns Künstlergenie zur Höhe, mit großem Interesse verfolgten, von diesem Plan gehört, als sich ein Komitee bildete, das eine Geldsammlung veranstaltete, die solch glänzenden Erfolg hatte, dass man in der Lage war, dem Künstler eine bedeutende Summe zur Ausführung des schönen Gedankens zur Verfügung zu stellen.
Voll größten Eifers, angefacht durch die Großmut seiner Landsleute, ging Achtermann an die Arbeit und nach mehr als zwei Jahren war das Werk vollendet, das dem Künstler einen Weltruf einbringen sollte. Die in kostbarem Marmor ausgeführte Pietà, die im Dom zu Münster Aufstellung fand, ist eines der größten religiösen Kunstwerke nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen Welt.
Bald nachdem das Lieblingswerk Achtermanns, die Pietà, die kirchliche Weihe erhalten hatte, ging er daran, einen zweiten Auftrag seiner Vaterstadt Münster auszuführen. Diesmal galt es, eine Kreuzigungsgruppe zu gestalten, die zugleich ein Grabmal für den Bekennerbischof Martin werden sollte. Auch dieses Werk gelang, einzig dastehend in der Schönheit und Großartigkeit der Vollendung und Ausführung.
Ehe die herrliche Gruppe im Jahr 1858 auf das Schiff gebracht wurde, um von Rom nach Münster überführt zu werden, kam Papst Pius IX. selbst in die Werkstätte des Künstlers, um sein Werk zu betrachten und ihm seinen Segen zu geben. Auch das kunstsinnige Oberhaupt der Kirche war überwältigt von der Schönheit der Kreuzigungsgruppe und verlieh ihr einen Ablass für alle jene, die vor ihr ihre Andacht verrichten würden.
Als das enorme Werk nach mancherlei Mühsal und unter sichtlichem Schutz der Gottesmutter, zu der der Künstler allzeit großes Vertrauen gehegt hat, an seinem Bestimmungsort angelangt war, wurde es unter dem Andrang tausender von Gläubigen aufgestellt, und nun durfte Münster sich rühmen, Kunstwerke zu besitzen, wie sie zum zweiten Mal auf dem Gebiet der religiösen bildenden Kunst nicht mehr zu finden sind.
Eine nicht zu zählende Menge von Gläubigen hat sich seit jenen Tagen an den erhabenen Schöpfungen Achtermanns erbaut und manchen Dichter haben sie zu begeisterten Liedern angeregt.
Noch manches herrliche Werk ist aus der Werkstatt des großen deutschen Bildhauers hervorgegangen. Eine Grablegung Christi für den St. Veitsdom zu Prag entstand, eine Statue der allerseligsten Jungfrau für die St. Mauritz-Kirche zu Münster, eine Ecce-homo-Statue, die in Rom verblieb.
Nach Vollendung dieses Werkes war die Schaffenskraft des greisen Künstlers erschöpft.
Fortan lebte er still und zurückgezogen, sich den Werken der christlichen Nächstenliebe widmend, die ihm seine im Alter besser gewordenen Vermögensverhältnisse gestatteten. Manch schöner Zug ließe sich hierüber verzeichnen.
Anfangs der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts begann das Lebenslicht Wilhelm Achtermanns immer spärlicher zu glimmen. Doch so leidend der alternde Künstler war, verging kein Sonntag, an dem er nicht einer heiligen Messe beiwohnte und die heiligen Sakramente empfing.
An einem Maitag des Jahres 1884 verlangte Achtermann zum Campo Santo, dem deutschen Hospiz zu Rom, gefahren zu werden. Dort betete der silberhaarige Greis vor seiner Pietà, die er nach dem Modell seines Werkes zu Münster ausgeführt hatte. Dann wünschte er den Friedhof der Deutschen zu besuchen, den er mit einem Kruzifix aus Bronze mit marmornem Sockel geschmückt hatte.
Vor diesem Kreuzbild im Schatten der Peterskirche wünschte Wilhelm Achtermann begraben zu werden. Zu Füßen des Erlösers, "auf den er gehofft, und an den er geglaubt", wie er selbst auf das Grabmal gemeißelt hatte.
Vielleicht ahnte der fromme Künstler, als er sein Auge auf der Gruft haften ließ, dass sie sich bald für ihn öffnen sollte.
Kaum dass man den kranken Meister mit vieler Anstrengung in sein Heim zurückgebracht hatte, begannen die Vorboten seiner nahen Auflösung sich zu zeigen. Zwar sprach er noch klar über seinen Besuch im Campo Santo, doch der Kräfteverfall war ein sichtlicher, und als der Morgen des 26. Mai 1884 angebrochen war, entfloh die edle Künstlerseele dem Leib, um einzugehen in die Herrlichkeit Gottes, dessen Verherrlichung der Inhalt seines langen Lebens gewesen war.
________________________________________________________________________

28. Unsere Liebe Frau in der Rosengirlande - Von H. Verus
Im "Palazzo Pitti", einer der berühmtesten Gemäldegalerien nicht bloß von Florenz, sondern wohl der ganzen Welt, sieht man die meisten Besucher oft vor einem kleinen, äußerlich unscheinbaren Gemälde stehen: in Beschauung und Bewunderung ganz versunken, wollen sich manche von dem Bild gar nicht trennen. Und fast jeder Fremde ersteht sich eine Photographie davon, um sie als Andenken mit sich in die Heimat zu nehmen.
Das Gemälde nennt sich "La madonna in rose" - Unsere Liebe Frau in Rosen.
Es weist als Autoren-Vermerk das Wörtchen "Ignoto" auf. (Von einem unbekannten Meister.)
Das Bild ist in der Tat hoher Bewunderung wert. Es ist ein Meisterwerk ersten Ranges, trotzdem man den Schöpfer nicht kennt oder doch nicht nennt.
In einer blühenden Rosenstaude schwebt die Gottesmutter mit dem himmlischen Kind. Die Antlitze der beiden Gestalten sind so lieblich-schön, so huldvoll und menschengütig dargestellt, dass man ihren Anblick nie vergisst. Und auch die Rosenblüten sind gar herrlich, gar natürlich gemalt: teils als aufbrechende Knospen, teils als vollerblühte Zentifolien umgaukeln sie - wie ein trautsüßer Blütentraum - Mutter und Kind. Man glaubt wirkliche Rosenblüten vor sich zu haben, ihren Duft zu verspüren.
Von diesem lieblichen Gemälde nun erzählt man sich in der schönen Arno-Stadt eine anmutige, ehrwürdige Sage oder Legende.
Der Museumswärter, der in den Gemäldesälen seines Amtes waltet, teilt sie mit Vorliebe dem Fragesteller mit.
Vor vielen, vielen Jahren, so lautet diese Sage, lebte in Florenz ein berühmter Maler. Obgleich in jeder Art seiner Kunst bedeutend, verstand er es doch besonders meisterhaft, Bilder aus der heiligen Geschichte auf die Leinwand zu zaubern. Besonders erregten seine Christus- und Madonnenbilder nicht nur das Staunen der Sachverständigen, sondern auch die höchste Bewunderung des schlichten Volkes, das sich durch diese Bilder zur Andacht zum Gottmenschen und zu seiner heiligen Mutter wie mit Zauberhänden hingerissen fühlte.
Allein der Meister war recht arm. Denn Florenz befand sich damals noch nicht in jener Periode der Wohlhabenheit und Kunstfreude in der den berühmten Meistern der Malerei nebst hoher Anerkennung auch ausgiebige Geldmittel für ihre Schöpfungen zuflossen.
So fanden sich für die Bilder unseres Malers nur wenig Käufer. Der Künstler geriet darum öfters in bittere Not, zumal er auch eine zahlreichen Familie zu ernähren hatte.
Eines Tages hatte sich seine Notlage besonders schlimm gestaltet: keines seiner Gemälde war seit längerer Zeit verkauft worden, und so nannte der Maler bald nicht einen Pfennig mehr sein Eigentum. Die Kaufleute hatten ihm zwar, aus Rücksicht auf sein hohes malerisches Können und aus Mitleid ob seiner Not eine Zeitlang Waren auf Borg abgelassen. Allein schließlich sträubten sich auch sie gegen weiteren Kredit, und so versiegte zuletzt jede Hilfsquelle für den Armen. Der Maler war ratlos und der Verzweiflung nahe. Bleich und stumm sah er seine Gattin einherschleichen; die Kinder jammerten nach Brot.
Allein, woher Brot nehmen? Bekannte und Freunde waren schon zu oft in Anspruch genommen worden und versagten den Dienst; alles entbehrliche und wertvollere Hausgerät war bereits seit langem veräußert.
Sollte er gar betteln gehen? Nein, das litt sein Ansehen, sein Können nicht. Das Herz voll Weh und Bedrängnis, hielt es den Künstler nicht mehr in seinem Haus. Er ging jetzt in den Garten. Vielleicht, dass ihm in freier Natur eher ein Gedanke zur Rettung einfiele!
Wie schön sah es hier aber aus! Welcher Gegensatz zu seinem gramdurchwühlten Innern!
Der Maler hatte den Garten zu besseren Zeiten angelegt und allerwärts sehr gepflegt. Es war nun gerade zur Rosenzeit, und Rosen waren deshalb in allen Farben und Spielarten vertreten: da blühten in überreicher Fülle die einfachen Zentifolien neben ihren veredelten Schwestern, die sich in das zartweiße Gewand der Lilie oder in dunkelsten Purpur gekleidet hatten; da funkelten gar Blüten im Glanz des Goldes, und über den Mauern oder der lauschigen Laube baumelten Hunderte von mattfarbenen Schlingrosen. Und welch balsamischen Hauch sie verbreiteten!
Der Künstler weidete Auge und Herz an dem prächtigen Rosenbild. Es tat seinem zermarterten Kopf wohl, eine kurze Spanne Zeit an etwas anderes als an seine Not denken zu können.
Im Anblick der prächtigen Rosenblüten aber fuhr ihm sofort auch eine fromme Idee durch den Sinn: "Wie wundervoll sorgt doch", dachte er bei sich, "der gute Gott für seine Blumenkinder! Er lässt sie sprossen und gedeihen. Er spendet ihnen Himmelstau zum Trank und Sonnenglut zur Wärme. Sollte der Allmächtige sich da nicht auch seiner armen Geschöpfe erbarmen? Ihnen nicht des Lebens Notdurft verleihen, wenn sie ihn darum bäten? Ja, ja, das dürfte er wohl tun!"
Und still sank der Maler auf die Knie. Er hob die Hände himmelwärts und flehte aus tiefstem Herzensgrund: "O Herr, du gütiger, milder Vater der Menschen! Du siehst meine Not. Du kennst mein Elend; du weißt, dass ich es nicht verschuldet habe. Sei mir gnädig! Rette mich aus meiner Bedrängnis! Und du, hehre Mutter des Allmächtigen", wandte er sich sodann als großer Marienverehrer an die Himmelskönigin, "unterstütze meine Bitte bei deinem allmächtigen Sohn! Deiner Fürsprache wird Christus nimmer widerstehen können. Er, den du als zartes Kindlein auf den Armen trugst; den du hegtest und pflegtest, den du liebend begleitetest bis ans Ende seiner Lebenslaufbahn!"
Etwas erleichtert in seiner Seelenqual, lehnte der Meister sein Haupt an einen Baumstamm in der Nähe eines besonders blütenreichen Rosenstocks. Und - sei es nun, dass die durchgekosteten Seelenwallungen ihn müde gemacht; sei es, dass die duftschwere Luft ihn einschläferte, er schlummerte ein.
Im Schlaf aber hatte er einen wundersamen Traum: ihm deuchte, in dem prächtigen Rosenstrauch schwebe ein herrliches Bild, Maria mit ihrem himmlischen Kindlein in den Armen darstellend. Der Kopf der Madonna war unnennbar schön und edel; ihre milden Augen ruhten auf dem allmächtigen Kind, aus dessen zarten Zügen eine Sonne von Licht und Liebe, von Güte und Barmherzigkeit hervorstrahlte.
Der Meister atmete im Schlaf tief und erquicklich: das Traumbild, rings von den Strahlen des goldensten Sonnenscheins umflimmert; umblüht von den prachtvollsten Purpurrosen, dünkte ihm hinreißend schön. Und dann - waren die Äuglein des Jesusknaben nicht mit süßer Milde auf ihn, den Träumenden, hingerichtet? Schien der Mund des göttlichen Kindes sich nicht zu öffnen zu huldreichen Worten?
Ja, ja - das Jesuskind sprach! Und wie trostreich sprach es! "Auf mich setze dein Vertrauen", glaubte der Schlummernde zu erlauschen. "Ich werde deine Hilfe sein, zumal mich ja auch meine teure Mutter hierum bittet!"
Noch höher hob und senkte sich des Meisters Brust in diesem holden Traum. Ein unendlich süßer Trost zog ein in seine Seele. Gewiss, nunmehr musste seine Not ein Ende nehmen, da Mutter und Kind aus dem Himmelreich seiner so mildreich gedachten! Und mit größter Innigkeit versenkte sich der Träumende geradezu in jenes anmutige Schlafbild; fest und sicher prägte er sich die beiden Huldgestalten in Sinn und Seele ein.
Da löste sich ein Blatt von dem Baum los, unter dem der Maler ruhte, und flatterte ihm ins Gesicht. Ein tiefer, tiefer Seufzer - und der Schläfer erwachte. Sein Auge flog sofort zu dem Rosenstrauch - er war wie immer, ohne das erschaute Traumbild. Allein die Einbildungskraft des Meisters war so stark beschäftigt mit seinem Bild, dass es in seinem Herzen aufs lebhafteste fortlebte. Ja, er vermeinte deutlich eine innere Stimme zu vernehmen, die ihm zurief: "Auf, auf, Meister! Spute dich und bringe auf die Leinwand, was du eben gesehen hast! Es wird dein Glück und dein Segen sein."
Und der Maler folgte der Seelenstimme. Sogleich begann er das Bild, wie es ihm im Traum erschienen war, zu malen. Zug für Zug stand ihm davon tief im Herzen eingegraben. Er brauchte nur Einsicht in sich selbst zu halten, und alles trat klar und zum Sehen deutlich vor seine Augen. Und er malte und malte. Die innere Begeisterung beflügelte seinen Pinsel; verlieh seiner Hand eine solche Meisterschaft und künstlerische Schöpferkraft, dass das Gemälde in wenigen Wochen fertig war und an Schönheit, an Vollendung alle früheren Arbeiten weit überstrahlte.
Die Menschen strömten scharenweise zum Haus des Malers zusammen, um das wundervolle Gemälde zu schauen und zu bewundern. Die einen rühmten daran die herrlichen, durch und durch edlen Gestalten der Gottesmutter und ihres Kindes mit dem gnadeausströmenden Antlitz; die anderen lobten die Rosen, die um die Himmelsgestalten blühten, die anmuteten wie Blumen aus den Gefilden der Seligen.
"La madonna in rose", wie man das Gemälde nannte, gewann große Berühmtheit in allen Gauen Italiens. Es wurde von einem reichen florentinischen Fürsten für eine große Geldsumme erstanden. Später kam es in den Besitz der Stadt Florenz.
Aber dieses Meisterwerk brachte dem Meister noch weiteren Segen. Aus Dankbarkeit gegenüber seinen himmlischen Helfern erzählte er sein eigenartiges Erlebnis, und das Volk nahm nunmehr an, dass jener Traum eine besondere Begnadung des Malers vom Himmel sei, der ihm auf diese Weise seine Frömmigkeit und seinen Eifer für künstlerische Darstellungen aus der Heiligen Geschichte lohnen wolle.
Die Not des Meisters hatte nun ein Ende; es flossen ihm viele Aufträge zu Gemälden zu, und sein Name bekam einen noch besseren Klang, als er ihn schon ehedem hatte - und dies weit über Florenz hinaus.
Der berühmte Mann aber blieb allzeit einfach, bescheiden und schlicht. Allen Erfolg seiner Kunst, allen Ruhm schrieb er der Güte Gottes und besonders derjenigen seiner hohen Schutzfrau Maria zu. Aus diesem Grund lehnte er auch alle öffentlichen Ehrenbezeugungen, insbesondere die ruhmvolle Nennung seines Namens unter seinen Bildern in öffentlichen Museen ab.
Noch viele, viele Bilder flossen aus seinem Pinsel - aber kein einziges weltliches mehr. Nur religiöse Entwürfe wählte er sich mehr für seine Kunst. Und noch heutzutage reißen seine Figuren aus der Religion, besonders aber seine Marienbilder, Tausende Menschen zur Frömmigkeit und zu gutem Lebenswandel fort.
________________________________________________________________________

29. Seine Barmherzigkeit währt ewig!
Groß ist der Herr in seiner Güte und seine Barmherzigkeit währt ewig.
Vor noch nicht sehr vielen Jahren gerieten eines Tages die Biederen Leutchen eines kleinen Dörfchens in der Nähe einer Stadt in eine leicht begreifliche Aufregung. Einzeln oder in Gruppen standen sie auf den Straßen und guckten noch viel mehr heimlich zwischen den blühenden Blumenstöcken auf den Fensterbänken nach einem großen Haus am oberen Ende des Dorfes hin, vor dem ein Möbelwagen hielt, aus dem flinke Hände eine stattliche Zahl hübscher Einrichtungsstücke hervorzauberten. Sie gehörten, so erzählen sie sich, einem reichen Kaufmann, der sich hier niederlassen will, um von seinen Renten zu leben.
Bald darauf kam er selbst - ein freundlicher Herr in schon vorgerücktem Alter. Seine Frau war gestorben, und da er keine Kinder besaß, bildeten ein Kammerdiener und ein Koch die gesamte Begleitung. Neben dem Haus lehnte sich ein Garten bis zum Nachbar, einem jungen Kaplan, und stieß an dessen Hof. Herr Goldmark hatte eine große Vorliebe für schöne Blumen. Tagtäglich konnte man den alten Herrn bei der Pflege seiner alten Rosen und Obstbäume beobachten und eine ganz von weißen und roten Kletterrosen umwucherte Laube war sein Lieblingsplätzchen. Hier verbrachte er bei gutem Wetter, wenn der Rheumatismus ihn nicht zu viel plagte, den größten Teil des Tages, las die Zeitungen und trank einen Kaffee.
Den Nachbar kannte er nur vom gelegentlichen Sichsehen. Näheren Verkehr mit ihm zu pflegen, fiel dem alten Herrn aber nicht ein. Das duldeten seine "Prinzipien" nicht. Obgleich einer guten katholischen Familie entstammend, kümmerte er sich seit langen, langen Jahren nicht mehr um Kirche, Beichte und Sakramente. Der liebe Gott war für Herrn Goldmark einfach nicht da, und dachte er hier und da einmal unwillkürlich an ihn, so schlug er sich den Gedanken, vor seinem Richterstuhl antreten und Rechenschaft ablegen zu müssen, rasch aus dem Sinn - oder ging in die Rosenlaube, um irgendeine Beschäftigung vorzunehmen. Das Unkraut des Unglaubens und der religiösen Gleichgültigkeit war dichter ums Herz aufgeschlossen, als dass die Gnadensonne hätte hineinschauen können.
Dennoch sollte sie triumphieren!
Herr Goldmark war eines Tages über seiner Lektüre ein wenig eingenickt, als ihn ein furchtbarer Spektakel aufschreckte. Was war geschehen? Nichts Besonderes: der kleine Rattenfänger des Nachbarn hatte eine unglückliche Katze aufgestöbert, die er wütend verfolgte. In ihrer Angst zwängte sich das Tier durch ein Loch in des Kaufmanns Gartenhecke; wo aber eine Katze durchschlüpfen kann, da kann dann auch so ein schmales Hündchen durchkriechen, und der alte Rentner musste zu seinem Ärger wahrnehmen, wie die wilde Jagd ihm die schönsten Rosensträucher umriss und zerzauste. Auf sein kräftiges Schimpfen eilte der Diener herbei und stiftete Frieden.
Der Kaplan, der von seinem Zimmer den Vorgang angesehen hatte, machte sich alsbald auf, um dem geschädigten Herrn einen Entschuldigungsbesuch zu machen.
Der Kaufmann empfing ihn nicht sonderlich freundlich und zeigte dem bestürzten jungen Priester sehr eingehend, was das Hündchen angerichtet hatte. "Es tut mir leid, Herr Goldmark", sagte er, "dass Sie durch meine Schuld um Ihre herrlichen Rosen gekommen sind. Bitte, sagen Sie mir doch, wie ich Ihnen den Schaden ersetzen kann."
Der Groll des alten Herrn wurde durch diese Worte ein bisschen gemildert. Er bot dem Nachbar einen Stuhl an und meinte schließlich, es sei wohl gar nicht so schlimm gewesen, die Rosen würden sich schon wieder in Ordnung bringen lassen; man solle deshalb die Geschichte vergessen.
Der Kaplan war froh, die unangenehme Sache aus der Welt zu wissen und bedankte sich für die gütige Nachsicht.
Die Bekanntschaft war gemacht. Der Kaufmann hatte an dem bescheidenen jungen Mann Gefallen gefunden und wunderte sich, dass er - der verknöcherte Liberale - zuletzt sogar recht freundlich mit dem Priester sein konnte und seine Gesellschaft vermisste. Öfters sah man beide an lauen Sommerabenden in der Rosenlaube sitzen und dann erzählte der weitgereiste alte Mann von seinen Erlebnissen und Abenteuern.
Dem Priester war es kein Geheimnis, wie es um das Seelenheil des Nachbarn bestellt war. Er wusste aber auch zu gut, dass ein so tiefgefressener Krebsschaden nur nach und nach geheilt werden konnte. Deshalb sprach er nie ein Wörtlein darüber, betete indessen um so mehr für den Kaufmann, und ließ keine Gelegenheit vorübergehen, um die Barmherzigkeit Gottes zu preisen oder in geschickter Weise den einen oder den anderen Einwand, den man häufig gegen die Religion anbringt, zu entkräften.
Dem Rentner waren solche Unterhaltungen durchaus nicht unangenehm. Er versuchte denn auch seinerseits seinen Standpunkt zu vertreten und zeigte sich durchaus nicht beleidigt, wenn der Kaplan ihn übertrumpfte.
Dieser hoffte das Beste und verdoppelte seine Gebete für das verirrte Schäflein.
Es war eines Abends gegen Ende des Monats August, als die beiden so sehr verschiedenen Nachbarn im Garten promenierten. Plötzlich machte der Kaufmann vor einer Rosenpyramide Halt und betrachtete schweigend den reichen Blumenflor: "Sehen Sie diese welken Blüten, Herr Kaplan, sie haben alle Farben verloren und zeigen an, dass der Herbst und der Winter naht; es wird nicht lange währen, so wird Eis und Schnee die Beete bedecken. Der Mensch wird auch alt, Herr Kaplan, und es geht ihm, wie den Rosen."
"Das stimmt, Herr Nachbar, nur mit dem Unterschied, dass die Krone der Schöpfung berufen ist, zu herrlicherem Leben aufzuerstehen."
"Hm, hm, wer das genau wüsste?"
"Aber, bitte, Herr Goldmark, sagt es Ihnen nicht Ihr eigenes Herz? Fühlen Sie keinen Sehnsuchtsdrang nach etwas Schönerem, als die Welt zu bieten vermag? Denn das Menschenherz ist unruhig, bis es ruht in Gott. Achten Sie auf diese Worte, die hat jemand gesprochen, der irdische Vergnügungen im Übermaß genossen hat, aber keine Befriedigung fand."
"Sie meinen den heiligen Augustinus?"
"Ja, Herr Goldmark - und sein berühmtes Wort hat schon Unzählige den Weg zur wahren Heimat finden lassen."
"Herr Kaplan," - der alte Mann war einen Schritt zurückgetreten und zerknitterte in nervöser Hast einige Rosen - "Sie verstehen es, den Nagel auf den Kopf zu treffen - ja - mein Herz ist unruhig, aber - es soll ruhig werden. Zu Ihnen habe ich Vertrauen! Helfen Sie mir, meinen Lebensabend mit Gott zu beschließen."
Der Sprecher hatte diese Worte stoßweise hervorgezerrt - nun bedeckte er das Gesicht mit den Händen und weinte wie ein Kind. Gottes Gnade hatte das harte Eis geschmolzen, sie hatte gesiegt - und im Himmel freuten sich die Engel über die Rückkehr des verlorenen Sohnes.
Der tieferschütterte Geistliche führte den jetzt willenlosen Büßer zu einer Bank der schönen Laube und erfuhr nach und nach, was er zu wissen wünschte. Wie schlug in diesem Augenblick sein Priesterherz vor Freude und Dankbarkeit, als er in der schonungsvollsten Weise das Bekenntnis des geretteten Sünders entgegennahm.
Mitternacht war gekommen, da erhob sich der Priester, um mit Tränen in den Augen die Worte zu sprechen, die da kraft des Allerhöchsten die Sünden verzeihen und den verschlossenen Himmel öffnen.
"Ich hätte nie gedacht", sagte der glückstrahlende Kaufmann beim Abschied, "dass wir eine solche unverdiente Gnade zuteil werden könnte. Ja, Gott ist barmherzig, die Demütigen erhöht er vom Staub, und die ihn suchen, finden reichlich. Hochgelobt sei der Name des Herrn, wie bin ich so froh und so glücklich."
"Das danken Sie Ihrem guten Willen; wer will, der wird gerettet."
"Aber zumeist Ihnen, Herr Kaplan! Wissen Sie noch, Ihr Hündchen? Damals tat ich Ihnen Unrecht. Ohne den kleinen Zwischenfall hätte ich wohl niemals Ihre Bekanntschaft gemacht. Ihre geistvollen Bemerkungen veranlassten mich zum Nachdenken - meine Bekehrung ist ihr Werk."
"Nicht doch, Herr Goldmark! Ich bin nur ein unwürdiges Werkzeug an der Hand des Allerhöchsten gewesen. Er war es, der das Werk in Ihnen begann und zur Vollendung brachte. Ihm allein sei alle Ehre."
An diesem Abend gab es zwei glückliche Menschen, denen das Übermaß der Freude den Schlaf raubte.
Der Kaplan war endlich eingeschlummert, als ein starkes Läuten seine Ruhe schon wieder störte. Er öffnete das Fenster - draußen stand der Kammerdiener des alten Kaufmanns. Schreckensbleich rief er: der Herr möge sofort kommen, seinen Herrn habe ein Schlagfluss getroffen. So war es. Der Priester konnte ihm noch eben die hl. Ölung erteilen, dann verschied der Wiedergefundene mit einem Lächeln um die starren Lippen.
Wer möchte daran zweifeln, dass Gott ihm ein gnädiger Richter gewesen sei - ?
Denn groß ist seine Güte und seine Barmherzigkeit währt ewig.
________________________________________________________________________

30. Verirrt, verunglückt und zweimal gerettet - Von Rudolf Grein
Ein wunderschöner Sonntagmorgen war angebrochen. Helles Sonnenlicht umflutete die schroffen und oft seltsam gestalteten Alpenhöhen der schönen, sagenumwobenen Umgebung des Vierwaldstätter Sees in der Schweiz und drang, langsam sich durch den Morgennebel Bahn brechend hinab in die grünenden Täler, aus denen hier und da ein freundliches Städtchen oder Dörfchen aufschaute. Munteren Schrittes zogen drei junge Burschen die bergan führende Landstraße, der eine mit einer mäßig großen Reisetasche, die zwei anderen mit bequemen Rucksäcken ausgerüstet.
Es waren Studierende aus der Moselgegend. Der älteste von ihnen hieß Erwin Riedberger und hatte schon vor einigen Jahren Gelegenheit gehabt, diese herrliche Gegend zu durchwandern. Jetzt, während der schönen Zeit der Herbstferien, hatte er seinen Freund und Landsmann Paul Ellmer, der mit ihm an einer süddeutschen Universität Medizin studierte, zur gemeinschaftlichen Reise in die Schweiz beredet. Ihnen hatte sich Ellmers jüngerer Bruder Anton angeschlossen; er besuchte noch das Gymnasium, und die hellgrüne Mütze kennzeichnete ihn als Schüler der Unterprima.
Das fröhliche Kleeblatt hatte schon eine mehrtägige Wanderung hinter sich. Ihr Ausgangspunkt war Altorf im Kanton Uri gewesen, von dort waren sie längs der Reuß dem Vierwaldstätter See entgegengezogen. Alle die Punkte, die in der Sage vom Schützen Wilhelm Tell eine Rolle spielen, hatten sie mit lebhaftem Interesse besucht und besichtigt, als sie am östlichen Ufer des unteren Sees dahinmarschierten. Jetzt ging der Marsch auf Luzern zu, nachdem sie die letzte Nacht in dem nicht übermäßig teuren Gasthaus eines Dörfchens übernachtet hatten.
In der ersten Frühe des Morgens erreichten die drei Jünglinge das Städtchen Brunnen und mussten nun für einige Stunden das lachende Ufer des Vierwaldstätter Sees verlassen, die Straße zog sich landeinwärts. Jetzt kam das Dorf D... als nächstes Ziel. -
"Wenn die jungen Herren hübsch ausschreiten, so können Sie noch vor acht Uhr in D... sein und dort der heiligen Messe beiwohnen", hatte am frühen Morgen die Besitzerin des Dorfgasthauses, eine ältere, fromme Witwe, den jungen Leuten erklärt. "Und dann bleiben Sie noch ein Weilchen und Sie sich die wunderschöne Prozession an, die heute von den drei Gemeinden nach dem Gnadenkirchlein M., weiter hinüber in den Bergen, gemacht wird. Das ist eine schöne Marienkirche, und alle Jahre am Fest Mariä Namensfest geht die große Prozession dorthin. Wenn die jungen Herren wollen, können Sie auch ein gutes Stück mit der Prozession gehen, die geht reichlich eine halbe Stunde der Landstraße nach, dann schwenkt die Prozession nach rechts und Sie gehen eben weiter links aufwärts. Schaden wird es Ihnen ganz gewiss nicht tun."
Diese Worte der alten Frau bildeten jetzt das Gespräch der Jünglinge, und Riedberger und Paul Ellmer spöttelten und witzelten nicht wenig über die altmodischen Ansichten der bejahrten Frau. Der Besuch der heiligen Messe, so erklärte der erstere, verursache nur unnötigen Aufenthalt, und die Teilnahme an der Prozession sei eben nur eine lächerliche Zumutung, die man einer alten Dorfschenkenwirtin des Kantons Schwyz nicht weiter übelnehmen dürfe.
Paul stimmte ihm willig bei, nicht aber dessen jüngerer Bruder.
"Ich kann wirklich nicht einsehen, weshalb der Besuch der heiligen Messe unsere Reise irgendwie beeinträchtigen sollte", erklärte er. "Wir marschieren doch nur bis zum nächsten Ort, bis G..., dort wollen wir bis zum Nachmittag rasten. Was liegt denn daran, ob wir diesen Ort eine Stunde früher oder später erreichen? Bislang habe ich, falls nicht Krankheit mich zurückhielt, an jedem Sonn- und Feiertag die heilige Messe besucht, und eine Reise in die Alpen und alle Schönheiten dieses Berglandes sollen mich nicht davon zurückhalten."
"Geschmackssachen!" antwortete Riedberger und warf einen verächtlichen Blick zu dem Sprecher hinüber.
"Ich will dich nicht tadeln", nahm der ältere Ellmer wieder das Wort, "und würde zu Hause sogar mittun, nur um nicht die ewigen Klagen und Vorwürfe von Vater und Mutter hören zu müssen, hier aber sind wir unsere eigenen Herren."
"Das erste Kirchengebot bleibt für den Katholiken gleichwohl bestehen", wies ihn Anton zurück. "Und heute, am Fest Mariä Namensfest, soll ich mich zum ersten Mal über dieses Gebot hinwegsetzen? Der Zeitpunkt wäre wirklich schlecht gewählt."
"Schlagen Sie nur die Maria nicht allzu hoch an", warf hier Riedberger ein. "Sie bleibt ein Menschenkind, und nur Dummheit kann sie zu einer Gottheit erheben", spottete Riedberger von neuem.
Der Primaner blieb stehen und maß den Sprecher mit einem langen Blick. "Herr Riedberger", erklärte er, "Sie besuchen jetzt im vierten Jahr die Hochschule, mithin sind Sie gebildet und geschult genug, um zu wissen, dass kein Katholik die Mutter Gottes für eine Gottheit ansieht oder ihr göttliche Eigenschaften beilegt. Also muss ich Ihre letzten Worte als beabsichtigten Hohn auffassen. Was Maria für die Menschheit und somit auch für mich bedeutet, das raubt mir Zweifelsucht und Unglaube nicht. Eines aber weiß ich: Wer sich spottend über Gott und Glauben und Kirche hinwegsetzt, der wird sicher einmal zur Hölle fahren. Behagt Ihnen dieses Reiseziel in der Ewigkeit, Herr Riedberger, so bediene ich mich jetzt desselben Ausdruckes, den Sie vorhin mir zuriefen: Geschmackssachen! - Ich für meinen Teil habe nach einer derartigen letzten Reise kein Verlangen."
Die Unterhaltung drohte von Minute zu Minute einen schärferen Charakter anzunehmen, doch jetzt war D... erreicht. Überall sah man Andächtige zum Gotteshaus eilen, ganze Scharen strömten durch die Straßen, denn eben war auch die erste Nachbargemeinde eingetroffen, die ebenfalls in Prozession zum Gnadenkirchlein ziehen wollte.
"Wo treffen wir uns wieder?" fragte Anton jetzt kurz seine Begleiter.
"Im nächsten Ort, wie es vereinbart ist, im Hotel zum Bergadler", entgegnete Paul kurz, "wenn du dich denn einmal von uns trennen willst."
Auch Riedberger glaubte noch eine Bemerkung machen zu müssen. "Na, junger Mann, dieser Eifer wird bei Ihnen schon nachlassen. Bald kommen Sie zur Hochschule, wo man Ihnen ganz andere Lichter anzünden wird - - -"
"Versucht es nur, mir derartige Lichter des Unglaubens und der Gottlosigkeit anzuzünden", brummte Anton ärgerlich. "Ich werde sie Euch ausblasen, dass Ihr daran denken sollt." - Und damit wandte er sich auf den Weg nach dem Gotteshaus.
* * *
Zwei Stunden später standen hoch auf der schroffen Felswand, die sich nordöstlich von D... erhebt, auf die Mauerbrüstung des Verkehrsweges gelehnt zwei junge Männer und betrachteten mit spöttischen Mienen das bunte, belebte Bild, das sich jetzt drunten in der Tiefe entrollte. Dort war das Hochamt zu Ende und nun stellten sich die beiden Gemeinden auf dem freien Platz vor der Kirche zur Prozession, während eben jetzt eine dritte aus dem südlich gelegenen Wald unter andachtsvollem Gesang herangezogen kam und dort, wo ihr Weg in die breite Landstraße einmündete, Halt machte.
Es waren Paul Ellmer und sein Gefährte Riedberger, die da droben standen.
Beide waren, seitdem Anton sich von ihnen getrennt, wacker ausgeschritten. Schon bald standen sie an einem Kreuzungspunkt der Landstraße. Dieselbe führte geradeaus und verschwand in einer bewaldeten Bergschlucht, doch bevor sie diese erreichte, zweigte sich ein Weg zur Rechten ab, der sich um den Berg herum zu winden schien. Ferner zweigte sich jetzt eine mühsam angelegte Chaussee zur Linken in den seltsamsten Windungen bergan. Diese war es, die unsere jungen Wanderer beschreiten mussten. Sie verschmähten es, den Krümmungen der Straße zu folgen, und stiegen den ziemlich steilen Bergesabhang empor. Als die Landstraße über die Höhe sich dahinzog, lief zu ihrer Rechten eine niedrige Mauer. Sie war angelegt, um ein Abstürzen von Menschen, Vieh oder Wagen zu verhüten, denn gleich hinter ihr senkte sich die schroffe Wand eines hohen Granitfelsens steil abwärts. Hier hatten unsere Kletterer Halt gemacht und ließen es an spottenden Bemerkungen nicht fehlen.
"Siehst du, da unten, fast unter den letzten, ist dein Bruder", rief Riedberger seinem Freund zu. "Die grüne Mütze hält er in der Hand und lässt sich die Morgensonne auf den Kopf scheinen. Mag es ihm wohl bekommen!"
"Er wird selbst die Folgen seiner Frömmelei zu tragen haben", meinte Paul. "Bis wir die Stelle erreicht, wo unser Weg sich abzweigt, muss es bereits zehn Uhr werden, wenn nicht gar noch später. Dann aber beginnt die Sonne höher zu steigen, und in der Sonnenglut einen solchen Berg zu erklimmen - na, ich danke bestens."
"Da, sieh, jetzt setzt sich der Zug in Bewegung", rief Riedberger wieder. "Warten wir, bis der Anton zu uns heraufkommt?"
"Das wäre allerdings eine vortreffliche Erprobung unserer Geduld", entgegnete Ellmer spottend, "zumal bei dem Schneckengang der Prozession. Anton mag nachkommen."
Der andere hatte nichts dagegen einzuwenden, und so setzten beide ihren Weg fort, nicht ohne wiederholt umzuschauen nach den Vorgängen, die sich da drunten im Tal abspielten. In der Tat, die Prozession kam nur langsam vorwärts, und als man an die Stelle kam, wo die dritte Gemeinde zur Eingliederung bereit stand, gab es einen ganz bedeutenden Aufenthalt.
Die schroffe Felsenwand jenseits der schützenden Mauer schien allmählich in eine grasige Abdachung überzugehen. Immer weiter dehnte sich dieser Abhang, mit prächtigen Alpenblumen geschmückt, und auch die Mauer hörte auf, denn die Straße zog sich nunmehr in nordöstlicher Richtung über die Mitte des Bergrückens hin.
Die Freunde zogen es vor, den Weg über den blumigen Grasteppich zu nehmen, denn so konnten sie auch die Vorgänge im Tal im Auge behalten.
"Sieh doch einmal, Erwin, die grünlich weißen Blümchen, ganz da unten, wo der Abhang wieder steiler und steiniger zu werden scheint", rief plötzlich der ältere Ellmer.
Alsbald hatte der Angeredete das Fernrohr auf die bezeichnete Stelle gerichtet!
"Edelweiß!" rief er jauchzend. Wirklich war es das schöne, vielbegehrte Blümchen, das dort in seltener Menge wuchs. Aber es war nicht ungefährlich, bis zu jener Stelle zu dringen.
"Mit einiger Vorsicht kommen wir schon herab", meine Paul. "Die Reisetasche und den Rucksack verbergen wir einstweilen. Dort steht ja ein wilder Rosenstrauch."
Gesagt, getan. Vorsichtig kriechend und mit den Händen sich in den Erdboden einwühlend, arbeiteten sich die Freunde nicht ohne einiges Bangen abwärts. Erwin langte zuerst bei den schönen Blümchen an. "Hurra! ich habe mir das schönste Sträußlein Edelweiß erobert", rief er übermütig und begann ein hastiges Pflücken. Aber noch nicht zehn der Blumen nannte er sein eigen, als er mit einem Fuß ins Straucheln und Gleiten kam. Er versuchte sich festzuhalten, umsonst, schnell glitt er abwärts, jetzt ein Schwung, und sausend fuhr er herab und fiel in üppiges, fast meterhohes Gras, wo er liegen blieb. Noch hatte er nicht Zeit gefunden, zu überlegen, was eigentlich geschehen war, als ein sausendes Geräusch ertönte und gleichzeitig ein schwerer Körper neben ihn ins Gras purzelte. Es war sein Freund, der ihm auf der Stelle, wenn auch unfreiwillig, gefolgt war.
"Guter Gott - das war ja die buchstäbliche Höllenfahrt", stöhnte Paul Ellmer.
"Und das noch an einem Marienfest, wo die Prozession dort unten für alle Welt singt und betet! Welch ein Gegensatz!" spottete der andere, der sich bereits wieder erholt hatte.
"Lass deinen Spott", verwies ihm der andere. "Sehen wir lieber, wo wir uns eigentlich befinden und wie wir uns retten können. Unsere Lage scheint eher alles andere als beneidenswert zu sein."
Beide erhoben sich. Sie waren unverletzt geblieben. Da sahen sie nun, dass sie sich auf einem Felsvorsprung befanden, der nur einige Quadratmeter umfasste. Über ihnen dehnte sich der Bergesabhang, und besaß dieser weiter oben die Neigung eines gewöhnlichen Hausdaches, in einer Höhe von etwa zwanzig Fuß, über ihnen aber wurde dieselbe steil wie die Pyramide eines Kirchturmes. Ein Hinaufklimmen war gänzlich unmöglich. Unter ihnen senkte sich die graue, steile Felswand.
Da standen nun unsere beiden Spötter, immerhin noch über sechzig Fuß hoch über dem flachen Boden. Die Prozession verschwand eben in der waldigen Bergschlucht. Laut riefen sie um Hilfe, aber niemand hörte sie, niemand kam des Weges. Und höher und höher stieg die Sonne, der Berg schien zu erglühen unter ihren sengenden Strahlen. Die beiden Jünglinge hatten ihre Vorräte droben an der Landstraße versteckt; jetzt litten sie an brennendem Durst, und der ältere Ellmer begann bereits zu erwägen, ob ihn nicht die gerechte Strafe treffe dafür, dass er so lange gegen Gott und sein Gebot von der Heiligung des Feiertages gefrevelt habe.
Aber langsam zog dann der Abend herauf und brachte einen feuchtkalten Nebel, der sich um die Höhen lagerte. Zähneklappernd schmiegten sich die beiden Verunglückten eng aneinander und wagten nicht, sich von der Stelle zu bewegen.
* * *
Rüstig und munter war Anton den Bergpfad aufwärts geschritten. Er durfte sich nun nicht mehr um die Aussicht in das Tal und um die blühenden Alpenblumen kümmern, galt es doch, die Gefährten wieder zu erreichen. Und bis nach H., wo man sich wiederfinden wollte, waren noch gute zwei Stunden zurückzulegen.
Ein frohes Liedchen singend, marschierte unser junger Freund auf der Landstraße hin, unbekümmert um die glühende Sonnenhitze. Bald war der nächste Ort erreicht; Anton hatte schnell das Hotel zum Bergadler gefunden. Hier fragte der junge Ellmer nach dem Bruder und dem älteren Reisebegleiter, und war nicht wenig befremdet, als man ihm mitteilte, dass im Laufe des Tages noch kein Fremder im Hotel eingekehrt sei.
Anton beschrieb seine Begleiter, der Wirt und die Kellner hörten aufmerksam zu, doch niemand hatten die jungen Herren gesehen.
Anton wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Hatten die beiden absichtlich eine andere Wanderstrecke gewählt, um seiner, des verspotteten Frömmlers, ledig zu werden? Nun, das letztere konnte geschehen. Anton war entschlossen, bis zum Mittag im Hotel zu bleiben. Hatten sich die Vermissten bis zu dieser Zeit nicht eingefunden, so wollte er ungesäumt die nächste Bahnstation aufsuchen und von dort nach Hause zurückkehren.
Viel zu sehen gab es allerdings in dem kleinen, einsamen Ort nicht.
Schon rückte der Abend heran, da wurde es auf den Straßen laut und lebhaft. Der alte Förster Uli war mit seinem Hund ins Dorf gekommen und musste wohl eine ungewöhnliche Neuigkeit mitgebracht haben, denn ein ganzer Schwarm Neugieriger folgte ihm und bestürmte den Mann mit Fragen aller Art. Aber jetzt kam dieser in das Gastzimmer, und während sein Hund einen Platz in der nächsten Ecke aufsuchte, legte der Mann, statt einer Jagdbeute . . . einen Rucksack, eine Feldflasche und eine Reisetasche auf den Tisch. Da gab es sofort neue Fragen und verwunderte Ausrufe.
"Ja, das ist eine seltsame Geschichte", berichtete der alte Jäger. "Wie ich über den Berg komme, läuft mein Waldmann den Abhang hinunter zu einem Strauch, kommt wieder, bellt und ist nicht von der Stelle zu bringen. Da gehe ich denn selbst vorsichtig hin - die Stelle ist gefährlich, - und finde hinter dem Strauch diese Gegenstände. Wo waren die Eigentümer? Ich habe geschrien und gerufen, allein niemand antwortete."
Anton hatte dem Bericht zugehört und kaum zu atmen gewagt. "Guter Gott!" rief er jetzt. "Das ist ja der Rucksack und die Feldflasche meines Bruders, und die Tasche gehört dessen Freund!"
Jetzt erzählte auch der Wirt, dass sein junger Gast schon eine gute weile auf die Ankunft zweier Begleiter warte. Der Förster schüttelte den Kopf.
"Das ist eine ganz dumme Geschichte", antwortete er, "aber es ist noch Ursache genug zum Hoffen vorhanden. Ich kann mir den Fall schon zurechtlegen. Die jungen Herren sahen das Edelweiß, das tief am Abhang in Menge wächst. Da sind sie hinuntergestiegen und unten, des Bergsteigens unkundig, völlig abgeglitten. Der hier sehr steile Abhang läuft aus in einem horizontalen, flachen Vorsprung, auf dem mannshohes Gras wächst. Da hinein sind sie gestürzt und befinden sich noch auf der Platte, vielleicht ganz unverletzt. Abgestürzt sind sie nicht in die Tiefe. Die Prozession, die gut vor einer Stunde wiedergekommen ist, hätte die Leichen unbedingt finden müssen, denn diese wären in unmittelbarer Nähe der Landstraße gefallen, und man hätte von dem Unglück schon mehr gehört. Ohne Hilfe können die Zwei aber auch nicht wieder hinaufkommen. Heute Abend können wir nicht mehr helfen, es ist ja dunkel, ehe wir ankommen: doch morgen mit den ersten Sonnenstrahlen müssen wir versuchen, Hilfe zu bringen."
Wohl an dreißig Männer erklärten sich bereit, mitzugehen. Noch in derselben Stunde wurden Bergstöcke und lange Seile zusammengebracht.
Anton war auf sein Zimmer gegangen. Hier machte sein Schmerz sich in heißen Tränen Luft, und er flehte innig zur Gottesmutter, doch den Bruder und dessen Freund nicht an Leib und Seele zugrunde gehen zu lassen. Dann suchte er den Pfarrer auf, um Rat und Trost bei ihm zu holen. Er hatte ja Ursache, für den Seelenzustand beider zu fürchten. - -
Mit Tagesgrauen begleitete er dann die wackeren Retter. Der alte Förster Uli war mit dabei, er bezeichnete die Stelle, wo er die Reisegeräte gefunden hatte. Langsam kletterten die Mutigsten bergab, bis an die Stelle, wo die jäh abschüssige Neigung ein Weitersteigen unmöglich machte. Hier wurden zwei Männer an den Seilen herabgelassen, und bald verkündete ein freudiger Ruf, dass die Gesuchten gefunden waren.
Aber in welchem Zustand! Matt, vor Durst fast verschmachtet, von Nebel und Tau durchnässt, musste man die Ärmsten an Seilen emporziehen. Paul war und blieb besinnungslos und fieberte heftig. Auf einer notdürftig hergestellten Bahre musste man ihn in das Dorf tragen. Der ungleich kräftigere Riedberger erholte sich schneller und war, nachdem er durch Speise und Trank erquickt war, bald wieder imstande zu gehen.
* * *
Fast achtundvierzig Stunden hatte Paul im Hotel besinnungslos gelegen. Die guten Leute hatten ihm alle Sorgfalt angedeihen lassen, Anton war nicht von seiner Seite gewichen, nur Riedberger hatte es vorgezogen, die Reise allein fortzusetzen. Ein Briefchen, das er zurückließ, kündigte an, dass er zum Krankenpflegen ungeeignet sei und die Reise dem langweilenden Aufenthalt an einem Krankenlager vorziehe; er wünsche dem Freund gute Besserung und baldiges Wiedersehen.
Heute war Pauls Befinden ein besseres. Der freundliche Pfarrer weilte auch bei ihm und redete ihm zu von der schuldigen Dankbarkeit gegenüber Gott. War es die Absicht, dem Gespräch auszuweichen oder sonst ein Grund, genug, Paul fragte nach seinem Gefährten Riedberger. Statt aller Antwort reichte ihm Anton schweigend dessen Briefchen.
Paul Ellmer las den Inhalt wieder und wieder, dann schüttelte er den Kopf.
"Und der Mann will mein Freund sein - - nun, diese Zeilen sagen mir mehr als die zwei Jahre des vertrautesten Beisammenseins!" seufzte er.
"Sind dir die Augen aufgegangen, Bruder?" fragte Anton ruhig.
"Herr Pfarrer!" begann jetzt der Kranke, "Ihnen wiederhole ich es . . . Der Mann, der sich Erwin Riedberger nennt, war ein falscher Freund, - er war mein Verführer, der mich auf der Hochschule um den Glauben meiner Jugend gebracht hat. Ihm kann ich es danken, dass ich Gott und Kirche vernachlässigt habe, dass ich noch vor vier Tagen das erste Kirchengebot verhöhnt habe. Hochwürden, kann ich das alles wirklich noch gutmachen?"
"Sie können es", antwortete der Pfarrer mild und erfreut zugleich. "Sehen Sie, die Mutter Gottes hat Sie nur durch Unglück zur Umkehr führen wollen. Würden Sie sich nicht zu einer herzlichen Beichte entschließen?"
"Sogleich, Hochwürden. Hier würde ein Aufschub einer Versündigung gleichkommen."
Anton verließ das Zimmer, nicht im mindesten darüber ungehalten. Als er zurückkehren durfte, lag ein verklärender Friede auf den Zügen des leidenden Bruders. Der gutherzige Pfarrer hielt noch immer dessen Hand in seiner Rechten.
"Und nun Mut! mein junger Freund", tröstete er. "Sie werden bald wieder hergestellt sein. Vergessen Sie Ihr Erlebnis nicht, und bleiben Sie der jungfräulichen Gottesmutter durch Ihr ganzes Leben dankbar."
________________________________________________________________________
 Marianisches
Marianisches


























