Geschichten des Lebens aus alter Zeit 2. Teil
1. Heldenhafte Abtötung - Von Franz Wienhold
2. Christus vincit, Christus regnat! - Osterskizze aus der Ewigen Stadt
3. Eine Ostergnade - Skizze aus dem Leben von Silesia
4. Der alte Organist - Osterskizze von Johannes Buse
5. Weißer Sonntag - Von A. Weber
6. Das blinde Kommunionkind - Von Elsbeth Düker
7. Am Tisch des Herrn - Von Stephardt
8. Tiefgesunken in der Sünde - Von Er. Krafft
9. Letzte Krankheit und Tod von Bernadette Soubirous
10. Woher der Schnaps?
11. Zur häufigen und täglichen Kommunion - Von Emil Springer SJ
12. Unter sicherem Schutz - Von Margarete Cochet
13. Die Freimaurerin - Von R. Pontis
14. Ave Maria!
15. Mariens Macht
16. Maria, Heil der Kranken
17. Auf abschüssigem Pfad - Von Hermann Weber
18. Das Kloster von den Rosen - Von Stephardt
19. Der Tod eines Führers der Katholiken in schweren Zeiten
20. Das Marienbild - Von Ernst Schultheiß
21. Mut - trotz wütender Revolutionäre - Von Stephardt
22. Bin ich`s? - Von Benedicta
23. Nord, Süd, Ost und West - Von Pia Rainer
24. Auf rechter Bahn - Von Silesia
25. Der Teufel soll dich holen!
26. Der Landsknecht - Von Hermann Weber
27. Der Sohn des Sklaven - Von Stephardt
28. Kaplan Marielux und Ramo Rodil
29. Ehrlich währt am längsten
30. Das alte Lied - das alte Leid!
________________________________________________________________________

1. Heldenhafte Abtötung - Von Franz Wienhold
Gleich in den ersten christlichen Jahrhunderten ließen sich an den Ufern des Nils zahlreiche Einsiedler nieder. Sie gingen von dem Grundsatz aus, dass es für das Seelenheil des Menschen sicherer sei, mehr zu tun als für jeden vorgeschrieben ist. So entstand das Anachoretentum. Zu den berühmtesten Anachoreten zählen der heilige Paul von Theben und der nur wenig jüngere Antonius. Angezogen durch den Ruhm des letzteren, sammelten sich zahlreiche Verehrer um ihn, so dass zu Phatum in der Thebais ein förmlicher Eremitenverein entstand. Wie strenge Abtötung hier geübt wurde, darüber erzählt uns der Kirchenschriftsteller Johannes Cassianus folgendes Beispiel:
Dem Abt Johannes von Scythen wurde ein Körbchen mit Feigen zugeschickt, damit er sich daran erquicke. Er verzichtete aber auf den Genuss der Früchte und sandte zwei seiner Schüler ab, dass sie das Körbchen mit den Früchten einem alten Einsiedler überbrächten, der weit entfernt in der Wüste wohnte. Alsbald machten sich die Schüler auf den Weg. Da überraschte sie plötzlich ein schweres Ungewitter; der Himmel verfinsterte sich, Blitze durchzuckten mit grellem Schein den Himmelsraum, unheimlich dröhnten die Donnerschläge durch die weite, in Todesschlummer daliegende Wüste. Die trockenen Rinnsale der Flüsse, die den Schülern eben noch als Wege gedient hatten, füllten sich in kürzester Zeit mit Wassermassen, die tosend durch das altgewohnte Flussbett rasten. Kaum war das Unwetter vorbei, da hatten sich auch schon die Wassermassen verlaufen. Nach kurzer Zeit waren die Flussläufe wieder wasserleer wie ehedem, aber als Wege waren sie wegen des Schlammes nicht passierbar. Die Schüler suchten sich einen anderen Weg und verirrten sich jetzt völlig in der weiten Wüste. Tagelang irrten sie umher, bis sie erschöpft zusammenbrachen. Da sie nicht zurückkehrten, schickte der Abt Johannes zahlreiche Männer aus, die Vermissten zu suchen. Nach langem Suchen fand man ihre Leiber entseelt im Wüstensand und neben ihnen stand das Körbchen mit den Feigen. Sie waren lieber Hungers gestorben, als dass sie die Früchte angerührt hätten, weil sie das für sündhaft hielten, denn sie hatten ja den Auftrag erhalten, die Früchte dem alten Einsiedler zu überbringen. Das war freilich zu streng gegen sich von den Schülern gehandelt. Aber ein herrliches Vorbild der Abtötung sind sie geworden.
________________________________________________________________________

Nicolò Barabino (Madonna dell'Olivo) Madonna von der Olive
2. Christus vincit, Christus regnat! - Osterskizze aus der
Ewigen Stadt von Huldreich Verus
Die Kutsche des angesehenen Arztes Dr. med. Schmitt rollte vor ein stattliches Haus in der belebten Hochstraße einer rheinischen Großstadt. Der Wagenschlag wurde von innen geöffnet. Es stieg hastig ein hochgewachsener Mann heraus, von ernsten, durchgeistigten Zügen, mit bereits leicht ergrautem Haupthaar: der Doktor und Hausherr.
Eiligen Schrittes durchmaß er das kleine, zierliche Vorgärtchen, und als in diesem Augenblick eine Dame unter die breite Haustür trat, belebte ein glückliches Lächeln sein Gesicht.
"Ich komme mit guten Nachrichten, liebe Frau!" rief er seiner Gattin zu. "Alles hat sich zu meiner Zufriedenheit abgewickelt."
Ein Leuchten ging bei diesen Worten des Arztes über das feine, aber blässliche Gesicht der Dame.
"Also du hast Vertretung für vier Wochen gefunden?" sagte sie frohbewegt, ihre schmale, weiße Hand in die ausgestreckte Rechte des Ankömmlings legend. "Wie mich das freut! nun kannst du dich doch etwas ausspannen von der anstrengenden Berufsarbeit! Kannst dir die so nötige Erholung gönnen!"
"Ja, und wir beide können endlich die lange geplante Reise nach Italien antreten", stimmte der Arzt in ihren hoffnungsfrohen Ton ein.
Die beiden traten ins Haus, wo sich im Wohnzimmer das begonnene Gespräch fortspann.
"Es trifft sich ausgezeichnet", plauderte Schmitt, "dass wir Anfang April unsre Reise anzutreten vermögen. Wir treffen dann in Italien den schönsten Teil des Frühlings an; haben also neben den Kunst- und Landschaftsgenüssen auch den Reiz der besten Jahreszeit in Aussicht."
"Und zur Osterzeit sind wir in Rom", nickte die frohlächelnde Frau. "Dort werden wir die erhebenden, herzbewegenden Zeremonien der Karwoche und des Osterfestes in der Peterskirche mit eigenen Augen schauen können."
"Die für mich besonders auch viel künstlerisch-kirchengeschichtliches Interesse haben dürften. Nun, wir werden beide unser Genügen, unsre Befriedigung dort finden, meine Liebe. Jedes in seiner Art. Und nun wollen wir gleich heute mit unseren Vorbereitungen zur Reise beginnen: ich ordne alles mit meinem Vertreter und mit den Patienten; du richtest unsre Reisebedürfnisse her."
"So machen wir es, Julius."
Hernach gingen die Ehegatten ihren Tagesbeschäftigungen nach.
* * *
Es war am Karsamstag. Strahlend umblaute ein wolkenloser Himmel die Ewige Stadt; von der Kampagna her umspülte sie eine erquickliche, lenzensfrische Luft.
Die Karsamstagsfeierlichkeiten im St. Petersdom hatten die Herzen unsres deutschen Ehepaars mächtig ergriffen. Das "Alleluja!" des zelebrierenden Prälaten, begleitet von brausenden Orgelklängen und von den mächtigen Tönen der wieder gerührten Glocken; vor allem aber die feierliche Verkündigung des offiziellen Beginnens der Osterzeit durch einen Kardinal von einer Loggia des hehren Gottestempels herab hatten die beiden bereits in wirkliche Festtagsstimmung versetzt: leuchtenden Auges traten sie auf den mächtigen Vorplatz von St. Peter. Ein unbeschreibliches Menschengewühl empfing sie. Die verschiedensten internationalen Gestalten und Sprachen schwirrten durcheinander. Die meisten Menschen blieben vor dem mächtigen Obelisk in der Mitte des Platzes stehen, dessen goldglänzende Aufschrift "Christus vincit, Christus regnat" weithin in der Sonne leuchtete; die heute ferner, zur Vorfeier des Auferstehungstages, von liebenden Händen mit prachtvollem Blumen- und Fähnchenschmuck umgeben war.
"Eine sinnige Inschrift", sagte der Arzt, der mit seiner Gemahlin ebenfalls vor den Obelisk getreten war.
"Übersetze sie mir!" bat die Frau.
"Christus siegt, Christus herrscht."
Die Dame zuckte ein wenig zusammen. Über ihr strahlendes Gesicht huschte ein flüchtiger Schatten; ja, ein eigenartiger, wehmütig-bittender Klang zitterte in ihrer Stimme, als sie versetzte:
"Du hast Recht, Julius. Ein sehr sinniger Spruch. O, möchte er doch tief in jedes Christenherz eindringen! Möchte er sich bewahrheiten, damit - -"
Sie schluckte die Endworte des Satzes herunter und sah mit feucht-schimmernden Augen zu ihrem Gemahl empor. Der verstand ihren Blick: wieviel Gedanken und Sorgen hatte sich die gute Frau schon um seinen Glaubenszustand, um sein Seelenbefinden gemacht! Wie oft hatte er sie mit verweinten Augen angetroffen, wenn sie ihm vorher vergebliche Vorstellungen gemacht hatte über seine religiösen Ansichten, die infolge von Überhäufung mit Berufsarbeiten von Jahr zu Jahr laxer und gleichgültiger geworden waren!
Ein tiefer Seufzer stieg bei diesen Gedanken aus der Brust des Arztes herauf: zu dem Mitgefühl mit seiner Frau gesellte sich auch eine gewisse Sehnsucht nach dem beglückenden, treuen, grübellosen Glauben seiner Jugend; nach derselben Seelenstimmung, die heute so viele Menschen aus fast aller Herren Länder um ihn herum zeigten und die so mächtige Förderung erhielt hier am Urbrunnen aller kirchlichen Gnaden. Sollte er zum Glauben, zu der Überzeugung seiner Frau zurückkehren?
Aber was würde seine Berufsarbeit hierzu sagen? Was seine Berufsgenossen in der Heimat, die fast durchweg dem Glauben gleichgültig oder gar feindlich gegenüberstanden? Die - -
"Guardi, signori, guardi!" (Schauen Sie, meine Herrschaften) tönte in dieses schwere Sinnen des Arztes eine freundliche Stimme: eine gutmütig aussehende Bäuerin in der kleidsamen Tracht der Umwohner von Rom stand vor den beiden und bot ihnen einen hübsch ausgezierten Olivenzweig zum Kauf an.
"Der Zweig des Friedens zum morgigen Osterfest", erläuterte die Verkäuferin ihr Angebot näher. "Christus ist auferstanden und hat mit seiner Auferstehung der Welt die Erlösung, den Frieden gebracht. Und zum Andenken hieran trägt man morgen in Rom vielfach das Sinnbild des Friedens anstatt der Blumen: Die Landleute zieren ihren Hut mit Olivenzweigen. Die Frauen und Mädchen tragen sie am Gürtel; die Familien stellen sie in Vasen im Wohnzimmer auf. Bitte, meine Herrschaften, kaufen Sie einen Osterfriedenszweig!"
Die Frau Doktor hatte bereits den schönsten Olivenstrauß aus dem Körbchen der Bäuerin ausgewählt. Mit Freude und Wohlgefallen betrachtete sie die zierlichen Blättlein, die oberseitig tiefgrün erglänzten und unterseitig weißlich schimmerten. Ihre Rechte strich fast zärtlich über die bunten Papierstreifen, die an einzelne Kleinzweiglein angebunden waren und leise im Wind flatterten.
"Quanto?" fragte der Arzt zur Börse greifend.
"Poco, signore. Quattro soldini." (Billig, Herr, vier Soldi)
Dr. Schmitt reichte der Verkäuferin sechs Soldi und erntete für diese Güte nebst einem graziösen Bückling innige Dankesworte nebst Segenswünschen fürs Fest:
"Troppo gentile, signore!" sprudelte die Frau. "Mille grazie, e buona pasqua! Il Signore risorto e la madonna rendano merito!" (Zu gütig, Herr! Tausend Dank! Der auferstandene Heiland und seine heilige Mutter mögen es Ihnen vergelten!)
"Welch freundliches, fröhliches Volk!" lobte der Arzt. "Und wie durch und durch religiös! Ihr ganzes Tun oder Lassen ist von lebendigem Glauben an Gott und an die Madonna durchdrungen."
"So ist es; und die Leute haben recht", versetzte seine Frau. "Ach, wenn man doch allgemein in der Welt einsehen möchte, welches Glück, welch wahrhaftige Seelenbefriedigung in der Liebe zu Gott und seiner heiligen Mutter liegt!"
Wieder seufzte der Arzt; wieder zog ihm jenes unbestimmte Sehnen nach den fried- und glücksvollen Tagen seiner religiösen Jugend durchs Herz. Nur viel stärker diesmal und im Anschluss an die Bemerkungen der zwei Frauen über die Marienverehrung, besonders auch in Bezug auf seine früher so innige Liebe zu Gottesmutter.
Und gerade der letzte Gedanke erfuhr im selben Augenblick eine energische Unterstützung: eine Verkäuferin von Ansichtskarten, die den Ankauf des Friedenszweiges aus der Nähe beobachtet hatte, steuerte eiligst auf das deutsche Ehepaar zu.
"Wünschen die Herrschaften vielleicht illustrierte Karten?" machte sie ihr Angebot. "Ich kann besonders mit sinnigen, festgemäßen Madonnenkarten dienen. Sehen Sie hier die "Madonna von der Olive"! Ein sehr schönes, gar sinniges Bild. "Du bist wie eine herrliche Olive auf den Auen", sagt der Meister auf dem Bild. "Maria ist als Gottesmutter die Spenderin des Friedens für die sündige Menschheit. Sie hat der Welt ihr Kind, also das Glück der Erlösung, die Befreiung von Elend und Kampf beschert. Sie ist also sicherlich wie der Friedensbaum auf den Auen; sie ist sicherlich - neben ihrem göttlichen Sohn - ebenfalls ein edles Sinnbild für den Ostertag."
Mit steigendem Staunen hatten die beiden dem Redefluss der Kartenhändlerin zugelauscht, der in Rom und in Italien indessen nichts Ungewöhnliches ist. Denn die meisten Italiener, auch der gewöhnliche Mann, zeigen sich äußerst beredt, wenn sie irgendein Ziel im Auge haben. Und kommt zu diesem Ziel noch ein religiöser Beweggrund hinzu, so erhebt sich ihre Wortgewandtheit nicht selten zu gutkleidender Begeisterung, die vornehmlich den Ausländer stutzig macht; ja, oft fortreißt.
"Wie gut und wahr sie spricht!" lobte die Gattin des Arztes. "Und wie wundersam die "Madonna von der Olive" auf der schlichten Karte sich ausnimmt!"
Und nicht bloß das Auge der zarten Marienverehrerin war sehnsüchtig nach den feinkolorierten Karten gerichtet; auch ihr Mann blickte mit unverhohlenem Wohlgefallen und voll tiefer Ergriffenheit darauf hin.
Wie traut, wie mild und voller Gottesfrieden schaute das süße Antlitz der Gottesmutter aus dem langen Schleiertuch hervor, das ihr Haupt umhüllt und fast ihre ganze Gestalt umwallt! Welch frieden- und glückausströmendes Antlitz hatte der kleine Heiland, der, von den Mutterhänden umschlungen, süßlächelnd einen Olivenzweig in der Linken hält! Dazu die Olivenzweige zu Häupten und Füßen der Madonna; einige Blumen und Blüten - ein wahrer Friedens- und Ruhehauch ging selbst von diesen schlichten Nachahmungen des herrlichen Gemäldes von Barabino aus! Die Madonna bot ihr göttliches Kind, das den Friedenszweig hochhält, der Welt.
"Durch Maria zu Jesus", murmelte der Arzt. "Beide sind die edelsten Sinnbilder des Friedens, der Olive."
Und tief Atem holend, bat er die Kartenfrau:
"Geben Sie mir zehn von diesen Karten!"
"Zehn!" rief sie erfreut. "O, Sie sind gewiss ein großer Verehrer der Madonna mit ihrem göttlichen Kind!"
"Gebe das Gott!" schluckte der Doktor nun ebenfalls an den Worten, indem er der Frau außer dem Kaufpreis noch eine Lire Trinkgeld verabreichte.
Und zu seiner Gemahlin gewandt, die die Augen voller Glückstränen hatte, sagte er:
"Gehen wir, liebe Frau! Christus siegt, Christus herrscht überall! Und vielfach in der Welt wird dieser Sieg des Heilandes durch die liebe Gottesmutter vermittelt, die von der Heiligen Schrift nicht ohne tiefen Sinn "eine herrliche Olive auf den Auen" genannt wird.
Ein leuchtender Osterhimmel sprühte am folgenden Morgen über Rom und über der himmelanstrebenden St. Peterskirche. Kuppel und Fassade schwammen in einem Meer von goldenem Licht. Tausende von festfrohen Menschen wimmelten auf dem prächtigen Petersplatz; und ebenso viele strömten zu den weitgeöffneten Prunktoren und zu dem Innern der ersten Kirche der Welt hin.
In einem Seitenschiff des Domes - da, wo sich die Beichtstühle für die hauptsächlichsten Sprachen der Welt aneinanderreihen - knieten vor dem Bekenntnisstuhl mit der Aufschrift "Für Deutsche" Herr und Frau Dr. Schmitt. Der Arzt bereitete sich seit längerer Zeit wieder zum ersten Mal auf seine Osterbeichte vor. Seine Gemahlin aber war nicht bloß hierüber glücklich, sondern empfand es auch als besondere Huld Gottes, dass sie diesmal im St. Petersdom zu den Ostersakramenten gehen konnte.
Osterjubel und Festfreude herrschte allenthalben in den mächtigen Hallen des Gottestempels; Osterglück und Herzenswonne leuchtete besonders aus den Augen des deutschen Ehepaares.
* * *
Im Arbeitszimmer Dr. Schmitts hängen über dem Schreibtisch zwei hübsche Bilder: eine "Madonna mit der Olive" und eine Photographie des Obelisk auf dem St. Petersplatz in Rom. Gar oft haften die Blicke der Ehegatten darauf, und jedes Mal flüstert der Arzt, der trotz seiner schweren Berufsarbeit ein vorbildliches Mitglied der katholischen Gemeinde seines Wohnsitzes geworden war, zu seiner Frau:
"Quasi oliva speciosa in campis" und "Christus vincit, Christus regnet!"
________________________________________________________________________

3. Eine Ostergnade - Skizze aus dem Leben von Silesia
Zur späten Nachmittagszeit ist es und goldener Sonnenschein umflutet ein junges Mädchen, das, mit einer Näharbeit beschäftigt, im Vorgärtchen des Häusleins, dem Maurer Wellner gehörig, sitzt. Ringsumher hat der Frühling seinen Einzug gehalten. Die Holunderbüsche haben schwellende, grüne Knospen angesetzt und auf den schmalen Beeten zu Füßen des Mädchens blühen Leberblümchen, Schneeglöckchen und rosig gefärbte Primeln. Elisabeth hat heute aber kaum einen Blick für ihre Lieblinge, ihr Sinnen liegt im Bann trauriger Gedanken, die ihr ganzes Sein erfüllen. Jetzt, da sie stetig ihre Näharbeit fördert, hat sie Zeit, über das, was sie bedrückt, nachzudenken und mancher Seufzer entfließt dabei ihrer Brust.
Elisabeth war bis vor kurzem in einem guten Dienst gewesen und hatte diesen verlassen müssen, da die alte Verwandte, die ihrem Vater seit der Mutter Tod die Wirtschaft führte, arbeitsunfähig geworden war. Der Vater wünschte, dass die Tochter ihre Stelle fortan ausfülle. Gern war Elisabeth dazu bereit gewesen, nur das hatte sie nicht erwartet, dass das religiöse Leben in ihrem Vaterhaus gänzlich erloschen sei. Es war für Elisabeth eine schmerzliche Entdeckung, als sie gewahren musste, dass ihr Vater, früher ein braver Katholik, in religiöser Beziehung völlig erkaltet war. Er betete nicht mehr, blieb dem Gotteshaus fern und empfing auch, als natürliche Folgerung, nicht mehr die heiligen Sakramente.
Auf die Bitten seiner Tochter, jetzt in der Osterzeit seinen Pflichten als katholischer Christ nachzukommen, hatte Wellner nur abweichende, hämische Bemerkungen, die ahnen ließen, dass die schlechte Gesellschaft, in die er geraten war, die Schuld der Wandlung trage, die sich in seinem Innern vollzogen.
Elisabeth erkannte bald, dass viel Reden hier augenblicklich nicht am Platz sei. Deshalb schwieg sie - richtete aber ihr Augenmerk darauf, durch ihr gutes Beispiel zu wirken und, was die Hauptsache war, sie betete ohne Unterlass zu Gott, dass das Herz ihres Vaters sich dem Guten wieder erschließen möge.
Blieb es dem Mädchen auch nicht verborgen, dass ihr Vater nicht eben günstig auf ihren häufigen Kirchenbesuch blicke, noch weniger auf die religiösen Übungen, die sie daheim vor ihrem Hausaltärchen vornahm, so ließ sie sich darin aber nicht stören, hoffend, dass dadurch doch ein Samenkörnlein in ihres Vaters Seele fallen und zu seiner Rettung etwas beitragen könnte.
Dann und wann auch wagte Elisabeth die Frage, ob der Vater nicht geneigt wäre, seine Osterkommunion zu halten; leider aber, dass sie sich nach wie vor mit abschlägigem Bescheid zufrieden geben musste.
Noch nie aber war das in so schroffem Ton geschehen als vor einigen Tagen, da die gute Tochter es wieder einmal versuchte, den Vater an die Erfüllung seiner österlichen Pflicht zu erinnern, mit Hinweis auf die Strafe, die die Kirche im Fall des Todes darauf gesetzt habe. Leider zeigte Wellner sich abwehrender denn je. Er hatte sich in herabwürdigenden, gotteslästerlichen Reden ergangen und der Tochter befohlen, ihn ein für allemal mit ihren religiösen Quälereien in Ruhe zu lassen. Geschähe das nicht, dann könne sie darauf gefasst sein, dass er auch ihr das Kirchengehen verbiete, und nicht mehr zulasse, dass sie so viel Zeit mit Beten und Lesen in frommen Büchern vertrödele.
Die Erinnerung an diese Stunde lag Elisabeth noch schmerzlich im Gemüt, und sie war es auch, die sie heute, trotz des schönen Frühlingssonnenscheins, in eine traurige Stimmung versetzte. Es blieb doch ein überaus schmerzlicher Gedanke, den lieben Vater an einem jähen Abgrund gehen zu sehen und zu wissen, dass seine Seele jetzt schmachvoll darbe, um einmal dem ewigen Tod zu verfallen. Unablässig betete die treue Tochter in diesen Tagen zu Gott, dass er doch, gegen alle Hoffnung, eine Wandlung im Herzen ihres Vaters vollziehen möge. Auch jetzt, während der Arbeit, reihte sich ein Gebetsseufzer an den anderen, die alle der Rettung der Seele ihres Vaters galten. Als die Sonne sich senkte, vom Kirchturm die Abendglocke erklang, betete Elisabeth noch einmal recht innig zu Maria der Hilfe der Christen, auch ihren Beistand in ihrem Anliegen erbittend.
Dann, nachdem die Glocke verklungen war, Elisabeth den Gefühlen ihres frommen Herzens Genüge getan hatte, stand sie auf, verließ das Gärtchen und begab sich ins Haus, alsbald fleißig am Herd zu walten, damit der Vater, wenn er von der Arbeit heimkehrte, den Abendbrotimbiss vorfand.
Eine Stunde verstrich und noch war der Vater nicht da. Elisabeth, die den Tisch sauber gedeckt hatte, begann sich zu sorgen und trat eben vor das Haus Ausschau zu halten, als sie den Erwarteten in der Ferne erblickte. Der Tochter kam es vor, als sei sein Gang heute langsamer wie gewöhnlich, und als er näher kam, fiel dem Mädchen ein ernster, nachdenklicher Zug in seinem Antlitz auf. Daheim angelangt, grüßte der Maurer sein Kind freundlicher als es sonst seine Art war. Dann entledigte er sich seiner Arbeitskleidung, säuberte sich vom Staub und setzte sich an den Tisch, seine Abendmahlzeit zu verzehren. Elisabeth, die ihm gegenübersaß, bemerkte zu ihrer Freude, dass sein Blick oftmals liebevoll auf ihr ruhe, um dann zu dem Kruzifix über dem Hausaltärchen hinüber zu schweifen.
Inzwischen war das Abendbrot verzehrt. Elisabeth trug ab und setzte sich dann mit ihrer Näharbeit zum Vater, der am Tisch sitzen geblieben war, entgegen seiner Gewohnheit. Für gewöhnlich benutzte er die Zeit nach dem Abendbrot zu irgend einer häuslichen Verrichtung. Heute aber verließ er das Zimmer nicht, sondern blies gedankenvoll dichte Rauchwolken aus seiner Pfeife. Elisabeth, erfreut darüber, den Vater in so gemütlicher Stimmung zu sehen, begann eine harmlose Unterhaltung, auf die der Vater aber nicht einging, so dass bald Schweigen im Stübchen herrschte. Plötzlich aber unterbrach Wellner das Schweigen mit den Worten: "Elisabeth, ich hätte etwas mit dir zu sprechen." Und als das Mädchen gespannt aufblickte, fuhr er fort: "Weißt du, ich habe mir die Sache überlegt. Es wäre doch wohl gut, wenn ich meine Rechnung mit Gott wieder einmal ins Reine brächte und die heiligen Sakramente empfing. Da ist neulich drinnen in der Stadt ein Zimmermann vom Gerüst gefallen und auf der Stelle tot geblieben; viele Jahre hat er von Gott nichts wissen wollen und hat auf keinen Zuspruch gehört. Als ihm jetzt der Pfarrer das kirchliche Begräbnis verweigern musste, war ein allgemeines Gerede und doch konnte er nur seiner Pflicht gehorchen. Weißt du, Elisabeth, diese Sache hat mir jetzt fortwährend in den Gliedern gelegen. Der Zimmermann, ein fleißiger Mensch, hat mir leidgetan; und doch musste ich sagen, der Pfarrer konnte nicht anders handeln; weshalb sagte sich der Zimmermann von der Kirche los? All die Tage habe ich darüber nachdenken müssen, und jetzt bin ich zu der Ansicht gelangt, dass man doch so ganz steuerlos ist und sich gar nichts für die Ewigkeit angesammelt, wenn man ohne Glauben dahinlebt und die Satzungen der Kirche nicht mehr erfüllt. Man weiß halt doch niemals, wann der Tod einen einmal schnell ereilt, und soll man denn so ganz unvorbereitet ins Jenseits hinüber? Es ist eben doch ein eigener Gedanke. Ich bin jetzt überzeugt davon, dass es doch gut ist, für die Ewigkeit vorzusorgen. . . . Und jetzt gehe, zünde die Kerze dort drüben an und bete mir etwas vor. . . ."
* * *
Worte vermögen die Gefühle nicht zu schildern, die das Herz der braven Tochter erfüllten, als ihr Vater am nächsten Sonntag neben ihr an der Kommunionbank kniete und sie gemeinsam das Brot des Lebens empfingen. Nicht zu beschreiben ist der heiße Dank, der dem Herzen Elisabeths entströmte, dass Gott ihr schwaches Gebet erhörte und den Strahl der Ostergnade in ihres Vaters Herz senkte, auf dass er sich seiner Pflichten als katholischer Christ wieder erinnerte und seine Seele rettete für das ewige Leben.
________________________________________________________________________

hl. Cäcilia von Rom
4. Der alte Organist - Osterskizze von Johannes Buse
Wiederum ist der Lenz ins Land gezogen, und nun müssen die grauen Nebel den siegreichen Sonnenstrahlen weichen. Mit voller Licht- und Glanzfülle fluten sie dahin über die waldreiche Gegend, über den glitzernden Fluss und über das schmucke Städtchen, das sich terrassenmäßig am Fuß des Höhenzuges erhebt, sie fluten durch die Fenster in die Räume der Armen und die Salons der Reichen: überall wecken sie Hoffnung und neues Leben, denn es ist Frühlingszeit.
Selbst der Greis, der täglich im hohen Lehnstuhl an seinem Fenster sitzt und träumend und sinnend in das wechselnde Landschaftsbild hinausblickt, fühlt neues Leben, neue Kraft in seinen alten Gliedern, wie ihn die warmen Strahlen treffen. Weit öffnet er die Fensterflügel, um voll und ganz das Licht in sein Gemach fließen zu lassen, um die linde Frühlingsluft mit vollen Zügen einzuatmen.
Wenn er nur noch einmal wie ein junger Bursche umhersteigen könnte in den waldigen Bergen; jetzt, wo die Veilchen sprießen und die Knospen schwellen und die zurückgekehrten Vögel ihre philharmonischen Lenzeskonzerte geben, wäre es ihm eine Lust. Aber er ist alt, er ist zum Greis geworden, zudem fesselt ihn ein chronisches Herzleiden oft ganze Wochen an das Zimmer; dann hat er nichts von der Natur wie die Aussicht aus seinem Fenster.
Nun ruht er zurückgelehnt in seinem Lehnstuhl, während die Sonnenstrahlen und die Luft mit seinen weißen Haaren spielen. Die glänzenden blauen Augen schauen hinaus über die Dächer der niedriger gelegenen Häuser, sie schweifen hinauf in die sonnige Bläue und hernieder ins Tal, wo der Fluss seine gewohnte Bahn zieht, sie gleiten von einem Hügel zum andern und bleiben endlich auf dem gotischen Kirchlein ruhen, in dem er so lange Jahre das Amt des Organisten verwaltet hatte.
Und er schließt die Augen, um den Erinnerungen, die sich ihm nun aufdrängen, ganz nachzugeben. So träumt und sinnt er eine ganze Weile.
Da klopft es an seine Tür.
"Herein!"
Der alte Pfarrer, eine ehrwürdige Gestalt, tritt in das Zimmer.
"Ah, guten Morgen, Herr Pfarrer!"
"Guten Morgen, Herr Waltermann!"
Die Hände finden sich zum herzlichen Gruß. Dann rückt der Alte einen Stuhl ans Fenster, und der alte Pfarrherr nimmt ihm gegenüber Platz.
Ein edles Greisenpaar.
"Heute komme ich mit einem Anliegen, mein lieber Herr Waltermann", beginnt der Pfarrer nach kurzer Unterhaltung.
"Da bin ich doch neugierig", lacht der Alte, während seine Augen fragend auf seinem Gegenüber ruhen.
"Der Herr Lehrer ist gestern Abend an das Sterbebett seiner Mutter gerufen worden, und nun sind wir ohne Orgelspieler. Heute konnten wir ja die Orgel entbehren, morgen aber, am hohen Osterfest, geht`s doch ohne dem nicht. Da dachte ich denn: da musst du einmal den Vater Waltermann bitten, dass er uns aus der Patsche hilft."
"Ich sollte morgen die Orgel spielen?" Ein Freudenschimmer fliegt über des Alten runzliches Gesicht.
"Es wäre mir lieb, Herr Waltermann! - Bei der Auferstehungsfeier ist es ja wohl nicht so nötig, die Prozession bewegt sich ja um die Kirche im Freien, aber das Hochamt, das Hochamt!"
"Wollte ich schon gern spielen, Herr Pfarrer, wenn . . ."
"Wenn? - Heraus damit, Herr Waltermann!"
"Sehen Sie, Herr Pfarrer, ich habe früher immer die deutschen Kirchenlieder gespielt. In den letzten drei Jahren hat der Lehrer gespielt und den Choralgesang eingeführt. Ohne jegliche Übung den Choralgesang zu begleiten, scheint mir gewagt."
Ernst sitzt der alte Waltermann, und der Pfarrer lacht.
"Wenn`s das ist, mein Lieber, so nehmen wir halt mal wieder die deutschen Kirchenlieder. Das Volk wird sie wohl noch singen können?"
"Das bedarf wohl keiner Frage", lacht nun auch Waltermann.
"Sie spielen also zum Hochamt?"
"Mit größter Freude, Herr Pfarrer."
"Na, dann wären wir ja schon geholfen."
Noch ein Weilchen unterhält sich der Pfarrer mit dem alten Organisten, dann geht er heim, Waltermann überglücklich zurücklassend.
* * *
Und Waltermann träumt und sinnt wieder. Leicht gerötet sind seine Wangen und freudig leuchten die Augen.
So ist es früher gewesen:
Wie ein König fühlte er sich, wenn er auf der Orgel saß, die Hände auf den Tasten, die Füße auf den Pedalen; mit seinen Melodien beherrschte er die Menge des Volkes. Meisterhaft verstand er es, seinem Instrument die schönen und erhabenen kirchlichen Melodien zu entlocken, herrliche Fugen wob er leicht und frei zwischen die Gesänge. - Dann aber war er ganz in seinem Element, wenn er Zeit und Gelegenheit hatte, ganz nach seinen Inspirationen zu spielen. Es war dann eine Lust, sein Spiel zu hören. Wie Engelsgesang erklang es dann oft, leise und zart, wie das Gebet eines Kindleins; allmählich schwoll die Tonfülle an, bis sie wie Posaunengeschmetter, wie Donnergetön von den Gewölben und Wänden widerhallte. Das eine Mal war es ein Jubelgesang, der sich emporschwang, der trillernden Lerche gleich, das andere Mal eine bange, klagende, zagende Trauerweise, wie es die Zeit oder das Kirchenfest erheischte. - Und das Volk hatte ihn verstanden. Eng schmiegte sich der Gesang an sein kunstvolles Spiel an.
Jahrelang hatte er so gewirkt. - Es war ja nur wenig, was ihm die Kirchengemeinde für seine Kunst zahlte, nun, es verschlug nichts. - Mit einer Jahrespension war er aus der Großstadt hierhergezogen, um hier Ruhe und Erholung nach langer, angestrengter Tätigkeit zu finden. Und da gerade der Organist gestorben war, hatte er die Stelle, mehr aus Liebhaberei, übernommen.
Dann aber war es anders geworden. Ein neuer Lehrer war gekommen, ein Anhänger und Förderer des Choralgesangs. Der alte Pfarrer war bald gewonnen, und eines Tages nahm der Lehrer auf der Orgel Platz: Waltermann war beiseite geschoben. Das Volk murrte anfangs über diese Neuerung, doch allmählich fand es sich mit den neuen Verhältnissen ab.
Und Waltermann? - Recht weh hatte es seinem feinfühlenden Herzen getan, als ein anderer seinen Posten, den er gern bis an sein Lebensende verwaltet hätte, übernommen hatte. Hart war es ihm geworden, die so liebgewordene Orgel mit den darin schlummernden Melodien zu missen, so hart, als wäre ihm ein Kind von der Seite gerissen.
Nun soll er noch einmal auf der Orgel herrschen, mit seinem Spiel das Volk regieren; gerade wie ehemals. - Überglücklich fühlt er sich bei diesem Gedanken. Mit einem seligen Lächeln auf den Lippen und vor Freude leuchtenden Augen sitzt er in seinem Lehnstuhl.
"Nun, Vater, ist es dir auch nicht zu kalt an dem offenen Fenster?"
Überrascht blickt Waltermann von seinem Sinnen und Träumen auf. Er hat das Eintreten seiner Tochter nicht bemerkt.
"Zu kalt? - Lisbeth, welche Frage? - Warm ist es, warm draußen und warm in meinem alten Herzen, denn Lisbeth, morgen spiele ich wieder die Orgel."
* * *
Ostern. -
"Christus ist erstanden!" Die Glocken jubeln es hinaus in die Lande, die Vöglein im Sonnenschein zwitschern es mit nimmermüden Kehlen, und die Menschen rufen es sich als Ostergruß mit fröhlichen Gesichtern zu.
Einzeln und in Gruppen begeben sich die Leute zur Kirche, um dem Hochamt beizuwohnen; bald ist das alte Gotteshaus bis auf den letzten Platz gefüllt.
Schon eine ganze Weile sitzt der alte Waltermann vor der Orgel; die Freude leuchtet aus seinem Gesicht, wie er die Finger leise prüfend über die Tasten gleiten lässt. Spielt der Wind auch noch nicht in den Kanälen, es sind doch dieselben Tasten, die einst seinen Fingern gefügig waren. - Als hätte er erst gestern seinen Posten niedergelegt, so kommt es ihm vor - so bekannt, so vertraut. -
Da tritt der Pfarrer an den mit Blumen und Kerzen geschmückten Altar - das Hochamt beginnt.
Waltermann gibt dem Kalkanten mit dem Glöckchen ein Zeichen. Dann fällt die Orgel ein: mächtig, brausend, als wollte sie hinausposaunen: "Christus ist erstanden!" Leise intoniert der Organist dann das alte Osterlied:
"Das Grab ist leer, der Held erwacht,
Der Heiland ist erstanden . . . . . . ."
Jetzt zieht er die Register, und das Volk - längst hat es gemerkt, dass der alte Waltermann wieder auf der Orgel sitzt - fällt mit vollem und kräftigem Gesang in das Spiel ein.
Wie berauscht von Glück und Seligkeit, sitzt der Alte an dem Instrument. Die ganze Wärme seines Herzens legt er in das Spiel. Und wie nun der dreifache Jubelruf "Alleluja" beginnt, da verschwimmt vor seinen Augen die Kirche.
. . . Ein geöffnetes Grab, Krieger liegen wie betäubt am Boden. Eine verklärte Gestalt, leuchtend wie die Sonne, tritt hervor . . .
"Alleluja!" braust die Orgel. - "Alleluja", jubelt das Volk.
Einen Augenblick stiert der Alte vor sich hin, dann schließen sich die Lider, die Hände gleiten von den Tasten, jäh unterbricht die Orgel das Spiel. Leblos sinkt der alte Waltermann auf seinem Sitz zusammen.
Ein Herzschlag hat das freudig bewegte Herz stille stehen heißen.
Mag es sein unterbrochenes "Alleluja!" die ganze Ewigkeit hindurch fortsetzen.
________________________________________________________________________

5. Weißer Sonntag - Von A. Weber
Eine überaus schöne und angenehme Erinnerung weckt es in dem Herzen eines jeden wahren, katholischen Christen - das Wort "Weißer Sonntag". Alt und jung fühlt sich zurückversetzt in die glücklichen Tage der Jugend, wo Friede und Freude in den jugendlichen Herzen wohnten und Sorge und Leid noch in weiter Ferne lagen; und aus dieser goldenen Zeit leuchtet besonders ein Tag glänzend hervor, der unauslöschlich eingeprägt ist in den Menschenherzen, der Tag der ersten heiligen Kommunion. Nicht mit Worten kann man es schildern, das Glück, das ein jeder empfand, als er zum ersten Mal hintreten durfte vor den Altar, um aus der geweihten Priesterhand das Himmelsbrot zu empfangen.
Und nun ist er wieder da, der Weiße Sonntag. Wie alle Hände sich fleißig regen in dem kleinen Städtchen, um diesen für die Jugend so bedeutungsvollen Tag recht feierlich zu begehen. Kirche und Schule sind bereits aufs prächtigste geschmückt und nun geht es nach Hause, um auch dort die letzte Hand anzulegen und alles für den kommenden Tag instand zu setzen.
Auch unsere kleine Marie gehört mit zu den Auserlesenen, die morgen zum ersten Mal dem Tisch des Herrn nahen dürfen, und man kann ihr die Freude und das Glück, das sie empfindet, aus den unschuldigen Augen lesen. Sie war ja immer ein braves, frommes Kind gewesen und keine Klage war je von Seiten des Lehrers oder Pfarrers zu den Ohren ihrer Eltern gelangt. Hastig eilte sie die wenigen Stufen hinauf, die zur Wohnung ihrer Eltern führen und sie traf den Vater, der etwas später von der Arbeit heimgekehrt war, gerade beim Mittagessen vor. Freudig schritt sie auf ihn zu, wünschte ihm eine gesegnete Mahlzeit und sprach von dem kommenden Morgen, und dass ihr der Tag schon viel zu lange dauere, bis er endlich da sei, der Weiße Sonntag. "Gelt, Vater", fügte sie dann schmeichelnd hinzu, "morgen gehst du aber auch einmal mit zur Kirche, weißt doch, es ist der schönste Tag im Leben, und wenn du auch sonst nicht zur Kirche gehst, so tust du es doch morgen mir zuliebe."
"Nun ja, wenn du es denn absolut haben willst, meinetwegen."
Jubelnd war die Kleine aufgesprungen und zur Mutter geeilt, um ihr die frohe Botschaft zu verkünden, dass der Vater morgen mit zur Kirche geht, während "Sepp", den es schon verdross, so schnell zugesagt zu haben, zur Tür hinausschritt, um noch einige Besorgungen in der Stadt zu machen. Dabei musste er an seiner Stammkneipe vorbei, und er konnte es nicht übers Herz bringen, heute daran vorbeizugehen.
"Holla, Sepp", tönten ihm schon beim Eintreten einige Stimmen entgegen, "ist höchste Zeit, der vierte Mann fehlt, komm, lass uns ein Weilchen spielen."
"Ach, kommt ihr schon wieder mit den verwünschten Karten, habe schon immer Pech dabei gehabt, und übrigens muss ich heute mein Geld etwas zusammenhalten, denn morgen ist Weißer Sonntag, und da kostet`s noch allerlei."
"Pah, Weißer Sonntag, was schert das uns, wir sind doch keine Kinder mehr, und ich denke, über so etwas sind wir längst hinaus", sprach der alte Sänger mit einem spöttischen Seitenblick auf Sepp. Siedend heiß wurde es diesem bei diesen Worten ums Herz, denn er dachte an sein Kind, das er zärtlich liebte, dann griff er schnell, um seine Erregung zu verbergen, nach den Karten und spielte. Aber das Glück war ihm heute nicht günstig. Eine Mark nach der andern ging verloren und Stunde auf Stunde verrann. So, jetzt kamen die letzten 5 Mark, für die er seinem Kind eine Kerze und sonst noch einige Kleinigkeiten hätte kaufen müssen. Sollte er auch diese noch verspielen? Sein ganzes Innere bäumte sich dagegen auf, doch der Spielteufel hatte ihn erfasst, "du wirst doch nicht immer verlieren, einmal musst du auch gewinnen", und er spielt weiter bis tief in die Nacht hinein.
Unterdessen saß seine Frau mit ihrem Kind zu Hause und ordnete, was noch zu ordnen war, dabei schaute sie alle Augenblicke erwartungsvoll zum Fenster hinaus, ob sich denn der Vater noch nirgends blicken ließe und die Kerze brächte, die er im benachbarten Laden hatte kaufen sollen. Eine unbeschreibliche Angst beschlich die etwas blasse Frau, als die Uhr bereits die sechste Stunde verkündete und ihr Mann immer noch nicht da war. Sie kannte ihn und wusste, was es zu bedeuten hatte, wenn er nicht rechtzeitig zu Hause war.
"Komm, Marie, geh du einmal hinüber nach Sängers und frag, ob dein Vater noch nicht dagewesen wäre und eine Kommunion-Kerze bestellt hätte." Schnell eilte das Kind hinab und trat schüchtern in den Laden, wo Frau Sänger mit ihren Mädchen die Kauflustigen befriedigte, die sich heute in ziemlicher Anzahl eingestellt hatten.
"Nun, Marie", fragte die Frau freundlich, "was möchtest du denn heute haben?" "Ach", erwiderte die Kleine errötend, "ich möchte bloß einmal anfragen, ob mein Vater für mich noch keine Kerze bestellt hat."
Frau Sänger überlegte eine Weile, dann sagte sie: "Nein, Kind, ist mir nichts von bekannt, wird aber auch die höchste Zeit, ist denn dein Vater noch nicht zu Hause?"
"Nein", und eine Träne rollte über die zarten Wangen des Kindes, "er ist schon den ganzen Mittag fort und er hat das ganze Geld bei sich."
Arme Berta, dachte die Frau bei sich, dir geht es nicht besser wie mir, auch mein Mann sitzt den ganzen Tag in der Wirtschaft und verprasst den geringen Verdienst, den ich mühsam durch das kleine Geschäft erziele, und dabei blickte sie mitleidsvoll auf die kleine Marie. Weich wurde es ihr ums Herz, denn sie dachte an ihre Kleine, die sie vergangenes Frühjahr hinausgetragen hat auf den Friedhof, und die morgen auch mit zur ersten heiligen Kommunion hätte gehen müssen.
Warte, Marie", sprach sie dann, "ich will dir eine Kerze schenken und auch einen Kranz dazu, wie ihn wenige Kinder morgen haben werden", damit ging sie ans Schaufenster und nahm die schönste Kerze heraus, die darin stand, umwunden mit einem prächtigen Veilchenkranz. Sie drückte dem Mädchen die Kerze in die Hand mit den Worten: "So, mein Kind, jetzt hast du auch eine Kerze und brauchst dir weiter keine Sorgen mehr zu machen, aber um das eine bitte ich dich, gedenke morgen in deinem Gebet auch meiner und meines Mannes."
Dankbar schaute das Kind seiner Wohltäterin in die Augen, dann drückte es einen heißen Kuss auf ihre Hand und mit einem tausendfachen "Vergelt`s Gott" auf den Lippen eilte es freudestrahlend hinüber zur Mutter.
Den dankbaren Blick des kleinen Mädchens konnte Frau Sänger den ganzen Abend nicht vergessen, und als sie allein in ihrem Zimmer saß, musste sie immer wieder an die kleine Marie denken, die sie mit einem so geringen Geschenk so reich beglückt hatte. Ja, wie leicht kann man sich doch die Liebe und das Vertrauen eines Kindes erwerben. Sicher würde die Kleine morgen für sie beten und auch für ihren Mann, der soeben lärmend die Treppe heraufkam.
"Ha, haben ihn geleimt, den Sepp, gründlich geleimt", polterte er beim Eintreten heraus, "keinen Groschen hat er mehr, und morgen ist Weißer Sonntag, hat er gesagt, und sein Kind hätte noch keine Kerze."
"Was, wen?" fuhr seine Frau erschrocken auf und eine Blutwelle schoss ihr ins Antlitz, "dem Sepp habt ihr das ganze Geld abgenommen?"
"Nicht abgenommen, nein, gewonnen haben wir`s, und ich habe es in der Tasche", damit zog er seinen Beutel hervor und warf ihn klirrend auf den Tisch.
Ein unsagbar trauriger Blick traf den Halbbetrunkenen, dann griff sie nach dem Sündengeld, um sich von der Wahrheit des Gesagten zu überzeugen. Ein tiefer Seufzer aus ihrer gequälten Brust besagte, dass es wahr sei, was ihr Mann gesagt hatte. Tief gekränkt stieß sie das Geld von sich, womit ihr Mann zugleich den Frieden einer armen Familie geraubt hatte; dann überzählte sie ihre kleine Barschaft, die sie in der Woche erübrigt hatte. Es waren nur wenige Mark; aber sie waren ehrlich verdient, und das war ihr Trost an diesem Abend.
* * *
Golden strahlte am anderen Morgen die Frühlingssonne in das Schlafzimmer des Müller-Sepp und lautes Glockengeläut weckte ihn aus seinem langen Schlaf. - "8 Uhr schon", fuhr er erschrocken empor, "wie konnte ich nur so lange schlafen und warum hat mich meine Frau nicht geweckt?" Schnell sprang er aus dem Bett und während er sich hastig ankleidete, kam ihm auch das gestern Geschehene wieder zum Bewusstsein. Nun ja, spät heimgekehrt, dazu noch betrunken, da war es leicht möglich, dass er das zaghafte Klopfen seines Kindes überhört hatte.
Nun aber schleunigst zur Kirche, er wollte doch wenigstens das Versprechen halten, das er seinem Kind gegeben hatte.
Dichtgedrängt standen sie da, Mensch an Mensch, Arme und Reiche, und aller Augen waren auf den Altar gerichtet, an dem ein Greis im Silberhaar das heilige Opfer begann. Dann rauschte die Orgel und der Gesang der Gläubigen drang empor zu dem Allmächtigen, der dort im Tabernakel, mitten unter seinen Kindern wohnt.
Teilnahmslos lehnte sich Sepp an einen Pfeiler und musterte die Menge, die um ihn her sich angesammelt hatte. - Plötzlich fiel sein Blick auf den alten Sänger, der ihm gestern sein ganzes Geld abgenommen hatte. Gestern hatte er doch den ganzen Mittag geschimpft über Kirchengehen und Weißen Sonntag und heute? War es bloße Neugier, die ihn auch wieder einmal hierhergetrieben hatte, oder was war es sonst? Dann regte sich wieder der Groll gegen jenen Mann, der ihn gestern zum Spiel verleitet und mit schuld an dem Unglück war, das er über seine Familie gebracht hatte. Was mussten Frau und Kind von ihm halten, denen er durch sein Handeln diesen schönen Tag, auf den sie sich so lange gefreut, so sehr verbittert hatte, und woher hatten sie das Geld für die Kerze genommen, die sein Kind doch notwendig haben musste? Dabei schaute er unwillkürlich empor, über die Menge hinweg zu den Mädchen, die in weißen Kleidern dort vor der Kommunionbank knieten, und sein Blick fiel auf seine Marie, die in ihrem schlichten Kleid so fromm und andächtig da kniete, und hinter ihr stand des Nachbars Tochter und hielt das Licht, das seiner Marie gehören musste. Es war die schönste Kerze in der ganzen Kirche und die war gewiss teuer, sehr teuer. Und jetzt fiel es ihm ein, es musste die Kerze sein, die er gestern bei Sängers im Schaufenster gesehen hatte und von allen Vorübergehenden bewundert worden war. Doch wie war sein Kind zu dieser Kerze gekommen? Plötzlich fuhr ihm ein Gedanke durch den Kopf. Sollte vielleicht die Frau seines Feindes, die er als eine mitleidige und gutherzige Frau kannte, seinem Kind die Kerze geschenkt haben? Wieder schaute er hinüber zu der starken Männergestalt, die sich soeben niederkniete, denn das Glöcklein gab das Zeichen zur Wandlung, und neben dem Mann sah er die abgezehrten Züge seiner Frau, die Augen andächtig zum Altar gerichtet. Auch Sepp sank bei diesem Anblick in die Knie und klopfte beim dreimaligen Läuten des Glöckleins an seine Brust und sprach mehr mechanisch als andächtig: "Gott sei mir armen Sünder gnädig."
Feierliche Stille herrschte jetzt in den weiten Hallen des Gotteshauses, so dass man deutlich das Beten des Priesters und das Knistern der Kerzen vor der Kommunionbank vernehmen konnte. Leise und schüchtern klang eine zarte Mädchenstimme durch das Heiligtum, die aber nach und nach immer kräftiger und klarer wurde. Es war die kleine Marie, die die Kommuniongebete vorbeten musste.
Sepp war bei dem bekannten Klang der Stimme seines Kindes emporgefahren und lauschte aufmerksam den Worten, die andächtig von den Lippen seines Kindes erklangen und von den übrigen Kindern nachgebetet wurden. Wie schön und andächtig doch sein Kind beten konnte, und er, der Vater, ob er wohl auch noch beten konnte? Lange hatte er nicht mehr gebetet, ja er musste sich erst besinnen, wann er wohl das letzte Mal andächtig gebetet hatte. Und er dachte zurück, zurück an seine Kindheit, wo auch er fleißig gebetet und fast täglich seine halberblindete Mutter hierher zur Kirche geführt hatte. Ja, damals konnte er noch beten und hatte sich dabei glücklich gefühlt.
Wieder ertönte die wohlklingende Stimme seines Kindes und übermannt von Freude und Rührung sank der alte Müller-Sepp in die Knie und betete leise, aber andächtig nach, was sein Kind vorbetete; und als dann sein Kind mit den übrigen hintrat vor den Altar, um den zu empfangen, nach dem sie sich schon so lange gesehnt hatte, da fühlte auch er ein leises Sehnen in sich nach dieser Himmelsspeise, die alle erquickt, die sie genießen. Ja, auch er wollte sich wieder aussöhnen mit seinem Gott, wollte im Frieden mit sich und seiner Familie leben und ein ganz anderer Mensch werden. Mit diesem festen Entschluss trat er aus der Kirche und traf gerade mit dem alten Sänger zusammen, dem er vorhin noch so sehr gegrollt hatte. Doch jetzt fühlte er nichts mehr von dem Hass gegen diesen Mann, und freundlich grüßend wollte er vorbeigehen.
"Halt, lieber Freund", redete der ihn aber an, "so schnell geht das nicht, ich habe mit dir noch ein Wörtchen zu reden oder, um mich besser auszudrücken, ich habe an dir noch etwas gut zu machen. Hier ist das Geld, das ich dir gestern abgenommen habe und das du sauer und ehrlich verdient hast. Nimm es nur, es gehört dir, ich habe falsch gespielt und wollte mich an deiner Verlegenheit weiden, aber heute ist das anders; das Gebet deines Kindes hat mich zu sehr ergriffen, als dass ich länger mit dir in Hass und Feindschaft leben könnte. Komm, reich mir die Hand, und vergib, was ich dir getan habe."
Überrascht blickte Sepp den Kaufmann eine Weile schweigend an und wollte es gar nicht glauben, bis er das blinkende Geld in seiner Hand hielt, dann reichte er ihm bewegt die Hand und sprach:
"Werner, unauslöschlich wird dieser Weiße Sonntag meinem Gedächtnis eingeprägt sein, er, der meinem Leben eine ganz andere Richtung gegeben hat, und ich hoffe, dass mir Gott die Gnade verleiht, ihn noch recht oft in Friede und Freude feiern zu können."
"Auch für mich", entgegnete Werner, "wird er nicht ganz bedeutungslos bleiben, denn ich habe erkannt, dass es doch noch andere, höhere Güter gibt als die, die ich bisher angestrebt habe, und dass nur sie uns wahres Glück und wahren Frieden bieten können."
________________________________________________________________________

6. Das blinde Kommunionkind - Von Elsbeth Düker
In der Blindenanstalt, die vor dem Tor der Stadt lag, befand sich auch ein kleines katholisches Mädchen, das den Namen Cäcilia in der Taufe erhalten hatte. Da es zum Weißen Sonntag in der Stadtkirche zur ersten heiligen Kommunion gehen sollte, denn es war bereits zwölf Jahre alt geworden, musste es jede Woche zwei Mal in die Schule gebracht werden, um dem gemeinsamen Kommunionunterricht beizuwohnen. Alle Stadtkinder, die im großen Saal der Bürgerschule versammelt waren, schauten mitleidig auf das kleine, blasse Mädchen, wenn es an der Hand einer Anstaltsdienerin eintrat und später wieder abgeholt wurde. Jedes Kind hätte ihm gern etwas Liebes gesagt, etwas Gutes geschenkt, um einmal den Schein der Freude auf das stille Gesicht zu zaubern. Die Kleine schien unverwandt hinzuhorchen auf die Lehren und Worte des Herrn Pfarrers, der so mild und ernst, wie der göttliche Kinderfreund selbst, zu der jugendlichen Schar sprach, bemüht, ihre Seelen himmelwärts zu lenken. Wie ein verdurstendes Blümchen, das zur rechten Zeit noch durch eine gütige Hand mit Wasser versorgt wird, so ähnlich erging es Cäcilia, die nur spärlichen Religionsunterricht genossen hatte und jetzt in der seligen Vorbereitungszeit auf die erste heilige Kommunion die Flügel ihrer Seele ausbreitete, so weit - als flöge sie nach Haus in das Heimatland der Seele. Cäcilia lernte außerordentlich leicht und wusste jedes Mal eine gute Antwort auf die Frage des Herrn Pfarrers. Nichts Äußeres hielt sie ab, auf den Gegenstand ihres Unterrichtes ihre Aufmerksamkeit zu richten, wie das ja so oft der Fall ist bei den Kindern, denen der liebe Gott zwei sehende Augen mit auf die Welt gegeben hat. Oft stellte der Herr Pfarrer Cäcilia als Muster des Fleißes und der Aufmerksamkeit hin. So rückte der Tag der Erstkommunion heran. Wohl keines der Kinder hatte eine größere Sehnsucht, den göttlichen Heiland bald in dem allerheiligsten Sakrament zu empfangen; es war ja derselbe Herr, der einst so gütig zu einem armen Blinden gewesen war, dass er ihn sehend machte. Das wusste Cäcilia aus der Biblischen Geschichte, die sie schon bei ihrem Mütterchen daheim gelernt hatte. Nun war sie auch schon seit zwei Jahren tot, wie der Vater, den sie gar nicht gekannt hatte.
Der Tag der Generalbeichte war vorüber. Wie schlicht und einfach und doch so voll Reuegefühl hatte Cäcilia ihre Fehler vom ganzen früheren Leben gebeichtet. Keine Ängstlichkeit brachte ihre Seele in Aufruhr und ihr stilles Gemüt um den Frieden. Mit keinem der Kinder war sie ja "böse", so dass sie sich nun versöhnen musste, ehe sie zum Tisch des Herrn ging; kein unrechtes Gut musste zurückerstattet werden, denn sie besaß keins. Auch mit der Ausstattung des Körpers hatte Cäcilia nichts zu schaffen und wenig im Sinn, denn sie sah ja nichts von all den irdischen Dingen, die andere Mädchen so gerne abhalten wollen, ihre Gedanken ganz dem göttlichen Gast und der Ausschmückung der Seele, die ihn aufnehmen soll, zuzuwenden.
Der ereignisvollste der Kindheit brach auch für Cäcilia heran. Von den Türmen der Stadtkirche klang der Glockenton so hell und freudig, als gäbe er der Freude Ausdruck, die in so vielen Kinderherzen heute brannte. Cäcilia war die glücklichste in der großen Blindenanstalt; kaum konnte sie erwarten, bis man ihr half, das weiße Kleidchen anzulegen. Vor ihrem Bettchen kniete Cäcilia lange und betete und lud im Geist ihre seligen Eltern ein, sie zum Tisch des Herrn zu begleiten. Endlich rief man sie, um sie zur Kirche zu führen. Alle Anwesenden, die es sahen, wurden tiefgerührt durch den Anblick dieses kleinen, blinden Mädchens, das so andächtig betete, ohne ein Goldschnitt-Gebetbuch zu bedürfen. Wie ein betender Engel verharrte die Kleine, ihre Hände über der Brust gekreuzt, die lichtlosen Augen wie in freudigem Schauen nach oben gerichtet. Wie der geheilte Blindgeborene einst vertrauensvoll sprach: "Herr, ich glaube", so drückte Cäciliens ganzes Wesen und Verhalten diesen Glauben aus. Nun legte sie im andächtigsten Gebet alle kleinen Anliegen ihrem lieben Herrn ans Herz. Nicht flehte Cäcilia, dass sie sehend werden möchte, dass die dunkle Blindheit, die ihr auf beiden Augen geruht hatte, seit dem ersten Tag, fallen möchte, nein, das Kind hielt sich nicht würdig eines solchen Wunders. Es hatte durch Gottes Gnade in seinem jungen Leben schon erkannt, dass "denen, die Gott lieben", alle Dinge zum Besten gereichen müssten. Ob blind oder sehend, alle können wir zur Anschauung Gottes gelangen, wenn wir ihn hier geliebt, das heißt: seinen Willen getan haben. Cäcilia bewahrte die heilige Sammlung am besten, dazu halfen ihr die armen, blinden Augen. Einige blinde Erwachsene der Anstalt, die auch katholisch waren, sonnten sich an der reinen Freude des Kindes und beschlossen, recht bald einmal wieder die heilige Kommunion zu empfangen, damit sie dort Kraft und Freudigkeit sich holten, das Leben mit seiner harten Bürde weiter zu tragen.
Am Nachmittag ging Cäcilia allein im weiten Garten der Blindenanstalt umher, denn sie wusste dort jeden Weg und Schritt. Warm schien die österliche Sonne hernieder und lockte die Veilchen aus ihrer Verborgenheit. Ein verstecktes Plätzchen suchte sich Cäcilia, um ein wenig auszuruhen von den Anstrengungen des Tages, denn - sie fühlte sich so matt und angegriffen, während das Glück des Morgens noch nachhallte in ihrem dankbaren Herzen.
Als nach einer Stunde Cäcilia noch nicht zurückgekommen war ins Haus, wurde nach ihr im Garten umhergeschickt. Dort schimmerte schon das weiße Kleid durch die Büsche. Wohl saß Cäcilia noch auf der Bank, doch die Botin des Hauses fand eine kleine Leiche. Der Kopf, auf dem der frische Myrtenkranz saß, hing sanft zur Seite: ein Herzschlag hatte dem Leben der kleinen Blinden unversehens ein Ende gemacht. Der liebe Gott hatte sein blindes Lieblingskind zu sich genommen, gerade an dem Tag, wo es ihn in der heiligen Kommunion zum ersten Mal empfangen hatte. Ein armes, mühseliges und freudloses Leben, das Cäcilia so willig auf sich zu nehmen ihrem göttlichen Gast versprochen hatte, war ihr nun erspart; mit dem guten Willen war hier der liebe Gott zufrieden gewesen. Das gab ein lautes Klagen, ein Weinen und Trauern im ganzen Haus, und selbst die Stadt nahm Anteil an dem frühen Hinscheiden der kleinen Blinden.
Als wenn sie schliefe, so still und friedlich lag Cäcilia im Sarg mit demselben Kleid und Kranz, den sie vor einigen Stunden trug, als sie ihre Erstkommunion feierte. Die geschmückte Kerze, die ihr damals geleuchtet hatte, brannte heute wieder; ihr Schein fiel auf die geschlossenen Augen, die niemals das Licht der Welt erblickt hatten. Auf der kleinen, treuen Brust lag das Kommunionandenken des Pfarrers, ein Bild mit Namensunterschrift; die kalten Hände umwand ein Rosenkranz - das Gebetbuch der blinden Leute.
Jetzt waren Cäciliens Augen nicht mehr blind, denn sie sahen wohl den Himmel und seine Herrlichkeit.
Keines der Kommunionkinder fehlte, als die kleine Cäcilia in den Schoß der Erde versenkt wurde, denn jedes hatte die arme Blinde lieb gehabt. Auf dem Kirchhof angelangt, hielt der Herr Pfarrer, den oftmals die Rührung zu überwältigen drohte, eine ergreifende Rede, die ganz besonders auf die Kinder, die Gefährten Cäcilias, einen unauslöschlichen Eindruck machte. "Seid bereit, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt", lautete der Vorspruch der Rede.
Und als nach vier Wochen alle Kommunionkinder sich zur gemeinsamen Kommunion in der Kirche einfanden, war wohl keins dabei, das nicht ihrer kleinen Mitkommunikantin im Gebet gedacht hätte; auf ihrem Platz brannte ein Licht zu ihrem Gedächtnis. Mit den besten Vorsätzen traten alle übrigen Kinder die Reise ins Leben an.
________________________________________________________________________

7. Am Tisch des Herrn - Von Stephardt
"Anna, komm her zu mir; ich muss dich etwas fragen."
Die so von ihrer Mutter Angeredete war ein Mädchen im Alter von ungefähr zwölf Jahren. Blonde Locken umspielten ihr rosiges Gesichtchen, aus dem zwei blaue Augen sorglos und lebensfroh in die Welt blickten.
Das Mädchen stand auf und eilte nach dem anstoßenden Zimmer zur Mutter, die dort am Nähtisch saß und mit einer feinen Stickerei beschäftigt war.
"Da bin ich, Mama. Was willst du mich fragen? Ob ich heute schon gelernt habe?"
"Das auch. Aber zuvor möchte ich etwas anderes wissen. Hat dir die kleine Berta, die Portierstochter, vorhin ein Sträußchen Blumen gebracht?"
Anna wurde rot und blickte verlegen zu Boden. "Blumen?" brachte sie dann stotternd über die Lippen.
"Ja. Blumen. Wo hast du den Strauß hingetan? Hast du ihn drin in deinem Zimmer?"
"Nein, Mamma, ich habe ihn nicht im Zimmer."
"Nicht? Hast du ihn dann vielleicht draußen auf dem Gang neben das Öllämpchen vor das Muttergottesbild gestellt?"
"Nein, das auch nicht, Mama."
"Auch nicht? Wo hast du die Blumen denn hingetan?"
In die blauen Augen des blonden Mädchens schlich sich eine helle Träne und unterdrücktes Schluchzen hemmte seine Stimme, als es begann: "Ich . . . ich . . . habe . . . die . . . Blumen . . . gar . . . nicht . . . genommen."
"Du hast sie nicht genommen? Ei, dann habe ich doch recht gehört, dann habe ich mich nicht getäuscht, als ich meinte, es sei deine Stimme, die draußen zu der armen Berta, die ich mit einem Blumenstrauß aus der Wohnung kommen sah, sagte: "Behalte deine Blumen nur und wirf sie meinetwegen auf den Düngerhaufen, oder mach damit, was du willst; ich mag sie nicht." Sag`, Anna, warst du es, die so sprach?"
Die Gefragte schwieg.
"Dein Schweigen sagt mir, dass ich recht habe" fuhr die Mutter fort, "dass du diese harten Worte wirklich gesagt hast. O Kind, das macht mich sehr traurig. So sprichst du, ich möchte fast sagen, am Vorabend deiner ersten heiligen Kommunion? Du betest doch täglich, der liebe Heiland möge dich recht demütig machen. Er möge dein Herz nach seinem heiligsten Herzen bilden, das sanftmütig und demütig war, und nun?"
Anna konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Laut aufschluchzend bat sie: "Mama, ich habe es nicht bös gemeint. Bitte, bitte, verzeihe mir und zürne mir nicht."
"Gewiss will ich dir verzeihen, mein Kind. Aber meine Verzeihung allein genügt doch nicht. Verzeiht dir wohl auch der liebe Gott? Schau, das Kind wollte dir eine Freude machen. Es hatte nichts Schöneres, nichts Besseres als die schlichten Blümchen, die es vielleicht mit vieler Mühe für dich draußen im Feld gesammelt hatte. In den Augen des armen Kindes waren diese Blumen das Schönste, was es dir geben konnte. Du aber wiesest die Gaben mit harten, stolzen und geringschätzenden Worten zurück. Dadurch hast du dem Kind gewiss sehr weh getan. Siehst du das ein?"
"Ja, Mama, ich sehe es ein. Es war böse von mir."
"Ja, es war böse von dir gehandelt, mein Kind. Mir selbst ging es wie ein Stich durchs Herz, als ich dich so hart reden hörte, als ich vernahm, wie du mit stolzen Worten das dargebotene Geschenk der armen Berta zurückwiesest. Und du willst doch ein Kommunionkind sein! Ist meine Anna wohl würdig, dachte ich mir, zum Tisch des Herrn zu gehen, wo es keinen Unterschied zwischen arm und reich gibt, wo das arme Kind ebenso willkommen ist wie das reiche, wo wir alle dieselbe Speise, den heiligsten Leib des lieben Heilandes empfangen, wo wir alle ganz gleich sind? Meinst du, mein liebes Kind, dass du mit einem stolzen, lieblosen Herzen in der Brust teilnehmen kannst an jenem himmlischen Gastmahl der Liebe, zu dem wir arme Menschen nichts bringen können, was Jesus angenehm ist, als ein Herz voll Demut und voll Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen? Und als die Zeit begann, wo du anfingest, dich auf deine erste heilige Kommunion vorzubereiten, da habe ich dich als sorgende und teilnehmende Mutter, die ihrem Kind das Liebste und Beste wünscht, hingeführt zum Kruzifix, und habe dir gesagt: "Anna, nimm es mit deiner Vorbereitung recht ernst. Nimm dir auch recht fest vor, vor allem deine Lieblingsfehler auszurotten. Zu diesen gehört dein Stolz, das Meinen, du seist viel mehr wie andere Kinder. Du hast mir versprochen, es zu tun und tüchtig an deiner Besserung zu arbeiten, damit der liebe Heiland bei seiner Einkehr in dein Herz die innigste Freude habe. Hältst du nun so dein Wort, das du mir dort unter dem Kruzifix gegeben hast, wo der liebe Heiland vom Kreuz herabzublicken und dich zu segnen schien, weil du ein braves Kind werden wolltest?"
"Ja, Mama, das will ich; ich will ein braves Kind werden. Ach, wenn du mir nur ins Herz blicken könntest, um zu sehen, wie weh es mir tut, wieder stolz und unfreundlich gewesen zu sein. Glaube es mir doch, dass es mir wirklich leid tut."
"Ich will dir glauben, mein Kind, und ich will hoffen, dass du den festen Vorsatz fasst, es nicht wieder zu tun. Es muss heute wirklich das letzte Mal gewesen sein, dass du anderen gegenüber so unfreundlich und stolz warst. Deine erste heilige Kommunion, auf die du dich vorbereitest, ist der wichtigste Augenblick deines Lebens; denn vom Tisch des Herrn kommst du zurück, entweder im Guten, in der Bescheidenheit, in der Reinheit, in der Frömmigkeit, in den Tugenden überhaupt mehr bestärkt und gefestigt, oder aber im Stolz und in der Verachtung deiner Mitmenschen verhärtet. Denke nur an das letzte Abendmahl des Herrn. Von den zwölf Aposteln, die mit dem göttlichen Heiland zu Tisch saßen und aus seiner Hand ihre erste heilige Kommunion empfingen, wurden elf Apostel nach dem Empfang der heiligen Kommunion besser, reiner und heiliger, während der zwölfte, Judas Iskariot, der mit bösem Herzen am heiligen Mahl teilgenommen hatte, im Bösen verhärtet und ein Verräter seines göttlichen Meisters wurde."
"Mama, ich werde gewiss nicht mehr so böse sein. Ich verspreche es dir noch einmal und ich hoffe, dass ich mit der Gnade Gottes mein Versprechen auch halten werde."
"Gut denn, mein Herzenskind. Behandle niemand mehr verächtlich, weder die kleine Berta, die ein so gutes Kind ist und gleich dir ein Kommunionkind, noch jemand anderes, auch wenn er dir vielleicht weniger gut zu sein scheint. Schmücke dein Herz mit Milde, Liebe und Frömmigkeit, bereite dich diese Tage hindurch noch recht gut vor auf deine erste heilige Kommunion, damit du das Brot der Engel zum Segen für dein ganzes Leben empfängst."
"Ich will es, Mama."
"Und wie willst du nun gut machen, was du vorhin getan hast?"
"Ich will zu Berta gehen und sie um Verzeihung bitten. Darf ich gehen, Mama, und den Portiersleuten einen Besuch machen, um Berta zu treffen und ihr zu sagen, wie leid es mir tut, dass ich vorhin so böse war mit ihr?"
"Ja, Kind, gehe und bitte Berta um Verzeihung. Und sei recht lieb mit dem Mädchen. Ihr geht ja beide zugleich zum Tisch des Herrn. Wie ihr dort vereint seid, so sehe ich euch auch jetzt schon gerne in Liebe und Freundschaft miteinander verbunden. Berta ist zwar ein armes Kind, aber sie ist so gut erzogen und so brav, dass ich nichts dagegen hätte, wenn ihr Freundschaft schließen und viel beisammen sein würdet."
Während dieses in der prachtvoll ausgestatteten Herrschaftswohnung gesprochen wurde, fand auch unten im Pförtnerstübchen eine Unterredung zwischen Mutter und Tochter statt. Als Anna die vom Portierstöchterchen dargebotenen Blumen zurückgewiesen hatte, war Berta weinend zu ihrer Mutter geeilt, um ihr unter Tränen zu erzählen, was soeben geschehen war. "Denke, liebe Mutter", berichtete das Mädchen, "Anna hat gesagt, meine Blumen seien gut für den Düngerhaufen, aber für nichts anderes. Dabei hat sie mich angesehen, als hätte ich etwas sehr Böses begangen. Und ich hatte es doch so gut gemeint und ich hatte mir so viel Mühe gegeben, die schönsten Blümchen, die zu finden waren, zu suchen und ihr zu bringen. Es blühen ja noch nicht viele Blumen und so konnte ich auch keine hervorragend schöne finden. Aber wenn ich meine Blümchen zum Altar der lieben Mutter Gottes gestellt hätte, wären sie gewiss nicht zurückgewiesen worden."
"Lass es gut sein, Berta, und sei nicht traurig darüber. Wenn später mehr und schönere Blumen blühen, kannst du ja einen neuen Strauß pflücken und ihn der Anna geben."
"Nein, ich werde keine Blumen mehr pflücken. Anna hat ein hartes, stolzes Herz; ich werde ihr keine Blumen mehr anbieten. Unsere junge Herrin verachtet mich gewiss."
"Das tut sie nicht, Berta. Anna hat auch kein stolzes Herz; sie ist nur vornehm und reich. Du darfst ihr nicht böse sein, weil sie deine Blumen nicht genommen hat. Sie hat jedenfalls aus dem Treibhaus schönere, als du ihr bieten kannst, und so kam es, dass ihr deine nicht mehr so willkommen waren."
"Musste sie deswegen aber sagen, meine Blumen sind für den Düngerhaufen gut genug?"
"Das hat Anna sicher nur gesagt, ohne ihre Worte zu bedenken. Und wenn sie etwas gesagt hat, was vielleicht nicht ganz richtig war, Herzl, so vergiss nicht, dass sie die Tochter unserer gütigen Herrschaft ist, die dem Vater die Stelle gab, durch die er uns das tägliche Brot verdienen kann."
"Ich bin der Anna ja auch nicht böse und ich will ihr gar nicht mehr zürnen. Aber weh hat es mir getan, und wenn ich daran denke, muss ich gleich wieder weinen."
"Bete ein Vaterunser, liebes Kind, dann wird es dir nicht mehr so weh tun. Und dann denke auch an deine erste heilige Kommunion, die du in wenigen Tagen empfangen willst. Opfere alles dem lieben Jesus auf, er wird es dir mit reichen Gnaden vergelten."
"Ja, Mutter, das will ich tun. Der Herr Pfarrer hat uns ja noch gestern im Religionsunterricht gesagt, wir sollten uns freuen, wenn wir dem lieben Jesus etwas aufopfern könnten. Das kann ich nun und ich will es gerne tun. Überhaupt, wenn ich an die erste heilige Kommunion denke, die Anna und ich wie zwei Schwestern am gleichen Tag empfangen werden, dann kann ich unserer jungen Herrin gar nicht mehr zürnen. Ein Kommunionkind will gewiss nichts Böses tun. Ach nein, Anna hat es gewiss nicht böse gemeint; ich war nur sehr empfindlich, als ihre Worte mir so weh taten. Ich will jetzt ein Vaterunser beten für Anna und für mich, damit wir uns auf unsere erste heilige Kommunion gut vorbereiten. Komm, liebe Mutter, komm bete es mit mir. Wir wollen uns vor dem Marienaltärchen niederknien und zusammen beten."
Mutter und Tochter knieten nieder, um zu beten. Sie hatten ihr Vaterunser kaum beendet, als es leise an die Tür klopfte und Anna, von einem Zimmermädchen begleitet, eintrat. Sie ging sofort auf Berta zu, fasste sie bei der Hand und sagte: "Liebe Berta, ich habe dir vor einer Weile recht weh getan. Bitte, sei mir nicht böse und verzeihe mir."
Berta wusste nicht, was sie sagen sollte. "O Fräulein", stotterte sie, "Sie haben mir doch nichts Böses getan."
"Doch, Berta, es war sehr böse von mir gehandelt, als ich vorhin deine Blumen zurückwies. Das war sehr garstig von mir. Und ich bin doch gleich dir ein Kommunionkind. Bitte, verzeihe mir, damit ich mich auf den Tag der ersten heiligen Kommunion ebenso freuen kann wie du."
"Wenn gnädiges Fräulein meinen, mich beleidigt zu haben, so will ich von ganzem Herzen verzeihen." Dabei neigte Berta sich, um dem reichen Mädchen die Hand zu küssen. Doch Anna ließ dies nicht zu, "Was willst du tun?" rief sie. "Höre doch, Berta, was ich dir noch sagen möchte. Schau, wir gehen beide zu gleicher Zeit zur ersten heiligen Kommunion. Dort sind wir ganz gleich, so gleich, als ob wir zwei Schwestern wären. Lass uns darum jetzt schon nicht mehr fremd sein zueinander. Bitte, liebe Berta, sei und bleibe meine beste Freundin."
"Aber das gnädige Fräulein ist so reich und ich bin so arm."
"Macht das etwas? Wir feiern unseren schönsten Lebenstag zusammen, und wie wir dort beim lieben Jesus vereint sind, so wollen wir es jetzt schon sein und dann für unser ganzes Leben bleiben. Willst du, Berta? Bitte, sage ja."
"Wenn ich nicht zu gering bin, gern, von Herzen gern. Ich will immer eine treue, liebe Freundin sein."
"Ich dir desgleichen", rief Anna und schlang ihre Arme innig um die neue Freundin. Dann fuhr sie fort: "Zum Andenken an diesen Tag will ich mir die Blumen mitnehmen, die ich vorhin zurückwies. Sie sollen mich immer an das Versprechen erinnern, das ich heute dem lieben Gott, meiner guten Mama und dir gemacht habe."
Eine Weile plauderten die beiden Mädchen noch zusammen, dann griff Anna nach den Blumen, die noch auf dem Tisch lagen und verabschiedete sich mit freundlichen Worten, indem sie die neue Freundin noch einlud, sie recht bald einmal zu besuchen. -
Eine Woche später - es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen - gingen die Kinder zur ersten heiligen Kommunion. Besonders zwei der Erstkommunionkinder lenkten aller Aufmerksamkeit auf sich. Sie waren ganz gleich gekleidet, knieten nebeneinander und zeichneten sich vor allen anderen durch ihre Bescheidenheit und Frömmigkeit aus.
"Sind das zwei Schwestern?" fragten einige Leute, denen die beiden Kinder nicht bekannt waren.
"Nein, nein", lautete die Antwort, "das sind keine Schwestern. Das eine der Mädchen ist die Tochter des vornehmen und reichen Villenbesitzers Dalmet und das andere ist das Kind des in der Villa angestellten Portiers Lengerl."
"Und die Kinder sind gleich gekleidet?"
"Das hat Frau Dalmet auf Bitten ihrer Tochter getan, die mit der kleinen Portierstochter innige Freundschaft geschlossen hat und sie wie eine Schwester liebt." -
Die beiden Mädchen blieben in herzlicher Freundschaft miteinander verbunden. Sie hatten sich in der Vorbereitung auf ihre erste heilige Kommunion gefunden und am Tisch des Herrn fest miteinander vereinigt. Das Band, das sich dort um ihre Herzen geschlungen hat, wurde nie gelockert, und nur der Tod, der Tod am Tisch des Herrn, sollte es für hienieden trennen.
Seit jenem Frühlingstag waren etwa zehn Jahre verflossen. Es war eine finstere, stürmische Aprilnacht. Der Mond leuchtete nicht, kein Sternlein stand am Himmel; nirgends war ein Licht zu sehen, das die Dunkelheit in etwa durchbrochen und einen Weg durch die Finsternis gezeigt hätte. Da blieb wohl jedermann am liebsten zu Hause im trauten Familienkreis, im warmen Zimmer, wo man die Kälte und den Sturm nicht so fühlte und beim ruhigen Lampenlicht die Finsternis vergaß.
Trotz Sturm und Finsternis gingen zwei Frauengestalten einen schmalen Fußweg, der an einem rauschenden Bächlein entlang nach dem Atlantischen Ozean führte. Dem leichten Gang nach mussten die beiden Frauen in der Blüte der Jahre stehen. Die eine der beiden Frauen führte ihre Begleiterin, der der Weg allem Anschein nach noch unbekannt war, mit großer Vorsicht voran, indem sie auf alle Hindernisse aufmerksam machte, die sich entgegenstellen konnten.
"Fräulein Anna", hören wir sie flüstern, "halten wir uns ein wenig mehr nach links, damit die alten Weiden, die ihre Äste und Zweige hier weit über den Weg strecken, ihnen nicht zu oft in das Gesicht schlagen. - Heiligste Jungfrau, welches Dunkel und welch ein Sturm dazu!"
"Nur Mut, liebe Berta. Der liebe Gott sieht uns ja und wird uns glücklich ans Ziel gelangen lassen."
"Ich habe keine Furcht, Fräulein Anna. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich diesen Weg gehe."
"Sind wir sicher auf dem richtigen Weg?"
"Ja, wir sind es."
"Hoch, Berta!"
"Was denn?"
"Hast du das Geräusch nicht vernommen?"
"Nein, ich habe nichts gehört."
"Es kam mir vor, als hätte ich da drüben Stimmen gehört und als hätte ich etwas wie blanken Stahl aufblitzen sehen."
"Es wird nichts gewesen sein, als höchstens ein Tier, das in seiner Nachtruhe gestört wurde. Hier haben wir nichts zu fürchten. Wenn uns Gefahr droht, so ist es erst draußen auf dem Meer. Es heißt nämlich, dass die Jakobiner, diese Blutmenschen, die alles Heilige und Ehrwürdige in den Kot getreten haben, mit geschärfter Aufmerksamkeit an der Küste herumfahren, um dort, wenn möglich, Priester und ihrem Glauben treu gebliebene Katholiken gefangen zu nehmen, falls diese sich hinauf aufs Meer begeben sollten, um dort ihre religiösen Pflichten zu erfüllen, nachdem es ihnen auf dem Festland unmöglich gemacht wurde."
"Würden wir es teuer büßen müssen. Gefangenschaft und Tod wären unser Anteil."
"Wenn man uns auch entdeckte, Berta, was wäre das Schreckliches? Ich denke jetzt so oft an die Märtyrer der ersten christlichen Jahrhunderte. Die Zeit ist wieder gekommen, wo wir dem lieben Heiland unsere Liebe dadurch bezeigen können, dass wir bereit sind, für ihn unser Leben dahinzugeben. Ach, Berta, es sind schreckliche Zeiten, in denen wir leben! Die Altäre verwüstet, die Kirchen geschlossen, die Priester wie wilde Tiere durch die Wälder gejagt."
"Ja, es ist schrecklich. Blut und Verbrechen bezeichnen die Wege, auf denen dieser Robespierre und seine Genossen einhergehen. Doch Gott hat uns die Gnade gegeben, dass wir unserem heiligen Glauben treu geblieben sind, und ich bete alle Tage darum, dass er uns auch für die Zukunft diese Gnade gebe."
"Auch ich bete darum und ich hoffe, dass wir nicht vergebens bitten. Und in dieser Nacht dürfen wir wieder zusammen zur heiligen Kommunion gehen. O, wie freue ich mich darauf. Es ist und bleibt doch wahr: Christi Blut gibt Christi Mut. Sooft mir etwas schwer fallen will, denke ich an unsere erste heilige Kommunion, und alles wird mir wieder leicht. Und wie danke ich dem lieben Gott, dass er mich dich damals finden ließ. Erinnerst auch du dich noch daran, wie wir Freundinnen wurden?"
"Ja, ich denke gerne an unsere erste heilige Kommunion."
"Die Blumen, die du mir damals gegeben hast, habe ich heute noch und gehören zu meinen liebsten Gegenständen, deren Besitz mir lieb und teuer ist."
Jeder hat nun diese Mädchen wiedererkannt, die einst kurz vor ihrer ersten heiligen Kommunion Freundschaft miteinander geschlossen und diese treu gehalten hatten bis auf den heutigen Tag, wo wir sie durch die stürmische Nacht wandern sehen, um an verborgenem Ort der heiligen Messe beizuwohnen und die heilige Kommunion zu empfangen. Es war zur Zeit, da gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Frankreich die traurige Revolution mit all ihren Schrecken und Gräueln wütete.
"Sind wir bald am Ziel?"
"Ja, bald."
Ein Geräusch wie das Atmen eines ungeheuren Riesen wurde immer deutlicher.
"Das ist das Meer", sagte Berta, "nun sind wir gleich am Ziel. Da unten wohnt Albert, der Fischer, in dessen Hütte wir uns heute Nacht versammeln."
Wirklich tauchte gleich darauf vor den Augen der beiden Mädchen eine Hütte auf, durch deren eines Fenster ein ganz schmaler gedämpfter Lichtstreifen fiel. Berta näherte sich der Hütte und klopfte fünf Mal immer leiser an die Tür.
Von drinnen waren Schritte zu hören und eine weibliche Stimme sagte: "Pax."
"Christi", entgegnete Berta.
Gleich darauf wurde der Riegel zurückgeschoben, die Tür öffnete sich und die beiden Mädchen konnten eintreten. Es war ein einfaches, niedriges Zimmer, an dessen Wänden Netze und sonstige Fischergeräte hingen. Nicht das geringste ließ erkennen, dass während der französischen Revolution hier ein Versammlungsort der treu gebliebenen Katholiken war. Hinter dem Wohnzimmer war ein zweiter Raum, zu dem man den Eingang kaum sah, da er kunstvoll mit Netzen und Fischergeräten verhangen war. Die Frau des Fischers öffnete die Tür und ließ die Mädchen dort eintreten. In dem Raum waren etwa dreißig Personen versammelt, Männer und Frauen, die auf einfachen Bänken saßen. Manche hatten ein Gebetbuch in der Hand, andere den Rosenkranz, alle beteten und bereiteten sich vor auf den Empfang der heiligen Sakramente. Ein Greis im Silberhaar schien die Ordnung aufrecht zu halten. Er trat auf die beiden Mädchen zu, grüßte freundlich und wies ihnen dann ihren Platz an. "Ist Vater Laurent, der Priester, noch nicht gekommen?" fragte Berta.
"Nein", entgegnete der Greis, "er ist noch nicht da. Albert ist ihm entgegengegangen und ich hoffe, sie werden bald hier sein."
"Wenn sie sich in dieser dunklen Nacht nur nicht verirren", sagte Anna.
"Das denke ich nicht", erwiderte der Greis. "Albert kennt jeden Fuß Landes, er hat ja sein ganzes Leben hier zugebracht."
"Aber Vater Laurent?"
"Ist schön öfters hier gewesen und hat als Fischer verkleidet bei hellem Tageslicht die Gegend wiederholt durchsucht, um sich bei Nacht zurechtzufinden. Gottes Engel wird sie schützen und bald in unserer Mitte sein lassen."
Eine Weile herrschte wieder vollkommene Stille, so dass man jedes Geräusch von draußen vernehmen konnte.
"Ich glaube, jetzt kommen sie", sagte auf einmal ein junger Mann, der dem Eingang am nächsten war.
Gleich darauf öffnete sich die Tür und im Eingang stand ein Greis, dem das silberweiße Haar wie ein Heiligenschein um die Stirn lag und in dessen milden Gesichtszügen das Lächeln und die Freude des guten Hirten zu sehen war, der zu seinen Schäflein kommt.
"Vater Laurent", flüsterte Berta ihrer Begleiterin zu. "Das ist der Priester, der von Todesgefahren rings umgeben hier bei uns blieb, damit wir des Trostes der heiligen Sakramente und des heiligen Messopfers nicht gänzlich beraubt wären. Fünf Mal schon waren die Häscher auf seiner Spur und hätten ihn fast gefangen genommen; aber immer noch gelang es ihm, sich ihren Nachstellungen wie durch ein Wunder zu entziehen."
Anna, die zum ersten Mal in dieser Versammlung war, blickte mit Ehrfurcht auf den Priestergreis. Sie las Liebe und Sorge in seinen Zügen, aber keine Furcht. Sein Blick schien allen Kraft, Mut und Begeisterung zu geben. Das war wohl der Blick der ersten Glaubensboten, der zu sagen schien: "Wer sein irdisches Leben für Gott im Bekenntnis des wahren Glaubens hingibt, wird das ewige Leben erlangen." Das Auge des Priesters leuchtete so froh wie in jenen Tagen, da er in festlich geschmückter Kirche, umgeben von Orgelton und Weihrauchwolken das feierliche Gloria anstimmte.
Nun empfingen alle das heilige Bußsakrament. Einer nach dem anderen trat hin, um sich nach demütigem Sündenbekenntnis die Lossprechung von seinen im Bußgericht bekannten Fehlern und Schwächen zu holen. Als dann alle gebeichtet hatten, erhob sich der Priester und fragte, ob alle, die von der heutigen Feier Nachricht bekommen hatten, da sind, oder ob man noch warten soll.
"Sie sind alle hier", entgegnete der Fischer.
"Nun denn, so lasst uns gehen."
Eine Seitentür wurde geöffnet und alle Anwesenden traten stillschweigend hinaus in die schweigende Nacht. Von der Fischerhütte aus begab man sich dann in zwei Abteilungen auf verschiedenen Wegen nach einer kleinen Einbuchtung, wo vom Gebüsch ziemlich versteckt eine geräumige Fischerbarke lag. Alle stiegen ein, als letzter der greise Priester, der dann sofort die heiligen Gewänder anlegte, um auf dem Meer das heilige Opfer darzubringen. Die Segel wurden aufgezogen, der Wind schwellte sie und führte die Barke hinaus auf die hohe See. Der Sturm war schwächer geworden, es schien, als wolle er sich ausruhen oder als dürfe er nicht mehr wüten.
Es war ein feierliches Schauspiel, als in der Barke nun der kleine Altar aufgerichtet wurde, auf dem bald das Lamm Gottes ruhen sollte, Jesus Christus, unsere Seelenspeise, die Stärke der Schwachen; es erfüllte alle, wie von selbst, mit Andacht, als der Priester jetzt das heilige Opfer begann.
Anna und Berta knieten nebeneinander, wie sie einst am Tag ihrer ersten heiligen Kommunion gekniet hatten, und bereiteten sich auf die Einkehr des himmlischen Gastes vor. Sie erinnerten sich dabei wohl auch an jenen schönen Tag, da sie im geschmückten Gotteshaus gekniet hatten, um Engeln gleich sich zum ersten Mal dem Tisch des Herrn zu nahen. Auch heute gingen sie wieder wie damals zusammen zum Tisch des Herrn. Damals war es im prächtigen Gotteshaus gewesen, jetzt in einer armen Barke, mit der die Wellen ihr Spiel trieben; aber dort wie hier war es derselbe himmlische Gast, der sich selbst ihnen geben wollte, der sie mit seinen Gnadenschätzen erwartete.
Die heilige Messe begann, die heilige Wandlung kam, der Augenblick der heiligen Kommunion kam näher. Alle traten hinzu, um den Leib des Herrn, die Speise zum ewigen Leben zu empfangen. Anna und Berta waren die letzten, die sich dem Tisch des Herrn nahten. "Der Leib unseres Herrn Jesu Christi bewahre deine Seele zum ewigen Leben", wiederholte der Priester und reichte den Seite an Seite Knienden die himmlische Seelenspeise. Eben wollten die beiden Mädchen, Friede, Ruhe und Glück im Herzen, sich erheben, um an ihren Platz zurückzukehren, als Albert, der Fischer, plötzlich rief: "Die Lichter aus. Ich höre Geräusche: wir sind entdeckt und werden jedenfalls verfolgt." Schrecken bemächtigte sich aller, die im Fischerboot waren und diese Worte hörten. Nur der Priester blieb ruhig. Er löschte selbst die Lichter aus und wollte dann in der heiligen Handlung fortfahren.
Da blitzte es von der Seite herüber, ein Schuss krachte und mit Blitzesschnelle umklammerte Berta, die mit Anna noch in der Nähe des kleinen Altares war, den Arm ihrer Freundin.
"Was hast du?" schrie sie erschreckt auf.
"Ich bin getroffen", entgegnete Berta leise.
"Wohin getroffen?"
"In die Brust. Ich sterbe. Gott sei Dank, dass ich noch bei der heiligen Kommunion war, mit dir zugleich am Tisch des Herrn. Es war heute so schön wie damals am Tag - unserer - ersten - heiligen - Kommunion. Auf - Wiedersehen - im - Himmel. - Lebe - - "
Die Kugel hatte wirklich die Brust des Mädchens durchbohrt und alle Versuche, das junge Leben zu retten, waren vergeblich. Schon nach wenigen Minuten war Berta eine Leiche.
Die Finsternis rettete die Fischerbarke aus den Händen der Verfolger, und als der Morgen im fernen Osten graute, war Albert, der jeden Winkel der Küste genau kannte, an einem sicheren Plätzchen gelandet. Dort am Ufer fand auch die Leiche des Mädchens in einem vom Priester gesegneten Grab ihre vorläufige Ruhestätte.
Als dann die Stürme der Revolution vorüber waren und über Frankreich wieder der Friedensengel schwebte, ließ Anna die Gebeine ihrer toten Freundin ausheben und in einem schöneren Grab auf dem katholischen Friedhof ihres Heimatstädtchens beisetzen. Auf das Grab aber kam ein kostbarer Marmorstein, der auf der vorderen Seite den Namen und die Todesursache der Verstorbenen enthielt, auf seiner rückwärtigen Seite aber stand: "In treuer Freundschaft und Erinnerung an zwei Tage gesetzt." Darunter war das Datum des Erstkommuniontages angegeben und das, an dem Berta ihren Tod fand. Zuletzt aber stand in großen goldenen Buchstaben:
"Am Tisch des Herrn."
________________________________________________________________________

8. Tiefgesunken in der Sünde - Einer wahren Begebenheit nacherzählt von Er. Krafft
1.
In seiner Malstube zu Rom, wohin er eigens gekommen war, um Modelle, Vorbilder zu suchen für das Gemälde "La cena" (Das letzte Abendmahl Christi), saß der große Meister Leonardo da Vinci - tiefnachdenklich und brütend. Vor ihm stand auf hohem Gestell der Zeichenentwurf für dieses Gemälde; nach Örtlichkeit und Personen völlig geordnet und harrend der näheren Ausführung. Der Skizzierstift in der geschickten Hand des berühmten Künstlers ruhte; ein Seufzer stieg aus seiner Brust empor. Tag und Nacht, Wochen und Monate hatte er Geist und Einbildungssinn zermartert, um eine gänzlich neue, vollwürdige Vorlage für Christi letztes Liebesmahl mit seinen Jüngern zu erfinden und künstlerisch edel darzustellen. Nun war ihm dieser schwerste Wurf in seinem Vorhaben auch gelungen - allein das Werk stockte trotzdem: Leonardo hatte bis jetzt kein Modell, keine sichtbare Vorlage gefunden für die Hauptgestalt seines Gemäldes: für Christus.
Richt- und ratlos war er vom Osten zum Westen, vom Norden zum Süden der "Ewigen Stadt" umhergeirrt, überall spähend, überall seinen hohen Zweck verfolgend - vergebens. Nirgends hatte er gefunden, was er suchte. Wohl waren ihm Hunderte von schönen, edelgeformten Gesichtern aufgestoßen; wohl hatten ihm aus manchen Zügen hoher Sinn und große Vortrefflichkeit in die Augen geleuchtet - aber die rechte Vereinigung von äußerer Schönheit und innerer Hoheit, wie er sie für das Antlitz Jesu benötigte, hatte er vergebens gesucht.
Hastig sprang der Meister von seinem Stuhl auf. Ein Ruck seines feingeschnittenen Kopfes schleuderte die langen Locken, die ihm über Stirn und Schläfen niedergerollt waren, in den Nacken zurück; seine hohe Gestalt reckte sich energisch empor.
"Mut! Nur kein Sinken der Energie!" raffte er sich auf in leisem Selbstgespräch. "Was mir gestern und vorgestern nicht gelang, kann heute wohl gelingen. Also von neuem auf die Suche!"
Er warf seinen wallenden Mantel über die Schultern, drückte das Barett auf die wallenden Locken und schickte sich an, sein Atelier zu verlassen. Vorher aber sandte er noch ein glühendes Gebet zu Christus empor um das Gelingen seines Planes. "Mein Herr und Heiland", flüsterten seine Lippen, "lass mich finden, was ich suche, auf dass ich dein Bild würdig und zur Verehrung zwingend herzustellen vermag!"
Er trat ins Freie. Bald wallte ihm der volle Strom des römischen Menschenlebens entgegen. Wieder spähte und forschte er nach rechts und links, auf Straßen und freien Plätzen nach einem Christuskopf - abermals vergeblich.
Schon bemächtigte sich des Meisters eine gewisse Ermüdung und Missstimmung; schon dachte er an den Heimweg - als sich vor ihm das Portal einer Kirche öffnete und einer Gruppe junger Leute Austritt verlieh. Einer von diesen jungen Männern sprach gerade, und aus seiner Stimme klang dem aufhorchenden Meister ein solch weicher Wohlklang und zugleich eine solche Tiefe und Innigkeit zu Ohren, dass er der Gruppe fast unwillkürlich auf dem Fuß folgte. Der junge Mann sprach mit Wärme und Begeisterung vom kirchlichen Chorgesang. Aus seinen Worten ging hervor, dass er der erste Chorsänger in der eben verlassenen Kirche war.
"Wohlklang und Innigkeit der Stimme", flüsterte der Meister, "Frömmigkeit und echter Gottessinn! Wahrhaftig, diese inneren Vorzüge können kaum in einem anderen als in schönem Körper wohnen!"
Bei gegebener Gelegenheit musterte Leonardo angelegentlich die Züge des Chorsängers - und er hatte sich nicht getäuscht: dieser junge Mann vereinigte so wohlgebildete Gesichtszüge mit einer solchen Milde des ganzen Wesens, dass der Maler sofort mit sich einig wurde - dieser und nur dieser vermöge das Modell zu seinem Christushaupt abzugeben.
Auf einem öffentlichen Platz trennte sich die Gruppe der kirchlichen Chorsänger, um auf verschiedenen Wegen den Wohnungen zuzustreben. Leonardo da Vinci trat dem erkorenen jungen Mann in den Weg.
"Einen Augenblick, Signor!" bat er herzlich, während seine Augen von Hoffnung leuchteten.
"Womit kann ich Ihnen zu Diensten sein?"
Die Stimme des Chorsängers klang auch jetzt wieder so mild, so vertrauenerweckend!
"Ich bin der Maler Leonardo da Vinci", versetzte der Meister.
Der junge Mann machte eine höfliche Verbeugung: wie die meisten gebildeten Italiener, so kannte auch er den berühmten Meister der Malkunst von seinen Bildern und seinem Ruhm her.
"Ich suche für mein "Abendmahl" einen würdigen Christuskopf", fuhr Leonardo fort. "Und in Ihrem Gesicht glaube ich das richtige Modell für das Heilandsantlitz gefunden zu haben. Darf ich Sie bitten, mir Ihre Züge zu jenem hehren Zweck zu entleihen?"
"Aber, Meister!"
"O, lassen Sie mich keine Fehlbitte tun! Der Zweck meiner Bitte entschuldigt gewiss die Kühnheit meines Vorgehens, so dass Sie mir darob nicht zürnen dürfen."
"Ich zürne Ihnen deshalb gewiss nicht."
"Und doch zaudern Sie, meinem Wunsch zu willfahren?
"Ich halte mich eben - für unwürdig, das Modell zu Ihrem Jesus-Antlitz abzugeben."
"Sie lieber, bescheidener Mensch! Gerade aus dieser Antwort ergibt sich auch Ihre Würdigkeit. Ich bitte nochmals um Erfüllung meines Wunsches. Sie tun ein gottgefälliges Werk damit, da Sie mir zur Hauptperson meines Bildes verhelfen und später, nach Vollendung des Gemäldes, Tausende zur Andacht zum Weltheiland anspornen werden."
"Ist dem so, dann bin ich freilich bereit, in der gewünschten Weise zur Vollendung Ihres Bildes beizutragen."
"Dank, tausend Dank! Und wie darf ich das Modell zu meinem Christuskopf anreden?"
"Ich heiße Pietro Bandinelli." - -
Schon nach einiger Zeit leuchtete das himmlisch verklärte, durch und durch veredelte Antlitz des Chorsängers Bandinelli von dem Zeichenentwurf Leonardos als Mittelpunkt des geplanten Bildes auf die Besucher der Arbeitsstätte des Meisters hernieder. Und jedermann überbot sich im Lob von dessen Vortrefflichkeit.
2.
Einige Zeit ist verflossen. Meister Leonardo da Vinci hatte mit Bienenfleiß, aber auch mit höchstem Bedacht an seinem Gemälde-Entwurf weitergearbeitet. Monat um Monat war er der Vollendung entgegengeeilt: zur Rechten und Linken des Heilandes reihten sich die edel gehaltenen Gestalten der Apostel an, jeder in seiner Eigenart und Charaktereigentümlichkeit - vom zartfühlenden, liebeglühenden jungfräulichen Johannes bis zum energischen, willensgroßen, christusbegeisterten Petrus.
Aber ganz vollendet war das Bild noch nicht: es fehlte noch die Figur des Verräters Judas Iskariot, und mit deren Ausführung beschäftigte sich Leonardos Geist soeben ganz intensiv. Aber wie er ehedem nach einem würdigen, der Erhabenheit Jesu entsprechenden Modell-Köpfe für den Heiland gar lange vergeblich gesucht, so machte ihm nunmehr die Auffindung eines solchen für den Verräter-Jünger große Schwierigkeiten. Gewiss - Gaunerköpfe und Missetätergesichter gab es übergenug; aber ein Judas-Kopf war schwer auffindbar.
In tiefes Nachdenken hierüber versunken, schritt Meister Leonardo eines Nachmittags wieder durch das Gewirr der Straßen Roms, als er auf dem Postament eines öffentlichen Brunnens eine Bettlergestalt kauern sah, die sogleich sein forschendes Künstlerauge fesselte: die Züge trugen den Stempel ausgeprägter Verkommenheit. Wirr und strähnig fielen die dunklen Haare auf die eingefallenen Schläfen und um die hässlich gerunzelte Stirn nieder. Die Augen starrten unheimlich drein; die wulstigen Lippen schienen Giftdünste auszuhauchen.
"Ein Judas-Kopf", entschlüpfte es dem Mund Leonardos, während er auf den Bettler näher zutrat.
Aber wer beschreibt sein Staunen, ja seinen Schrecken, als der verkommene Mensch, noch ehe der Maler selber ihn angesprochen hatte, ihm mit hohler, brüchiger Stimme zurief:
"Ah! Sieh da, ein alter Bekannter! Suchen Sie wieder einen Modell-Kopf?"
"Wie - was? Sie kennen mich?" stotterte Leonardo.
"Warum sollte ich Sie nicht kennen, Meister? Sie nahmen ja doch ehedem meinen Kopf zum Modell für Ihr Christusbild!"
Der Maler taumelte vor Schrecken ein paar Schritte zurück.
"Sie sind also - Pietro - Bandinelli?" kam es silbenweise von seinen Lippen.
"Der bin ich", versetzte der Bettler frech und ohne Anflug von Scham oder Reue. "Nicht wahr, ich habe mich verändert seit jener Zeit! Ja, ja, es ist mir auch schlecht ergangen. Ich geriet in eine Spieler- und Trinkergesellschaft, verlor darüber meine Stelle als Solo- und Chorsänger und habe nun meist nicht so viel Geld in der Tasche, dass ich meinen Durst mit Branntwein zu stillen vermag. Aber jetzt wird`s besser werden! Ich werde jetzt wieder etwas verdienen und zwar durch Modellsitzen - nicht wahr, Meister?"
In echt gaunerhafter Zudringlichkeit streckte er Meister Leonardo seine schmutzige Rechte entgegen. Allein der schlug nicht ein, sondern ließ sprachlos seine Augen über den Bettler gleiten: sollte er einen Aufschneider vor sich haben? Oder sollte dieser Mensch die Wahrheit sagen? Aber - wirklich! Je länger seine Blicke auf den verkommenen Zügen des Bettlers ruhten, desto mehr wurde es ihm zur grausenden Gewissheit, dass er in Wirklichkeit vor Pietro Bendinelli steht. Einige Anklänge an seine frühere Schönheit und edles Aussehen waren wohl noch ersichtlich - sonst aber hatten Trunk und Spiel alles Edle, alles Ansprechende aus dem Gesicht des Bettlers weggetilgt, um dafür die deutlichen Spuren der Gemeinheit und Niedertracht zurückzulassen.
Leonardo schüttelte sich, wie wenn er sich eines schlimmen Zaubers entäußern wolle. Eine Weile legten sich seine schlanken Künstlerhände vor die Augen - er vermochte die grausige Verwandlung vor sich nicht mehr zu sehen. Als aber der Bettler stets zudringlicher auf ihn einredete und nach Verdienst rief, wandte sich der Meister um und sagte mit einem herzerschütternden Seufzer:
"Folgen Sie mir! Sie sind das richtige Modell für eine Judasfigur. . . ."
* * *
Im Jahr 1499 war die berühmte "Cena" Leonardo da Vincis fertiggestellt. Nicht bloß die Kunstkenner und Liebhaber der religiösen Malerei labten Herz und Auge an den wundersamen Gestalten des Gemäldes; nein, auch das gewöhnliche Volk staunte sie an und erbaute sich daran. Leonardos Name schwebte auf gar vielen Lippen. Man war allgemein der festen Überzeugung, dass die Menschheit um ein Kunstwerk ersten Ranges reicher geworden war. Am vollendetsten und bedeutsamsten fand man die Gestalten Christi und des Judas Iskariot. Erstere pries man göttergleich, unübertrefflich schön und edel: von göttlicher Hoheit umflossen und doch wieder von solcher Milde und Menschenfreundlichkeit war diese Christusfigur, dass der Beschauer sich von tiefster Ehrfurcht und innigster Liebe durchschauert fühlte.
Die Judasfigur aber nannte man den Triumph einer kunstvollen Darstellung von Menschenverworfenheit und Sinnenniedertracht: ein Gesicht von ausgeprägter Verworfenheit, in dem Habgier und Selbstsucht jeden edlen Zug ausgelöscht haben, erfüllte alle mit Grausen. Der tückisch-grausame Zug um den Mund; die zusammengekniffenen Lippen, der lauernde Zug der Augen und vor allem die raubtierartig um die Geldbörse gekrallten Finger ließen vor solcher Verkommenheit fast erzittern. Wahrhaftig - so konnte der wahre Judas ausgesehen haben, der seinen Herrn und Meister, seinen Freund und Wohltäter an die Henkersknechte auslieferte; der sich nicht scheute, durch einen Kuss, den sonst so edlen Liebesbeweis unter den Menschen, diesen grässlichen Verrat auszuüben!
Konnten diese beiden so grundverschiedenen Gesichter - das Christus-Antlitz und die Judaszüge - von ein und derselben Person stammen? Niemand ahnte diese schauerliche Wahrheit; niemand vermutete, dass die Sünde, dass Spiel und Trunk diese Person aus einem Christus-Ebenbild zu einem Judas gemacht hatte.
________________________________________________________________________

9. Letzte Krankheit und Tod von Bernadette Soubirous
Ein Bericht über die letzte Krankheit und den Tod von Bernadette Soubirous, der demütigen und heiligmäßigen Seherin von Lourdes (Seliggesprochen wurde Bernadette am 14. Juni 1925 durch Papst Pius XI., heiliggesprochen wurde sie am 8. Dezember 1933 ebenfalls durch Papst Pius XI.):
Bernadette Soubirous ist am 16. April 1879, am Mittwoch in der Osterwoche entschlafen; ihre Mission ist beendet und sie selbst war bereit für den Himmel.
Das unschuldige, natürliche Kind, die peinlich gewissenhafte Ordensfrau, die geduldige Kreuzträgerin sollte nun den Lohn in Empfang nehmen, den die selige Jungfrau ihr in der Grotte zugesichert hatte.
In bewundernswerter Weise hatte sie deren Auftrag Folge geleistet. Während 8 Jahren hatte sie den Menschenmengen berichtet und mit engelhafter Einfachheit erzählt, was sie in der Grotte gesehen und gehört hatte, weder den neugierigsten Fragen noch auch den oft mit Absicht verwirrenden boshaften Verhören die Antwort verweigernd - sich nie widersprechend und zuletzt selbst die Übelwollenden überzeugend. Nach diesem achtjährigen öffentlichen Apostolat fand sie Ruhe und Frieden in dem geliebten Kloster St. Gildard.
Einige Tage nach ihrer feierlichen Gelübdeablegung wurde Bernadette von ihrer letzten Krankheit ergriffen; am 11. Dezember musste sie sich ins Krankenhaus begeben, das sie nicht mehr verlassen sollte. Am 12. und 13. Dezember sollte sie nochmals in feierlicher Weise die wunderbaren Ereignisse bestätigen, deren Zeugin sie in der Grotte gewesen war. Mit einer bei ähnlichen Gelegenheiten nie vorher bewiesenen Freudigkeit beantwortete sie den Vertretern der Bischöfe von Tarbes und Nevers ein langes Fragenverhör. In dem weichen Dialekt der Pyrenäen wiederholte sie die Worte, die sie von den Lippen der Gottesmutter vernommen hatte. Angesichts des Todes und der Ewigkeit bekräftigte sie nun nach 20 Jahren ihre ersten Aussagen, einer Zeit entstammend, da sie noch ein Kind war, und blieb nach wie vor das Echo der unbefleckt Empfangenen.
Nun konnte sie beruhigt sterben. Ein asthmatisches Leiden, das ihr ganzes Leben erschwert, stellte sich mit immer häufigeren Krisen ein, schwächte und beengte sie. Ein großes Geschwür umgab das linke Knie und Knochenfraß zehrte am Mark der Knochen. Die arme Kranke konnte das Bett und den Armstuhl nicht mehr verlassen und bald war der zarte Körper mit Wunden bedeckt.
Die Heftigkeit der Schmerzen entriss ihr zuweilen laute Schreie, die sie jedoch schnell zu innigen Gebeten umwandelte. "Dir, mein Gott, opfere ich es auf!" rief sie dann energisch; "dich liebe ich - ich will dein Kreuz und nehme es an."
Auch ihre Seele wurde gekreuzigt. Der böse Feind versuchte sie mit jenen schrecklichen Gewissensbeunruhigungen, die großmütigen Seelen, die sich als Opfer für die Sünden der Welt Gott hingegeben haben, eine Ahnung der Höllenpeinen geben. Das Wort: "Buße und Gebet", das sie in der Grotte vernommen hatte, sollte sich auch an ihr bewahrheiten. Als ihr Beichtvater sie mit dem Hinweis auf den Himmel und die Erinnerung an die selige Jungfrau beruhigte, erwiderte sie: "Ja, das sind Gedanken, die Trost bringen."
Man ermutigte sie, freiwillig das Opfer ihres Lebens zu bringen. "Es ist kein Opfer", war ihre Antwort, "ein armseliges Leben zu verlassen, in dem sich uns so viele Schwierigkeiten entgegensetzen, wenn man Gott angehören will."
Die zunehmende Körperschwäche schien ihrer Seele vermehrte Kraft zu geben. Mit ihren großen Augen, die immer strahlender und glänzender wurden, verrieten, dass noch Leben in ihr wohnte. Ein himmlisches Feuer schien von ihnen auszugehen, wenn sie das Kruzifix und ein Marienbild betrachtete oder aber zum Himmel aufschaute.
Der Klostergeistliche glaubte, dass sie ihren nahen Tod ahne. "Was haben Sie vom heiligen Joseph erbeten", fragte er sie nach dessen Fest. In kräftigem Ton erwiderte sie: "Ich habe um einen guten Tod gebetet."
Die Erhörung ihres Gebetes schien nahe zu sein. Am 28. März brachte ihr Beichtvater ihr die heilige Wegzehrung. Soeur Marie-Bernard sprach mit so lauter Stimme, dass alle Anwesenden überrascht waren: "Liebe, würdige Mutter, ich bitte um Verzeihung für alles Leid, dessen Veranlassung ich gewesen bin durch meine Untreue im Ordensleben sowie noch für das schlechte Beispiel, das ich meinen Ordensschwestern gegeben habe."
Allein der Tod kam noch nicht, sie zu erlösen. In den kurzen Pausen, da die Schmerzen etwas nachließen, zeigte sich immer wieder ihre kindlich naive Fröhlichkeit; selbst wenn sie von ihrem Tod sprach, fand sie sanfte, liebenswürdige Scherzesworte.
Aber nur zu schnell begann die Krankheit ihr Zerstörungswerk aufs neue. Die körperlichen und seelischen Leiden verdoppelten sich während der Karwoche; die mutige Braut des Erlösers sollte an dem großen und zugleich furchtbaren Opfer des Herrn Anteil haben.
"Was werden Sie Ostern beginnen?" fragte man sie.
"Meine Leiden enden erst mit dem Tod", war ihre Antwort.
Der Ostertag begann und war für Soeur Marie-Bernard ein fortgesetztes Gethsemani und Golgatha.
Osterdienstag war ein Tag der furchtbarsten Todesangst. In der Nacht von Montag auf Dienstag hörte man sie wiederholt rufen: "Fort von hier, Satan!" Am Morgen bekannte sie ihrem Beichtvater, dass der Teufel versucht habe, sich auf sie zu stürzen; jedoch nachdem sie den Namen "Jesus" angerufen hatte, kehrte der Friede zurück.
Am Dienstag morgen empfing sie nochmals die heilige Wegzehrung und alsbald begann der Kampf aufs neue. Am Abend war Soeur Natalie bei ihr, die zweite Assistentin, zu der sie ein besonderes frommes Zutrauen hatte.
"Liebe Schwester, ich fürchte mich, - ich fürchte mich", rief die arme Sterbende, jedoch Soeur Natalie beruhigte sie wiederum. "Ich habe so viele Gnaden erhalten", fuhr sie fort, "und fürchte sie so schlecht angewandt zu haben." Die gute Schwester verwies sie auf die übergroße Barmherzigkeit unseres Erlösers und versprach, dass alle mit ihr beten würden.
Mit einem glücklichen, lauten: "Nun bin ich beruhigt", vernahm die Sterbende es und blieb im Frieden bis zum Ende.
Am Morgen des 16. April saß sie betend in ihrem Sessel und erwartete den Tod. Um 1 Uhr ließ sie ihren Beichtvater rufen, um nochmals zu beichten.
"Sie leiden große Schmerzen", sagte eine der Anwesenden.
"Das alles wird mir nützlich sein für den Himmel", war ihre Antwort.
"Ich werde die Unbefleckte Mutter bitten, Ihnen Trost zu senden."
"Nein", erwiderte die Kranke, "keinen Trost, aber Stärke und Geduld."
Da erinnerte sie sich des päpstlichen Segens für die Sterbestunde, den Pius IX. ihr bewilligt: sie nahm das Dokument in die Hand und sprach mit Andacht den Namen "Jesus" zur Gewinnung des Ablasses.
Dann sprach sie innig: "Mein Gott, ich liebe Dich aus meinem ganzen Herzen, - aus meiner ganzen Seele und mit allen meinen Kräften."
Man las ihr die Gebete der Sterbenden vor. Mit schwacher, aber deutlicher Stimme wiederholte sie alle Akte. Mit Rührung bemerkte man, dass ihre großen Augen sich von Zeit zu Zeit öffneten, um das Kruzifix an der Wand mit innigster Andacht zu grüßen. Man legte es in ihre schwachen Hände. Die Sterbende ergriff es mit hastiger Bewegung und drückte es so fest an ihr Herz, als ob sie es nie mehr lassen wolle. Man befestigte es in der Weise, dass sie es ohne Anstrengung beständig vor Augen hatte und küssen konnte.
Plötzlich breitete sie die Arme in Kreuzesform aus und hörte man sie mit halblauter Stimme sagen: "O, wie ich ihn liebe!"
Die Sterbende bat den Priester, sie zu verlassen, da die Schwestern beichten wollten; es blieben nur einige von ihnen bei ihr, die sich im Gebet mit ihr vereinigten. um 2 Uhr 45 kam Soeur Natalie eilig aus der Kapelle, einer Ahnung folgend. Als sie eintrat, streckte die Sterbende ihr flehend die Arme entgegen. "Helfen Sie mir", rief sie; "helfen Sie mir, - beten Sie für mich." Die Gebete der Schwestern beruhigten sie wiederum. Dann bat sie Soeur Natalie um Verzeihung, nahm liebevoll das Kruzifix in die Hand und küsste einzeln jede Wunde des Herrn.
Auf ein Zeichen hin, dass sie zu trinken verlange, gab man ihr ein Glas, das sie selbst in die ersterbenden Hände nahm, und trank einige Tropfen.
Ehe sie das Glas an die Lippen brachte, machte sie feierlich eines dieser großen Kreuzzeichen, wie sie sie von der Gottesmutter gesehen hatte, das nun die Zeugen ihres Todeskampfes ebenso rührten als sie die bei der Extase Anwesenden entzückt hatten.
Nun ging es zu Ende.
Bernadette hatte Frieden. Die Schwestern beteten und sie schloss sich mit ersterbender Stimme an. Endlich hörte man sie zweimal den zweiten Teil des "Ave Maria" beten, jenes Gebet, das sie oft und freudig an der Grotte wiederholt hatte. Zum dritten Mal setzte sie an:
"Heilige Maria, Mutter Gottes . . ."
Es waren ihre letzten Worte, - sie konnte nicht vollenden.
Die Anwesenden, die sie scheiden sahen, beteten noch: "Jesus, Maria, Joseph, - steht uns bei im Todeskampf."
Bernadette neigte das Haupt und stand vor ihrem Richter. Es war 3 Uhr, - die Todesstunde ihres Erlösers; am gleichen Tag, - vor 21 Jahren war es gewesen, - als das der Erde entrückte Kind mit der brennenden Kerze in der Hand in der Grotte vor der Gottesmutter betete, während die Flammen der herabbrennenden Kerze in ihrer Hand die Finger brannte, ohne zu verbrennen oder sichtbare Brandspuren zurückzulassen.
So war auch ihr Lebenslicht erloschen, das Leben, das mit neuem Glanz zur Verherrlichung Gottes und seiner heiligen Mutter in der Kirche leuchten sollte, um nun im unvergänglichen Lichtglanz des Paradieses in alle Ewigkeit zu strahlen.
________________________________________________________________________

Die Versuchung Jesu
10. Woher der Schnaps?
Der Höllenfürst saß einmal in Gedanken versunken auf seinem glühenden Thron, stützte den gehörnten, bärtigen Kopf mit den Händen und seine großen Augen glühten vor wilder Wut.
Die übrigen Teufel wichen von ihm von weitem aus; sie fürchteten sein wuchtiges, glühendes Zepter.
Auf einmal schlug der Fürst des dunklen Reiches mit seinem Zepter auf den Boden und die ganze Hölle dröhnte unter dem Schlag, als hätten tausend Donner auf einmal gebrüllt.
Die Anführer der höllischen Scharen nahten mit sklavischer Demut und Gleisnerei dem Thron ihres grausamen Fürsten. Niemand von ihnen wagte die Frage, warum der Herr und Gebieter sie gerufen habe.
Luzifer brüllte sie wie ein Tier an:
"Elende Bösewichte! Ihr dient mir verdammt schlecht! Was treibt ihr und eure untergebenen elenden Meuten auf der verfluchten Erde, dass durch unser Tor seit langer Zeit kein Sterblicher mehr den Einlass begehrte? Ich hungere und dürste nach Menschenseelen. Redet! Was ist die Ursache davon?"
Der erste Anführer der höllischen Geister trat vor, verneigte sich und sagte mit verhohlener Wut:
"Großmächtiger Fürst, wir tun, was wir können, damit dein Reich gefüllt wird, aber all unser Mühen ist vergeblich. Auf der Erde herrscht Hunger und Pest, die Gasthäuser sind leer, dafür aber die Kirchen" - bei diesem Wort knirschte der alte Teufel mit seinen langen weißen Zähnen - "die Kirchen sind Tag und Nacht voll und, großmächtiger Fürst, du weißt es selbst gut: aus der Kirche Seelen holen ist eine schwere Aufgabe. Beschuldige also uns nicht der Nachlässigkeit und verfolge uns nicht mit deinem Zorn."
Der Höllenfürst presste zornig die Zähne aufeinander und brüllte dann: "Sorgt also, dass auf der Erde wieder Fruchtbarkeit und Gesundheit eingekehrt, damit die Leute übermütig werden."
"Verzeihe, mächtiger Fürst", warf der alte Teufel ein, "du verlangst von uns unmögliche Dinge. Du weißt, dass es uns beschieden ist, Verderben und Unglück, niemals aber Segen zu bringen."
Luzifer zuckte heftig vor Unwillen und versank in Gedanken. Nach einer Weile erhob er den Kopf und fuhr seine Getreuen an: "Also schafft Rat!"
"Wir dachten, mächtiger Herr, ohnehin alle darüber nach, wie dieser unserer Not abzuhelfen wäre, wir wissen aber keinen Rat!"
"Dumme Teufel!" schrie sie der Fürst an. "So geh ich also selber auf die verfluchte Erde und ihr sollt sehen, wie sich mein Reich wieder füllen wird."
Da trat ein kleines, buckeliges Teufelchen vor, grüßte verschmitzt und brachte mit einer Stimme, um die ihn jeder Puter hätte beneiden können, die Worte hervor: "Großmächtiger Fürst, lass alle Sorgen beiseite. Ich werde hier zwar von vielen verachtet, aber schick mich nur auf die Welt und ich verspreche dir, dass in Kürze unser Tor kaum für alle reichen wird, die deinem Thron zuströmen werden. Wenn mir es nicht gelingt, soll mich dein ärgster Zorn treffen."
Der Höllenfürst lächelte freundlich und sagte: "Ich weiß schon lange, dass in dir mehr steckt als in allen übrigen aufgeblasenen Teufeln zusammen. Geh nur, mein Freund, und wenn du deine Aufgabe zu meiner Zufriedenheit vollführst, kannst du um eine Stufe höher vor meinem Thron sitzen."
Das buckelige Teufelchen verneigte sich und flog auf seinen Fledermausflügeln von dannen.
Er flog lange, lange durch den Weltenraum, bis er auf der kleinen, von weißem Licht beleuchteten Erde ankam. Das buckelige Teufelchen ließ sich auf dem Platz einer Stadt nieder.
In der Stadt war alles still, nur da und dort schleppte sich eine traurige Gestalt wie ein Schatten zur Kirche, woher die Orgel tönte.
Der Teufel erbebte bei dem Orgelklang und stolperte schnell in eine Seitengasse zu einem großen Haus, wo über dem Tor die Inschrift stand: "Brauerei".
Vor dem Tor stand an die Mauer gelehnt ein magerer Mann und schaute traurig vor sich auf das glühende Pflaster. Flugs verwandelte sich der Teufel in einen reisenden Brauburschen und grüßte höflich den mageren Mann: "Bitte, sind Sie der Herr Braumeister?"
"Gewesen, gewesen", seufzte der Magere, "denn seit dem die Not und die Krankheit herrscht, hab ich das Bierbrauen aufgegeben und mein Brauhaus steht leer."
"Aber einen Krug Bier haben Sie doch?"
"Ah, genug", sagte verdrießlich der Brauer. "Erst unlängst hab ich um einen Spottpreis zwei Fuhren dem herrschaftlichen Verwalter für seine Arbeiter verkauft. Das Volk auf dem Land trinkt alles, aber da in der Stadt will es niemand auch nur verkosten."
"Warum denn nicht?" wunderte sich der Teufel.
"Wundern Sie sich nicht", seufzte der Bauer. "Ich trinke es selber nicht; ist ja essigsauer."
"So lassen Sie mich wenigstens kosten", bat der Teufel, "ich hab einen furchtbaren Durst."
"Mit Vergnügen. Kommen Sie rein und trinken Sie, wie viel Sie wollen. Wenigstens werde ich wieder einmal in meiner Schenkstube einen Gast sehen."
"Führen Sie mich lieber gleich ins Braustübel", sagte der vermeintliche Braubursche.
"Wie es Ihnen beliebt", sagte der Brauer und führte ihn ins Braustübel.
Darauf brachte er einen Krug voll Bier und reichte ihn dem Gast: "Trinken Sie; zum Wohl!"
Der Teufel setzte den Krug an die Lippen und tat einen langen, langen Zug. Die Augen glänzten ihm vor Vergnügen wie einem Kater, wenn er nach einem schönen Kanarienvogel schnappt, und als er abgesetzt und den Krug wuchtig auf den Tisch niedergestellt hatte, sagte er: "Ah, das war ein Trunk!"
Der Brauer sah ihn ganz erstaunt an: "Aber, Mensch, hat es Ihnen denn wirklich geschmeckt? Es ist ja der reine Essig!"
"Herr Brauer", flüsterte der Fremde, heimtückisch blinzelnd, "unter ust gesagt: gerade dieses Bier ist nach meinem Geschmack. Wissen Sie, ich hab im Magen eine Glut wie einen glühenden Stein, und gerade solch ein Bier kühlt mir die Glut am besten."
"Schade, dass ich nicht viele solche Gäste habe!" rief der Brauer aus. "Dann wär ich ein fertiger Herr; aber unsere Leute mögen es gar nicht ansehen; es widerstrebt ihnen, sagen sie."
"So geben Sie ihm einen anderen Geschmack, dass es ihnen mundet", lachte der Teufel.
"Und wie denn das?" - Der Brauer starrte ihn verwundert an. "Das ist ja gar nicht möglich."
"Sehr leicht sogar", lachte der sonderbare Braubursche. "Ich bin ein wohlerfahrener Mensch und weiß mehr als hundert Brauer. Ich bedauere Sie, dass es Ihnen so schlecht geht, darum will ich Ihnen zeigen, wie Sie dem Bier einen guten Geschmack beibringen können, damit Sie wieder Gäste in Hülle und Fülle haben."
"Mein guter Mensch", freute sich der Brauer, "wenn Sie das zustande bringen, gebe ich Ihnen, was Sie wünschen."
"Ich verkaufe meine Kunst nicht", grinste der Teufel stolz, "was ich tue, tue ich aus Herzensgüte. - Wenn Sie wollen, können wir gleich heute Abend mit der Arbeit beginnen."
"O, mit Vergnügen!" rief der Brauer ganz glückselig, "aber was soll ich einem so raren Gast zum Abendessen geben?"
"Ich habe keinen Appetit", rümpfte der Braubursche die Nase, "außer Sie möchten mir einige Zungen von alten Klatschbasen rösten."
Der Brauer stutzte, starrte seinen Gast noch mehr an und wich um einige Schritte zurück.
Der Teufel lachte lustig auf und klopfte ihm auf die Schulter: "Machen Sie sich nichts daraus, war ja nur ein Spaß. Ihr Bier ist mir zu Kopf gestiegen und so weiß ich nicht einmal recht, was ich rede."
* * *
Abends ließ sich der Teufel das ganze sauer gewordene Bier heraufrollen, verschloss sich im Brauhaus und ging an die Arbeit. Die ganze Nacht hörte man schlagen und klopfen, als wenn zehn Kesselflicker drinnen arbeiteten. Aus dem Kamin flogen Funken und der Hund im Hof kroch nicht einmal aus seiner Hütte heraus. Ganz erschreckt zitterte er und winselte die ganze Nacht.
Als der Hahn das erste Mal krähte, wurde es im Brauhaus still, der Kamin hörte auf zu rauchen und der Teufel machte die Tür auf. Er trug ein Gläschen mit einer reinen Flüssigkeit geradeaus in des Braumeisters Wohnung. Stürmisch pochte er an die Tür.
Der Brauer fuhr erschreckt auf und rief: "Was ist denn?"
"Ich, Herr Meister! Machen Sie auf, ich bring Ihnen eine Kostprobe von dem ungesottenen Bier."
Der Brauer machte schnell auf und die Stube war augenblicklich angefüllt mit einem ihm unbekannten scharfen, beißenden Geruch.
Er nahm das Gläschen in die Hand, roch daran, sah die Flüssigkeit gegens Licht an und fragte erstaunt den Brauburschen: "Das soll mein Bier sein?"
"Jawohl, kosten Sie es nur!"
"Hat aber weder die Farbe noch den Geruch des Bieres."
"Dafür eine viel größere Kraft, als früher", grinste der Teufel.
"Verkosten Sie es nur!"
Der Brauer tat einen Schluck und sagte: "Brrr, ist das kräftig! In allen Adern spürt man es. Aber etwas widerwärtig kommt es mir vor."
"Warum sagen Sie "widerwärtig"? lachte der Fremde. "Sagen Sie lieber "ungewohnt". Trinken Sie noch einmal und dann werden Sie schon auf den Geschmack kommen. Sie werden sich überzeugen, dass Ihnen nach diesem Trunk kein gewöhnliches Bier und kein Wein mehr schmecken wird."
Der Brauer trank nochmals und seine Augen begannen zu funkeln. "Meiner Seel!" sagte er wohlgefällig. "Das ist ein vorzüglicher Tropfen. Als wenn man einem Feuer in die Adern geschüttet hätte."
"Und gegen die Pest ist es die allerbeste Arznei", sagte der Teufel ernst und bedeutungsvoll. "Wer sich an diese Arznei hält, der braucht keine andere. - Ihr habt jetzt gerade die Pest in der Stadt, sorgen Sie dafür, dass alle Leute diese Arznei genießen."
"Aber wie bring ich die Herren Nachbarn hierher?" fragte der Brauer verlegen.
"Wie?" lachte der Teufel. "Gehen Sie zum Bürgermeister und lassen Sie austrommeln, dass zu Ihnen ein Arzt kam, der Sie eine Arznei gegen alle möglichen Krankheiten brauen lehrte, und laden Sie alle zu sich ein."
"Ich möchte nicht gern zum Bürgermeister gehen. Er ist ein allzu barscher Herr und fährt einen jeden gleich an."
"So trinken Sie noch einmal und dann haben Sie Courage genug."
Der Brauer folgte, leerte das Glas aus, schlug damit auf den Tisch und schrie: "Recht haben Sie! Wozu sollte ich den Bürgermeister fürchten? Ist ja ein Mensch wie jeder andere. Ich fühle selbst in allen Adern, dass es eine vorzügliche Medizin ist. Sie werden noch der größte Wohltäter unserer Stadt werden."
Er kleidete sich an und ging zum Bürgermeister. Eine halbe Stunde darauf trommelte der Gemeindediener und rief aus, dass der Brauer Schnapp ein Wunderbier ausschenkt, welches als Medizin gegen jegliche Pest zu gebrauchen ist. Das Glas koste nur zwei Groschen.
Lange ließ sich kein Gast blicken. Erst gegen neun Uhr kamen ins Brauhaus schüchtern und misstrauisch einige vor Angst bleiche und abgehärmte Nachbarn.
Der rätselhafte Braubursch stand unterm Tor, lächelte sorglos und grüßte die Gäste höflich: "Kommen Sie nur, geehrte Herren. Bitte, nur hereinspaziert. Gleich will ich Ihnen mit unserer vortrefflichen Medizin dienen."
Die Bürger sahen ihn erstaunt an und der herzhafteste unter ihnen sagte: "Aber, Mensch, wer sind Sie denn? Wir haben Sie ja unser Lebtag nicht gesehen."
"Ich bin der neue Braubursch", grinste der Teufel. "Heute Nacht habe ich das Wunderbier gebraut. Bitte, nur hereinzukommen. Wenn Sie es einmal verkostet haben, werden Sie Ihr Lebtag von ihm nimmer lassen. - Herr Braumeister", rief er fröhlich, "die Herren Gäste kommen!"
Der Brauer Schnapp kam ihnen ganz rosig aufgelegt und lustig entgegen und führte sie in die Schenkstube. Der buckelige Braubursch holte eine Flasche des neuartigen Bieres und schenkte den Gästen ein.
Sie sahen ihn ganz erstaunt an: "Das hat aber einen merkwürdig scharfen Geruch!"
"Wie eine jede Medizin", grinste der Braubursch, "aber trinken Sie und gleich verspüren Sie die Folgen."
Die Gäste tranken und schüttelten sich wie der Brauer am Morgen: "Brrr, das ist ja reines Gift!" riefen sie wie aus einem Mund.
"Jede Medizin ist Gift", bemerkte der Braubursch überzeugend. "Anfangs widerwärtig, wird es nach und nach angenehm und gesund. Verkosten Sie nur nochmals."
Die Gäste verkosteten und die Augen begannen ihnen zu funkeln: "Wirklich, jetzt ist es nicht mehr widerlich. Das ist wirklich ein Wunderbier."
Und als sie die Gläschen bis zur Hälfte geleert hatten, rief des Brauers nächster Nachbar, der ehrsame Schuster Pfriem, lustig: "Herr Schnapp, seien Sie nicht böse! Ihr früheres Bier war häufig nur ein miserables gefärbtes Wasser, aber dieses neue Bier macht Ihrem Namen alle Ehre!"
"Vorzüglich", klatschte der Brauer in die Hände, "wenn es meinem Namen Ehre macht, so soll es auch meinen Namen tragen; taufen wir es auf den Namen "Schnaps".
"Prost Schnaps!" erhob der Schuster sein Gläschen.
Alle stießen an und vergaßen Pest und alle übrigen Sorgen und waren beim besten Humor.
"Schade, dass hier kein Harfenspieler ist", sagte der Schneider Geiß mit schwerer Zunge. "heute ließe es sich singen, Herr Braumeister, noch ein Gläschen und lassen Sie Musikanten kommen."
"Entschuldigen Sie, meine Herren!" sagte der schlaue Teufel. "Das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Sie kennen ja noch nicht die Kraft dieses Wundergetränks. Ein zweites Gläschen könnte Ihnen schaden. Gehen Sie heim und schlafen Sie ein wenig; Sie werden sehen, wie Sie sich dann wohl fühlen werden. Nachmittags beehren Sie uns wieder und bringen Sie noch mehr Gäste mit, dass einmal das Sterbeglöcklein zu jammern aufhört und dass aus den Gasthäusern wieder lustige Musik erklingt, wie es sich von Rechts wegen gehört."
"Aha!" brummte der Schuster. "Es dürfte schon Zeit sein zum Heimgehen. Mir kommt es vor, als hätte ich fünf Krüge Bier getrunken."
Die Gesellschaft zahlte je zwei Groschen, dann standen sie auf und torkelten unsicheren Schrittes aus dem Wirtshaus hinaus.
* * *
Gegen Abend kamen die Gäste vom Vormittag wieder ins Brauhaus zum Schnaps und brachten auch ihre Nachbarn und Bekannten mit.
Der Brauer Schnapp strahlte vor Freude, der buckelige Braubursch hüpfte hin und her wie ein Irrlicht überm Sumpf, die Gäste aber wurden binnen kurzem so lustig, dass sie ungestüm nach Musik begehrten. Der Braubursch selbst holte die Musikanten. Woher er wusste, wo sie wohnten, danach fragte niemand. Kurzum: Die Musikanten kamen, spielten, sangen lustig und mit ihnen sang die ganze angeheiterte Gesellschaft.
Und plötzlich kamen - wie vom Himmel geschneit - einige aufgedonnerte Mädchen herein und es begann ein ausgelassener wilder Tanz.
So dauerte die Hetze bis zehn Uhr, als nach gutem altem Brauch der Nachtwächter eintrat und mit strenger Stimme verkündete, dass Zeit sei, heimzugehen.
Die lustige Gesellschaft aber lachte ihn aus, gab ihm ein Gläschen Schnaps, der Nachtwächter leerte es, und die Hetze ging von neuem los und dauerte, solange die Gäste auf den Füßen stehen konnten.
Gegen Mitternacht stahl sich der Teufel hinaus ins Brauhaus, wo er von neuem zu brauen begann.
Von Tag zu Tag kamen zum Brauer Schnapp mehr Gäste. Selbst aus der Umgegend kamen Leute, um das Wundergebräu zu verkosten. Und der buckelige Braubursch bediente unermüdlich vom frühen Morgen bis Mitternacht, und von Mitternacht zum frühen Morgen braute er das Wundergetränk, so dass der alte Herr Schnapp sich darüber wunderte und einmal zu seiner Frau sagte: "Du, Mutter, den Brauburschen hat uns Gott selbst geschickt; wir werden ja noch reich. Aber das will mir nicht einleuchten, dass der Mensch, seitdem er bei uns ist, noch nie geschlafen hat."
In einigen Tagen aber verwandelte sich des Brauers Freude in Leid. Er kam traurig zu seinem Brauburschen.
"Was ist geschehen?" grinste der Teufel.
"Ich habe das letzte Fass des sauren Bieres heraufgerollt", seufzte der Brauer. "Aus was werden Sie jetzt den Schnaps brennen?"
"Aus was?" lachte der Buckelige. "Aus allem, was Sie nur haben; aus Getreide, aus Kartoffeln, aus faulen Zwetschen - aus allem. Bringen Sie nur, was Sie im Hause haben, und ich braue Ihnen daraus Schnaps - die Hülle und Fülle!"
Die Schenkstube des Brauers Schnapp war jetzt voller als früher die Kirchen, und auch gab es darin mehr Gesang als früher in der Kirche, aber einen ganz anderen, einen, über den die Hölle ihre helle Freude hatte. Streitigkeiten, Geschrei, Raufereien, sogar Morde waren sozusagen auf der Tagesordnung.
In kurzer Zeit nach Erscheinen des buckeligen Brauburschen erschlug der Schuster Pfriem eines abends, als er nach Hause kam, Frau und Kinder. Der Schneider Geiß ging einmal unsicheren Schrittes heim, auf einmal fiel er, wie vom Blitz getroffen, nieder und stand nicht mehr auf.
Als sich solche Vorfälle mehrten, verschwand an einem dunklen Abend der geheimnisvolle buckelige Braubursch.
Er flog wieder auf seinen Fledermausflügeln durch den unermesslichen Weltraum, bis er an der Höllenpforte ankam.
Das Tor war offen und der Teufel erkannte auf der Schwelle einige gute Bekannte aus Schnapps Brauhaus. Er grüßte sie fröhlich und ging zum Thron Luzifers.
"Vorzüglich, mein Kleiner!" rief ihm der Höllenfürst von weitem schon zu. "Komm und setz dich nieder und zwar gleich neben mir. Du hast ein Meisterstück ausgeführt; mein Reich wächst. Du, Ahasver", rief er seinem Diener zu, "bring dem Kleinen da meine alte Krone und setze sie ihm auf sein gescheites Köpflein."
Der buckelige Teufel ruhte sich an der Seite des Höllenfürsten aus und kehrte dann wieder auf die Erde zurück, um auch in anderen Städten die Leute im Brennen des höllischen Getränks zu unterweisen.
________________________________________________________________________

11. Zur häufigen und täglichen Kommunion -
Von Emil Springer SJ, Sarajevo
Es ist ungemein interessant, die Mitteilungen des südafrikanischen Großmillionärs J. B. Robinson zu lesen, die vor einigen Jahren in einem englischen Blatt zu lesen waren. Es war im Jahr 1867, - erzählt dieser Gewährsmann - als ich auf der Fahrt von meiner Farm, wo ich tausend Stück Rindvieh stehen hatte, nach einer Nachbarstadt zuerst die Geschichte von einem im Fluss Vaal gefundenen großen Diamanten hörte. Es war die Geschichte von dem Diamanten, der später als der Stern von Südafrika berühmt geworden ist. Ein alter Freund von mir, Herr John O`Reilly, hatte bei der Farm Schalks van Niekerk in der Nähe von Hopetown ausgespannt. Als die beiden dann auf der Veranda saßen und ihren Kaffee tranken, bemerkte O`Reilly ein kleines Mädchen, das vor dem Haus mit Steinen spielte. Diese Steine hatten einen eigentümlich leuchtenden Glanz, der O`Reillys Aufmerksamkeit erregte. Van Niekerk sagte aber, es seien nur glänzende Kiesel, die das Kind irgendwo gefunden habe. O`Reilly wünschte indessen ausdrücklich einen der Steine in der Nähe zu sehen. Je länger er ihn betrachtete, desto mehr interessierte ihn der leuchtende Kiesel, so dass er zuletzt van Niekerk fragte, ob er den Stein verkaufen wolle. "Ach Unsinn", erwiderte der Holländer, "er hat ja keinen Wert. Behalten Sie ihn, wenn er Ihnen Spaß macht." Vergeblich drängte ihn O`Reilly, einen Preis anzunehmen. Zuletzt schloss die Unterhaltung damit, dass O`Reilly sagte: "Gut, ich will ihn wenigstens mit nach Colesberg nehmen und sehen, was ich dafür haben kann. Was ich dafür bekomme, davon sollen Sie die Hälfte haben." Als er nach Colesberg ins Gasthaus kam, zeigte er den Stein einem anderen Gast und fragte ihn um seine Meinung. "Er ist nichts wert", sagte der, "es ist nur ein großer Kiesel." "Er schneidet aber jedenfalls Glas", entgegnete O`Reilly, ging ans Fenster und Schnitt eine Scheibe durch. "Das bedeutet gar nichts", bemerkte der andere, "das kann ich auch mit einem Feuersteinkiesel." Zuletzt wurde der Stein als nicht der Beachtung wert zum Fenster hinausgeworfen. O`Reilly konnte aber späterhin doch der Versuchung nicht widerstehen, ihn zu suchen und wieder in die Tasche zu stecken. Er verkaufte ihn auch schließlich für 500 Pfd. Sterling (10.000 Mark). Darauf ging er zu van Niekerk zurück und zahlte ihm, wie er früher erklärt hatte, die Hälfte dieser Summe aus. Nun fand der Holländer Stoff zum Nachdenken. Auf einmal erinnerte er sich, dass er kurz vorher einen Buschmann gesehen hatte, der an einer Schnur um den Hals als eine Art Amulett einen größeren Stein von demselben matt leuchtenden Glanz, wie der Spielstein seines Kindes getragen hatte. Er sattelte sein Pferd und begab sich auf die Suche nach dem Buschmann und dem Stein. Zuletzt machte er den Mann wirklich ausfindig. Der Buschmann band bedächtig ein schmutziges Säckchen auf, das er um den Hals trug und zog einen mächtigen Diamanten hervor. Nach längerem Handel gab der Eingeborene den Stein für ein Schaf ab. Niekerk fuhr nach Hopetown und verkaufte dort den Stein für 11.200 Pfd. Sterling (224.000 Mark). Das war der berühmte Stern von Südafrika, der später für zirka 300.000 Gulden in den Besitz der Gräfin Dudley überging.
Wenn du diese Tatsache liest, wirst du denken: "O, wäre ich doch damals in Südafrika gewesen und hätte ich den Wert dieser Steine erkannt, ich wäre heute ein Millionär!" Wie sonderbar ist es doch, wenn Leute mit den wertvollsten Diamanten umgehen wie mit verächtlichen Kieselsteinen, und wenn sie noch darüber lächeln, sobald jemand einem Diamanten einigen Wert beimisst und sich ihn in die Tasche steckt. Du denkst: "Ich hätte sicher dergleichen nicht getan, ich hätte diese eigentümlichen Steine behutsam verwahrt und wäre jetzt ein steinreicher Mann. Aber leider, ich war damals nicht in Südafrika."
Nun, du brauchst das nicht allzu sehr zu bedauern. Wir Katholiken sind auch seit dem Jahr 1906 in ein Gold- und Diamantenland gekommen, wie es damals Südafrika war. Aber die meisten Katholiken benehmen sich doch so, wie damals jene Leute, die die Diamanten wenig schätzten und noch darüber lächelten, wenn jemand sich einen solchen kostbaren Edelstein zulegte. Seit dem Jahr 1906 sind alle Katholiken, die die heiligmachende Gnade und die gute Absicht haben, eingeladen, recht häufig, wenn es nur irgend geht, täglich zu kommunizieren. Wer sich um das herrliche Anerbieten des Heiligen Vaters nicht kümmert, handelt geradeso töricht, ja noch viel törichter als jene Südafrikaner, die Diamanten in großer Anzahl haben konnten, aber sie vernachlässigten. Er handelt noch viel törichter, weil ja schließlich jene nicht so leicht erkennen konnten, ob die Steine auch wirklich so kostbar waren. Den großen Wert einer Kommunion aber kann jeder Katholik, der nur irgendwelchen Gebrauch von seinem Verstand machen will, sehr gut abschätzen. Und dieser Wert ist ja auch ungleich größer als selbst der Wert des Sternes von Südafrika.
Glaubst du das?
Ich will es dir ganz genau beweisen:
Jede Kommunion, die im Stand der heiligmachenden Gnade empfangen wird, vermehrt die heiligmachende Gnade. Jeder Zuwachs nun von dieser heiligmachenden Gnade, die unsere Seele schmückt, ist zehnmal und hundertmal mehr wert als der größte Diamant. Denn die heiligmachende Gnade ist ja eine Anteilnahme an der göttlichen Natur, eine herrliche Gottähnlichkeit, wie uns der Glaube lehrt. Die göttliche Natur, das heißt Gott selbst, ist aber das Wertvollste, das es geben kann. Gott ist ja das allerhöchste Gut, unendlich wertvoller als alle irdischen Güter zusammen. Jede Anteilnahme an der göttlichen Natur ist darum auch unendlich wertvoller als alle irdischen Güter und ist weit über alle diese erhaben. Der geringste Grad dieser Anteilnahme, das heißt der geringste Grad der heiligmachenden Gnade und jede Vermehrung derselben ist wertvoller als alle irdischen Güter, geradeso wie auch ein kleiner Diamant ungleich wertvoller ist als ein großer Haufen von Erde oder Kieselsteinen.
Dazu kommt noch etwas. Alle irdischen Güter können wir nur für kurze Zeit besitzen. Wenn wir sie auch nie verlieren würden in diesem Leben, ja immer vergrößerten: der Tod raubt sie uns doch. Die Gnade aber wird uns auf ewig gegeben. Hier auf Erden kann sie uns nicht verloren gehen ohne unseren freien Willen, und nach dem Tod ist überhaupt jeder Verlust ausgeschlossen. Wenn also auch die Gnade nicht, wie sie es wirklich tut, an sich, durch ihre innere Schönheit und ihren inneren Wert, alle irdischen Güter überragte, so überragte sie sie dennoch, weil sie ein ewiges Gut ist. Jetzt denke einmal nach, wieviel die Ewigkeit länger ist als die Zeit! Wenn ich sage, dass sie tausend-, million-, billion-, trillion- und billionmal trillionmal länger ist als die Zeit, so ist damit auch noch gar nichts gesagt. Die Ewigkeit geht unendlichmal über alle Zeit hinaus; sie lässt sich noch viel weniger mit der Zeit ausmessen als ich den Ozean mit einem Teelöffel ausschöpfen kann.
Es bleibt also dabei: Der geringste Grad der heiligmachenden Gnade und die geringste Vermehrung derselben ist mehr wert als der größte Diamant, als alle Diamanten, die es gibt, als alle Schätze der Welt. Nun ist aber gerade die heilige Kommunion eingesetzt, um uns die heiligmachende Gnade, die wir besitzen, zu bewahren und sie beständig zu vermehren. Wie die Gnade eine Anteilnahme an der göttlichen Natur ist, so kann sie auch nur durch die Verbindung mit Gott in der Kommunion dauernd erhalten und beständig vermehrt werden. Wer sich fernhält von der heiligen Kommunion, wird das unendlich kostbare Leben der heiligmachenden Gnade sicher verlieren. Wer oft kommuniziert, bewahrt es und vermehrt es beständig, und zwar um so mehr, je öfter er kommuniziert. Das Leben der Gnade ist eben von der Kommunion geradeso abhängig wie unser leibliches Leben von der Nahrung. Die Kommunion ist ja die Nahrung des Gnadenlebens, durch welche es erhalten und vermehrt werden muss.
Jetzt bedenke das alles und antworte mir auf die Frage: "Was ist mehr wert, eine einzige heilige Kommunion oder das Vermögen eines Rothschild?" Wenn du nur irgendwie klar denken willst und dir nicht von dem großen Haufen Gold, Silber und Banknoten den Kopf verdrehen lässt, musst du antworten: "Eine einzige heilige Kommunion ist ungleich mehr als jene Millionen!" Ja, wenn wir aufrichtig sein wollen, müssen wir sagen: "Eine einzige heilige Kommunion ist mehr wert als das Vermögen von allen Kapitalisten Deutschlands, als das Vermögen von ganz Deutschland. Und wenn wir uns noch dazu denken allen Reichtum von Frankreich, England, Amerika, wenn wir all die Werte, die in diesen Ländern und auf der ganzen Erde aufgehäuft sind, zusammennehmen und das vergleichen mit der Gnade, die wir durch eine einzige Kommunion erhalten, es ist wie nichts, es verschwindet vollständig gegen den Wert dieser Gnade. Freilich ist es wahr: wenn man einem Menschen die Wahl ließe, entweder die heilige Kommunion zu empfangen oder das Vermögen des Rothschild zu bekommen, er würde höchstwahrscheinlich das letztere wählen. Aber das wäre eine Wahl, die in den Augen Gottes und in den Augen der Engel überaus töricht ist. Sie wäre in der Tat geradeso töricht, als wenn ein Kind die Wahl hätte zwischen einem kostbaren Diamanten und einem Haufen Flittergold und dies letztere wählte. Das Kind würde sich freilich freuen über den Wust von Flittergold, den es da erlangt hat. Jeder Vernünftige aber würde die Wahl als den größten Unverstand beklagen, wozu eben nur ein unvernünftiges Kind und einer, der seinen Verstand verloren hat, fähig ist.
Es ist also vollkommen klar: Eine einzige heilige Kommunion ist mehr wert als jeder Diamant und alle Diamanten der Welt. Ist es darum nicht ebenso wahr, dass alle Katholiken, die dem Anerbieten des Hl. Vaters so wenig Folge leisten, geradeso töricht und noch viel törichter sind als die Südafrikaner, die kostbare Diamanten sorglos liegen ließen und sie sogar zum Fenster hinauswarfen? Der Hl. Vater weiß, was die Kommunion bedeutet und lädt in seiner väterlichen Liebe alle Katholiken so dringend zur häufigen und täglichen Kommunion ein. Aber so viele Katholiken, um nicht zu sagen die meisten, sind so unverständig, dass sie diese herrliche Gelegenheit, sich unermesslichen geistlichen Reichtum und himmlische Schätze zu erwerben, unbenützt vorübergehen zu lassen. Und wenn man sie darauf hinweist, so antworten sie mit allerlei dummen Einwänden und Ausreden.
Wie sind doch all diese Einwände und Ausreden gar so haarsträubend unvernünftig!
Der eine sagt: "Ach was, das ist ja noch nicht dagewesen und ich bleibe beim alten!" Das klingt geradeso, als wenn einem armen Mann, der kaum sein Brot verdient, viel Geld angeboten würde und antwortete: "Ach was, ich habe ja noch nie viel Geld gehabt und bin immer in schweren Sorgen gewesen. Ich bleibe beim alten, ich will das Geld nicht haben."
Ein anderer sagt: "Die übrigen tun es ja auch nicht. Warum soll gerade ich eine Ausnahme machen?" Das ist geradeso sonderbar, als wenn irgendwo Diamanten lägen und einer sagte: Die anderen greifen nicht zu. Warum soll ich eine Ausnahme machen?" Hier könnte man es noch verstehen, wenn einer nicht den andern die Diamanten aus Edelsinn wegnehmen will. Aber die Kommunion und die Gnade nimmt man nicht den anderen weg. Wenn die anderen töricht sind und den Wert der Kommunion nicht erkennen, musst du darum auch so unverständig sein und sie verschmähen?
Ein anderer sagt: "Ach, macht mir so viel Mühe." Dem antworte ich: "Wenn es dir zu viel Mühe macht, in die Kirche zu gehen, um den kostbaren Schatz in Empfang zu nehmen, so bist du geradeso töricht als ein armer Schlucker, für den auf der Bank eine große Summe Geldes bereit läge, das er heute beheben müsste und der sagte: "Das tue ich nicht, es macht mir so viel Mühe."
Ein anderer sagt: "Es muss ja nicht gerade die Kommunion sein. Ich tue ja sonst meine christliche Schuldigkeit, bete früh und abends, gehe an Sonn- und Feiertagen zur Messe, arbeite in guter Meinung und bringe so ein, was ich durch die Kommunion bekäme." Dass ist, mein lieber Freund, der du so sprichst, ein Arbeiter, der täglich fünf Mark verdient und sich gehörig dafür schinden muss. Ein Reicher bietet ihm einen kostbaren Diamanten an. Er aber sagt: "Ach was, das brauche ich nicht. Das bringe ich durch meinen Lohn ein." Dieser törichte Arbeiter bist du. Du armes Menschenkind willst durch deine geistliche Arbeit das allergrößte Geschenk einbringen, das dir der unendlich reiche Gott in seiner Güte nur geben kann? Wie du dich schmählich verrechnest!
Ein anderer sagt: "Das ist ja nur für Klosterleute!" Der Hl. Vater hat aber gesagt: "Es ist für Klosterleute, aber auch für alle Katholiken, die im Stand der Gnade sind und die rechte Absicht haben." Wenn der Hl. Vater eingeladen hätte, Diamanten zu empfangen, die in der Kirche verteilt würden und dabei nur Klosterleute erwähnt hätte, da würdest du wohl sagen: "Aber warum sollen wir Weltleute denn das nicht auch haben? Wir gehören auch geradeso zur Kirche wie Ordensleute. Ja, die brauchen es viel weniger als wir!" Ebenso solltest du hier sagen: "Mögen die Klosterleute schließlich nur jede Woche einmal zur Kommunion gehen. Wir Weltleute aber, die wir so vielen Gefahren ausgesetzt sind, den allerkostbarsten Schatz zu verlieren, müssen öfter gehen." Warum redest du nicht so? Weil du eben ein törichtes Weltkind bist, das über eitlem Tand die himmlischen Schätze geringschätzt.
Noch ein anderer sagt: "Ich finde mit dem besten Willen keine Zeit." Ja, das ist das alte Lied. Der seinen Meierhof besehen, seine fünf Joch Ochsen prüfen, bei seiner Frau bleiben wollte, hatte auch keine Zeit. Wenn ich dir sagte: "Von nun an werden täglich in der Kirche Tausendmarkscheine verteilt. Ich rate dir aber, ja nicht zu gehen. Du hast ja keine Zeit", da würdest du wahrscheinlich entrüstet ausrufen: "Keine Zeit? Um Himmels willen, ich habe ja Zeit im Überfluss, weiß nicht, was ich damit anfangen soll!" Für irdische und weltliche Angelegenheiten findet man schon Zeit, aber für den lieben Gott und um sich Schätze zu sammeln, die weder Rost noch Motten verzehren, findet man keine. Man ist eben ein törichtes Menschenkind, das über einem Haufen Flittergold den kostbarsten Diamanten verschmäht.
Überlege dir alles, was da gesagt worden ist, genau und ziehe daraus die Konsequenzen. Es ist dir die günstigste Gelegenheit geboten, reich zu werden, überreich. Sie dauert aber nur für eine Zeit, nämlich nur für dieses Leben. Nachher kommt die Ewigkeit. Was du in diesem Leben an Gnade erworben hast, besitzt du dann für immer, aber du kannst deinen geistlichen Reichtum auch nicht um einen Heller weiter vermehren. Wer damals in Südafrika gewesen wäre und die Diamanten, die er dort liegen sah, nicht gesammelt hätte, würde sein Leben nicht mehr froh. Jetzt bist du noch da im Land des Goldes und der Diamanten. Sammle, sammle eifrig, ehe du für immer davon scheiden musst. Alle, die der Einladung Pius X. gefolgt sind, und es sind ihrer sehr, sehr viele, werden als geistliche Millionäre in den Himmel einziehen, man möchte fast sagen, beneidet mit heiligem Neid von denen, die vorher gelebt haben, bevor dieser Papst nach dem Herzen Gottes die geistlichen Schatzkammern so weit geöffnet hat. Welcher Verlust für dich, wenn du nur Hunderte hast, da du auch wie so viele andere Millionen haben könntest. Die günstigste Gelegenheit zum herrlichsten Reichtum, den es gibt, hast du dann unbenützt vorübergehen lassen. Und die kommt nicht wieder. Ja, es könnte dir noch schlimmer ergehen. Die meisten Katholiken, die verloren gehen, trifft dieses unsagbare Unglück deshalb, weil sie nicht oft genug die heilige Kommunion empfangen haben. Der göttliche Heiland hat ja gesagt: "Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst, habt ihr das Leben nicht in euch." Es gilt hier auch das andere Wort des Herrn: "Jedem, der hat, wird gegeben werden, und er wird in Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er zu haben scheint, genommen werden." Auch du hast vielleicht zu wählen zwischen diesen beiden: überschwänglichem Reichtum oder unermesslichem Elend.
________________________________________________________________________

12. Unter sicherem Schutz - Von Margarete Cochet
An einem kalten, nebligen Winterabend eilte ein kleiner Junge durch eine der belebtesten Straßen von Paris. Er mochte wohl erst sieben bis acht Jahre zählen, doch nur allzu deutlich hatten bereits Not und Elend ihren unverkennbaren Stempel seinem zarten, lieblichen Gesichtchen aufgedrückt. Der zerrissene Anzug, der die kleinen schmächtigen Glieder kaum notdürftig bekleidete, vervollständigte den traurigen Anblick, den das Kind bot. Der Junge musste es wohl sehr eilig haben, denn ohne sich aufzuhalten, ohne auf die Vorübergehenden einen Blick zu werfen, eilte er hastig seinem Ziel, dem Ende der Straße zu.
Ach, er hatte auch wirklich keine Zeit zu verlieren. Schon seit einigen Tagen trug er sich mit der Absicht herum, einen Brief zu schreiben, aber allein konnte er es nicht zustande bringen, denn er hatte das Schreiben noch nicht erlernt. Für ihn hatte es bisher nur eine Schule gegeben, und das war die des Leidens gewesen. Der Brief jedoch musste um jeden Preis geschrieben werden, und darum begab sich das Kind, so schnell es seine kleinen Füßchen nur tragen konnten, zu einem jener Schreiber, die um geringen Lohn den Schreibunkundigen ihre Dienste zur Verfügung stellen und ihnen die nötigen Schriften besorgen.
Der Mann, zu dessen Wohnung der Kleine seine Schritte lenkte, hieß Lambert und war seinerzeit Soldat gewesen. Da er im Krieg keine allzu schweren Wunden davongetragen hatte, war ihm die Aufnahme in das Invalidenheim verweigert worden. Seinen jetzigen Beruf hatte er mehr aus Langeweile, als des Verdienstes halber gewählt. Das einsame Leben, das er als völlig alleinstehender Mann führte, behagte ihm nicht, ja es verursachte ihm manch bange, traurige Stunde, und er hatte deshalb gesucht, seine Zeit durch Schreiberdienste auszufüllen. Wenn er auch in dieser Hinsicht vielleicht seinen Zweck erreichte, so vermochte seine Beschäftigung doch nicht sein Herz auszufüllen. Das menschliche Herz bedarf eben auch eines Arbeitsfeldes, wo es die ihm von Gott so mannigfaltig verliehenen edlen Eigenschaften verwenden kann; dann erst findet es Freude und Befriedigung. Das war indes bei Lambert nicht der Fall. Sein vereinsamtes, nur gleichsam auf sich selbst angewiesenes Herz empfand eine unsagbare Leere, die vielleicht doppelt so fühlbar war, weil dem alten Soldaten mit den Jahren die Quelle wahren Trostes, die in der Erfüllung unserer religiösen Pflichten liegt, völlig fremd geworden war.
Auch in diesem Augenblick, da unsere Erzählung beginnt, saß er finster grübelnd vor seinem Schreibtisch und in seinen Zügen spiegelte sich seine düstere Gemütsstimmung nur allzu deutlich wieder.
Plötzlich wurde die Tür leise geöffnet und zwei ängstliche Kinderaugen blickten furchtsam in das strenge, bärtige Antlitz des alten Mannes.
Lambert hatte den Eintretenden bemerkt.
"Nun, komm nur herein, Kleiner", wandte er sich ermutigend an das Kind, "und sage mir, was du willst. Vor allem aber mache schön die Tür zu."
Zitternd gehorchte das Büblein und trat einige Schritte näher, nachdem es artig seine Mütze abgenommen hatte. Doch da es noch immer schweigend dastand, wiederholte Lambert seine Frage.
"Also, was willst du?" klang es etwas ungeduldig von seinen Lippen. "Ich soll dir wohl einen Brief schreiben, nicht wahr? Das kostet aber 50 Centimes, mein Junge, hast du so viel auch mitgebracht?"
Ach, wenn der kleine Joseph im Besitz von 50 Centimes gewesen wäre, stünde er wohl nicht vor dem Mann, der ihm so viel Angst einflößte!
Er stammelte irgendwelche unverständlichen Worte und wandte sich wieder zum Gehen.
Aber der Blick der großen, traurigen Augen des Jungen hatten sich einen Weg bis in die Seele des alten Mannes gebahnt und dort mit einem Mal eine längst, längst verklungene Saite berührt: die des Mitleids mit fremder Not.
"Bist du eines Soldaten Kind?" fragte er in freundlicherem Ton.
"Nein, ich bin meiner Mutter kleiner Sohn", antwortete Joseph etwas beherzter.
"Hast du nicht 50 Centimes mitgebracht?"
"Nein, denn Mütterchen hat keinen einzigen Centime mehr."
"Ach so! Nun fange ich an zu begreifen. Da willst du wohl an jemand einen Brief schreiben, um etwas zu bekommen?"
"Ja!" flüsterte das Kind, sichtlich erfreut, dass der Schreiber so seine Absicht erraten hatte.
"Ein Bogen Papier wird mich nicht ärmer machen", dachte Lambert, und die Feder zur Hand nehmend, schrieb er das Datum.
"Wie lautet die Adresse?" fragte er alsdann, sich an den Jungen wendend.
"An Frau - - - ? Nun, sprich schnell, wie heißt die betreffende Dame?"
"Welche Dame meinen Sie?" fragte der Kleine erstaunt.
"Na, welche andere sollte ich denn meinen, du kleiner Tölpel, als die, an die du zu schreiben wünschst?! Man wendet sich ja doch meistens nur an Frauen, wenn man ein Almosen erhalten will", brummte der alte Invalide leise vor sich hin.
Der Junge schien diese letzten Worte auch in der Tat nicht verstanden zu haben, denn er sagte nur:
"Es ist keine Dame."
"Gut, also ein Herr; wie lautet sein Name?"
"Es ist auch kein Herr."
"Junge, zum Teufel, so erkläre dich doch einmal deutlich", donnerte der alte Soldat. "An wen willst du denn schreiben? Meinst wohl, ich werde bis morgen hier zu deinen Diensten stehen?"
Eine jähe Blutwelle ergoss sich über das zarte Gesichtchen des Kindes. Dieser Mann da vor ihm flößte ihm gar so große Angst ein; am liebsten wäre er davongelaufen und zu seinem Mütterchen zurückgekehrt. Ach, aber gerade ihretwegen durfte er es nicht tun, der Brief musste geschrieben werden, sollte irgendwelche Rettung kommen. Seinen ganzen Mut daher zusammennehmend, stammelte er endlich:
"Ich möchte an den hl. Joseph schreiben, Herr Lambert."
Der ehemalige Soldat sprang von seinem Stuhl auf, warf die Feder auf den Tisch und maß den Jungen von Kopf bis Fuß mit drohendem Blick.
"Junge, mir deucht, du willst mich zum Narren halten", polterte der Mann, nur mühsam seinen Zorn bezwingend. "Du kannst deinem Schöpfer danken, dass du noch so klein bist, sonst würde ich dir mittels einer gehörigen Tracht Prügel meine Meinung zu verstehen geben, so aber sage ich dir nur: kehr um! und marsch hinaus!"
Wieder ging ein heftiges Zittern durch den kleinen Körper des Kindes, indes es sich abermals zum Gehen wandte. Aber noch hatte der Junge die Tür nicht erreicht, als ein Schluchzen und ein mühsam unterdrückter Schmerzenslaut, dem man deutlich das Wort "Mütterchen" entnehmen konnte, zu Ohren des Invaliden drang. Er wusste selbst nicht recht, was er tat, aber mit einem Mal stand er an der Seite des Kindes und hatte sein eiskaltes Händchen ergriffen.
"Komm, Kind, fürchte dich nicht", sagte er in einem Ton, dem man nichts mehr von der früheren Strenge anmerkte. "Du hast es gewiss vorhin nicht böse gemeint und darum will ich dir verzeihen. Doch nun erzähle mir alles ganz genau. Wie heißt du?"
"Joseph."
"Hast du keinen anderen Namen?"
"Nein; mein Mütterchen nennt mich nur immer so."
"Wo ist dein Vater?"
"Im Himmel, schon lange, lange Zeit; draußen blühten noch die Blumen, als die schwarzen Männer ihn wegtrugen. Und seitdem ist es so ganz, ganz anders bei uns geworden", setzte das Kind hinzu, und wieder glänzten Tränen in seinen großen, blauen Augen.
Lambert begann zu begreifen, und seine Stimme klang noch weicher, als er jetzt fragte:
"Und warum willst du denn gerade an den hl. Joseph schreiben, mein kleiner Mann?"
"Weil er so gut zum Jesuskindlein war und jetzt gewiss auch mir helfen wird, denn er heißt ja wie ich und ist mein Schutzpatron. Mütterchen sagt mir immer, wenn ich Kummer habe, so soll ich mich nur stets mit Vertrauen an ihn wenden. Sie sagt, das Jesuskindlein würde ihm jetzt im Himmel alle seine Bitten erfüllen, und wer sich unter seinen Schutz stelle, dem helfe er ganz bestimmt in jeder Not."
"Und um was willst du denn den hl. Joseph bitten?"
"Vor allem, dass er mein Mütterchen endlich aufweckt, die seit gestern Abend fortwährend schläft. Ich habe es selbst schon einige Male versucht, aber sie rührt sich trotzdem nicht. Dann möchte ich ihn auch um etwas Brot für mein Mütterchen und mich bitten. Ich bin so hungrig und sie wird es gewiss auch sein, wenn sie aufwacht. Bevor sie einschlief, gab sie mir das letzte Stückchen, sie selbst hatte schon zwei Tage nichts gegessen, weil sie nicht hungrig war, sagte sie."
Was wohl dem alten Krieger plötzlich fehlte, dass er sich so hastig mit der Hand über die Augen fuhr? . . .
Ach, er hatte über sein trauriges, einsames Leben gemurrt, hatte sich beklagt, nichts von Freude und Glück zu wissen, und was hatte erst dieses arme kleine Wesen zu erdulden gehabt? Was war erst sein Leben gewesen? Es hatte von Hunger gesprochen. Hunger? - den wenigstens hatte er, Lambert, trotzdem mehr denn ein halbes Jahrhundert auf seinen Schultern lastete, niemals gekannt. Und hier war dem Hunger, allem Anschein nach, ein Menschenleben zum Opfer gefallen, denn . . .
"Was hast du getan, um dein Mütterchen aufzuwecken?" fragte der Soldat, den Jungen mit mitleidsvollem Blick betrachtend.
"Ich habe sie wie immer bei der Hand gefasst, sie umarmt und gerufen, aber es hat nichts geholfen."
"Hast du ihren Atem gefühlt?"
"Ich weiß es nicht. Muss man denn immer atmen?"
Lambert konnte bei dieser kindlichen Frage ein schwaches Lächeln nicht unterdrücken, aber es erhellte nur vorübergehend seine Züge. Ihm war das Leben nie so bitterernst und traurig erschienen, wie in diesem Augenblick.
"War die Hand deiner Mutter warm, als du sie in die deine nahmst?" fragte er weiter, das blonde Köpfchen des Kindes streichelnd.
"Ach nein, sie war sehr kalt, aber wir hatten es immer kalt, denn Mütterchen besaß kein Geld, um Holz zu kaufen."
Mehr brauchte Lambert nicht zu fragen. Er hatte genug gehört, um zu wissen, dass Josephs Mutter in einen Schlaf versunken war, aus dem es auf dieser Welt kein Erwachen mehr gibt. Josephchen war also eine Waise geworden! Was sollte jetzt aus dem armen, alleinstehenden Kind werden? . . . Alleinstehenden? . . . O, wer wusste es besser als er, wieviel Trauer und Bitterkeit in diesem einzigen Wort enthalten ist?!
Lambert lehnte sich in seinen Sessel zurück und sein Blick schien in die Ferne zu schweifen. Ja, er hatte das Kind an seiner Seite anscheinend völlig vergessen, um sich mit irgendwelchen Gedanken zu beschäftigen. Diese mochten wohl plötzlich eine freudigere Wendung genommen haben, denn sein Blick bekam auf einmal gleichsam einen verklärten Ausdruck, als er ihn nach längerer Pause dem Jungen wieder zuwandte. Im nächsten Augenblick rückte er näher an seinen Schreibtisch heran und zeichnete einige Zeilen auf einen Papierbogen.
"So", sagte er nach einigen Minuten mit bewegter Stimme, "der Brief an den heiligen Joseph ist geschrieben und gewiss wirst du auch bald die Antwort erhalten. Und nun komm, du sollst zuerst deinen Hunger stillen und dann wirst du mich zu deinem guten Mütterchen führen."
* * *
Der ehemalige Soldat hatte sich nicht getäuscht. Josephs Mutter weilte nicht mehr unter den Lebenden, sie war, wie er es richtig geahnt hatte, in der Tat der Not und dem Elend zum Opfer gefallen.
Nachdem Lambert sich vom Tod der armen Frau überzeugt hatte, fiel ihm die schwere Aufgabe zu, dem Kind seinen herben Verlust begreiflich zu machen. Doch mit Gottes Hilfe sollte dieser neue Schmerz, der ihn traf, soviel als möglich gelindert werden. Ja, mit Gottes und des hl. Josephs Hilfe, denn ohne Zweifel war es letzterer gewesen, der ihm, Lambert, den Gedanken, den er auszuführen im Begriff stand, eingegeben hatte. Auf diese Weise wollte er das Vertrauen seines kleinen Schutzbefohlenen lohnen.
Der Schreiber nahm den Jungen, der unruhig in das blasse, hübsche Antlitz seiner regungslos daliegenden Mutter blickte, in seine Arme und sagte mit einer Stimme, aus der das zärtlichste Mitleid klang:
"Dein liebes Mütterchen ist jetzt auch im Himmel und wird erst dort aufwachen und auf dich warten, bis du ebenfalls hinkommst, mein lieber, kleiner Junge. Dafür wird aber nun der hl. Joseph doppelt für dich sorgen und hat mich bereits dazu bestimmt, dir dein Mütterchen zu ersetzen. Du wirst fortan bei mir wohnen und mich nicht mehr verlassen. Ist es gut so, Josephchen?"
Bei der Nachricht, dass seine Mutter erst im Himmel aufwachen, und er sie, wie den Vater, nicht mehr sehen sollte, war das Kind in heftiges Schluchzen ausgebrochen; doch bei den letzten Worten Lamberts hielt es plötzlich im Weinen inne, sah seinen Freund halb erstaunt, halb ängstlich an und fragte:
"Hat der hl. Joseph denn schon geantwortet?"
"Ja, mein Kind; er hat mir zu verstehen gegeben, dass deine Mutter im Himmel so viel glücklicher ist, da sie dort nie an Kälte und Hunger leiden wird. Ich aber soll von nun an für dich sorgen, dich vor allem Bösen bewahren, mit einem Wort dir ein zweiter Vater sein", entgegnete der alte Krieger ernst.
"Dann bin ich zufrieden", meinte das Kind mit rührender Ergebung, "denn Mütterchen sagte ja immer, ich soll mich niemals fürchten, der hl. Joseph würde stets alles gutmachen und mich nicht verlassen. Und ich will auch gern dein kleiner Sohn sein", schloss das Knäblein und presste seine feuchten Wangen an die Brust seines Pflegevaters.
Und in der Tat, der hl. Joseph hat alles gut gemacht; doch nicht allein für den Waisenjungen, sondern auch für den Mann, der sich vor kurzem noch so einsam und verlassen fühlte.
Joseph hatte in Lambert einen zärtlichen Vater gefunden, der mit rührender Liebe an dem ihm auf so seltsame Weise anvertrauten Kind hing. Diesem aber verdankte der ehemalige Soldat die sonnigsten und freudigsten Tage seines Lebens, Nun hatte sein Herz etwas gefunden, was es voll und ganz ausfüllte: das Glück in der Ausübung der herrlichsten Aufgabe, die dem menschlichen Herzen von Gott gestellt wird: die Hingabe seiner selbst zum Wohl des Nächsten. Kein Wunder, dass in dem Herzen des alten Soldaten nun der Drang erwachte, auch seinem obersten Kriegsherrn die erforderliche Huldigung darzubringen.
Es war daher kein seltener Anblick mehr, Lambert in Begleitung seines kleinen Schutzbefohlenen, dem er auch diese Quelle wahren Glücks verdankte, dem hl. Messopfer beiwohnen zu sehen. Täglich aber sah man sie, besonders im Monat März, vor dem Altar des hl. Joseph knien, ein inbrünstiges Dankgebet zu dem sprechend, den wir mit so viel Recht als unseren liebevollen Fürsprecher und mächtigen Schutzpatron anrufen.
________________________________________________________________________

13. Die Freimaurerin - Von R. Pontis
1.
Madame Anais Morgan geht sinnend in ihrem Arbeitszimmer auf und ab. Zuweilen bleibt sie vor dem Schreibtisch stehen und wirft in aller Eile ein Wort oder einen Satz auf ein Blatt Papier. Sie bereitet sich auf ihre Rede vor, die sie am Nachmittag im Frauentheater der Elysäischen Felder in Paris halten soll. Seit einem Monat hält sie jeden Montag eine Konferenz über das so brennende Thema der bürgerlichen und politischen Gleichstellung der Frau mit dem Mann in der modernen Gesellschaft. Die Tagesblätter, die ihre Theorien besprechen, verwerfen und verdammen sie, doch alle, ohne Ausnahme, erkennen der Rednerin ein großes Talent zu und bedauern, dass sie es nicht in den Dienst einer besseren Sache stellt.
Allein Anais lässt nicht ab von ihrem Lieblingsthema. In ihrer letzten Konferenz hatte sie einen glänzenden Erfolg zu verzeichnen. An der Hand der Geschichte hatte sie den Einfluss der Frauen auf den Gang der Weltereignisse nachgewiesen, besonders hob sie die Tatsache hervor, dass die Länder, die das Glück hatten, von Frauen regiert zu werden, unter ihrem segensreichen Zepter stets eine wahre Friedens- und Glanzepoche erlebten, während dies nur ausnahmsweise unter den Königen und Kaisern der Fall war.
"Wenn nun die Frauen", schloss sie, "imstande sind, das höchste Amt eines Landes, das der Herrscherin, zum Glück der Bevölkerung zu bekleiden, so sind sie sicherlich auch dazu geeignet, weniger bedeutende Ämter zur Zufriedenheit aller zu verwalten. Also Gleichstellung der Frau in der Ausübung der öffentlichen Ämter."
Heute wollte sie weitergehen. Unter dem Titel: "Die Sybillen der dritten Republik" hatte sie eine vierte Konferenz angekündigt. Sie wollte die Beweise erbringen, dass, wenn Frankreich seit einigen Jahren die Bahn des wahren Fortschritts betreten und die Emanzipation der Geister von jedem religiösen Glauben angestrebt habe, es dies den Frauen verdanke.
Aber auch in der Presse kämpfte Frau Anais Morgan für ihre gute Sache. Der Direktor der illustrierten Wochenschrift "Femina" hatte der berühmten Agitatorin die Spalten seiner Zeitschrift zu Verfügung gestellt, und jede Woche veröffentlichte Frau Anais einen Artikel über den zukünftigen Frauenstaat. Die letzte Nummer von "Femina" lag aufgeschlagen auf dem Tisch. Ein Neugieriger hätte in Frau Morgans Artikel: "Der Frauenstaat ein Idealstaat" unter anderen folgende seltsame Sätze lesen können:
"Sobald den Frauen die Leitung der Weltangelegenheiten in die Hand gegeben sein wird, verschwindet der Krieg, diese furchtbare Geißel der Menschheit aus der Welt, denn die liebenden Herzen der Ministerinnen werden schon Mittel und Wege ausfindig machen, allen Streitfragen eine friedfertige Lösung zu geben, während die Herrscher und ihre Minister heute Millionen von Jünglingen und Männern, unsere Söhne und Gatten, mit kaltem Blut abschlachten lassen, um ihren gekränkten Stolz und ihren grenzenlosen Ehrgeiz zu befriedigen."
"Wem ist jener himmelschreiende Skandal noch nicht aufgefallen, dass ein Preis von 50- bis 200.000 Franken einem Millionär, dem Eigentümer eines Pferdes zuerkannt wird, das als erstes in einem Wettrennen ankam, oder weil es das schönste in einer Ausstellung ist? Eine arme Frau aber, die mit ihren Kindern Not leidet, speist man mit einigen Pfennigen ab."
"Die Religion, sagen die Männer, ist gut für die Frauen. Es folgt daraus, dass sie für die Männer nicht gut, folglich schlecht ist. Ist sie aber schlecht für die Männer, so ist sie auch schlecht für die Frauen, die ja aus derselben Substanz wie die Männer bestehen, sie muss deshalb abgeschafft werden."
Aber wo Anais Morgan in ihrer ganzen Herrlichkeit thront, das ist in der von ihr gegründeten Loge "Zur Emanzipation". Es ist eine Zwitterloge, denn sie nimmt auch die Männer der Freimaurerinnen auf. Jeden Abend begibt sich Frau Anais in ihre Loge. Dort donnert sie gegen die Politiker, die die Frau wie eine Paria behandeln, indem sie ihr nur Pflichten auferlegen, aber keine Rechte einräumen wollen, und gegen die Religion, die die Frau dem Mann unterordnet. Die Abschaffung der Religion war der erste Artikel ihres Programms. "Gott", pflegte sie zu sagen, "besteht gar nicht. Der Himmel ist ein Phantasiegebilde und die Hölle eine Erdichtung der Geistlichen. Der Mensch ist weiter nichts als ein vergänglicher Körper, der nach dem Tod auseinanderfällt und in den großen Kreislauf der Natur eintritt, um andere Körper zu bilden."
Frau Morgan hatte sich eben in einen Lehnstuhl niedergelassen, als es an der Tür klopfte. Es war die Kammerfrau. Sie brachte die Morgenpost: fünf oder sechs Tagesblätter, zwei Zeitschriften und etwa ein Dutzend Briefe. Madame Anais legte die Zeitungen und Zeitschriften beiseite und begann mit der Lektüre der Briefe. Die auffallenden Sätze las sie mit lauter Stimme:
"Marseille. - Wir sind hier 40 bis 50 Frauen, die entschlossen sind, in Ihre Fußstapfen einzutreten und unserem verkannten Geschlecht zu seinen Rechten zu verhelfen. Möchten Sie daher der Inauguration unserer Loge "Zum Frauenreich", die nächsten Samstag stattfindet, beiwohnen?"
"London. - Unsere Liga bedauert lebhaft, nicht auf Ihre werte Anwesenheit auf unserem Monstremeeting in Hyde-Park zählen zu können. Wir werden allesamt Sr. Exzellenz dem Premier-Minister unsere gerechten und billigen Forderungen überbringen. - Die Präsidentin der Frauenrechte."
"Toulouse. - Die "Depesche von Toulouse" bittet Sie um einen Artikel für nächste Woche über die Frauenbewegung in der Hauptstadt."
"Paris. - Erlaube mir Ihre Aufmerksamkeit auf einen empörenden Akt der Grausamkeit hinzulenken. Ein Mann, namens Joseph Labrute, hält seine Frau, einen wahren Engel, seit einer Woche in seinem Keller eingesperrt. Ihrer hohen Intervention bei den kompetenten Behörden wird es sicherlich gelingen, diesem Skandal ein Ende zu machen."
2.
In diesem Augenblick öffnet sich die Tür und herein trat eine kleine, schmächtige Mädchengestalt im weißen, mit Spitzen besetzten Musselinkleid. Es war Odette, Frau Morgans Tochter.
"Schon von deiner Morgenpromenade zurück, Kleine?"
"Ja, Mütterchen, aber sag mal, was ist das, die Kommunion?"
"Hat man zu dir denn von der Kommunion gesprochen?"
"Ja, wir spielten im Park Monceau. Da war auch die Lucie Maupin, die geht nächstes Jahr zum ersten Mal zur Kommunion, und sie lernt in einem Buch, das sie den Katechismus nennt, um, wie sie sagt, sich würdig darauf vorzubereiten."
"Die Kommunion ist eine Süßigkeit, die die Priester den katholischen Kindern geben, wenn sie artig sind."
"Aber was ist der Katechismus?"
"Das ist ein Buch, in dem die Fabeln der Religion erzählt sind, wie die Mythologie der Griechen in deiner Geschichte, die du auswendig lernst."
"Und warum lerne ich die Fabeln der Katholiken nicht? Sind sie schön?"
"Sie sind schwerer wie die der Griechen, und wenn du größer bist, magst du sie lesen."
"Und die Lucie geht auch jeden Tag mit ihrer Mutter in die Messe. Was ist das, die Messe?"
"Die Messe? Ein andermal, Kind, meine Zeit ist kurz. Geh jetzt hinauf und studiere mit deiner Lehrerin."
Odette ging hinauf in ihr Zimmer.
Am Mittag war die ganze Familie bei Tisch versammelt: der Vater, die Mutter und die Tochter. Beim Nachtisch erzählte Herr Morgan, er sei bei dem Platzregen in die Kirche St. Sulpice eingetreten. Dort habe er Frau Favart mit ihren Kindern gesehen, die alle der Messe beiwohnten.
"Papa", unterbrach Odette, "was ist das, die Messe? Mama konnte es mir heute morgen nicht sagen, sie hatte keine Zeit."
"Die Messe, mein Kind", erwiderte die Mutter, "ist so etwas wie eine Theatervorstellung, aber für die Katholiken ist sie ein Opfer. Nach ihrem Glauben opfert sich Christus in der Messe für sie auf, um ihnen von seinem himmlischen Vater allerlei Gutes zu erwirken."
"Christus! Wer ist das, Mama? Und wer ist sein himmlischer Vater?"
"Es würde zu weit führen, dir das alles zu erklären", entgegnete die Mutter, "übrigens würdest du nichts davon verstehen. Es genüge dir einstweilen zu wissen, dass Gott der Vater für die Katholiken das ist, was Zeus für die Griechen und Jupiter für die Römer war. Aber das alles ist eine Fabel, und diejenigen, die daran glauben, sind betrogene Kreaturen und Schwachköpfe."
"Frau Favart ist also eine betrogene Frau?"
"Ja, mein Kind, und man muss sie bemitleiden, denn sie weiß es nicht besser."
"Wer hat sie denn diese Betrügereien gelehrt?"
"Die Priester."
"Und warum wirft man nicht die Priester ins Gefängnis wie die anderen Betrüger?"
"Die Leute wollen betrogen sein, und sie lieben ihre Betrüger."
"Mama, du hast gesagt, die Leute, die an diese Fabeln glauben, seien Schwachköpfe. Paul Maupin glaubt daran, und er ist der Erste in seiner Klasse, er hat es mir heute morgen im Park Monceau gesagt."
"Man kann an die Fabeln der Religion glauben und dennoch gescheit in anderen Dingen sein."
Zum Glück war das Mahl zu Ende, denn Odette würde ihrer Mutter vielleicht noch andere verwirrende Fragen gestellt haben.
"Odette", sagte daher die Mutter, "du kommst heute Nachmittag mit mir ins Frauentheater. Gehe deshalb hinauf und sage der Kammerfrau, dass sie dich umkleidet."
Als Odette fort war, meinte der Vater:
"Das Kind fängt an schrecklich zu werden mit seinen Fragen über die Religion. Es wäre vielleicht besser, wir ließen es wie die anderen Kinder erziehen."
"Durchaus nicht, wenn wir die Menschheit erneuern wollen, müssen wir mit unseren eigenen Kindern anfangen. Wenn es groß ist, mag es die Religion studieren, wenn es Lust dazu hat. Übrigens gedenke ich ein Buch über die konfessionslose Erziehung der Kinder zu schreiben, und dazu bedarf ich der Erfahrung, und die kann die Erziehung meines eigenen Kindes mir nur geben."
Frau Morgan hatte gesprochen, der Herr hatte sich nur zu fügen. Herr Morgan war ein echter Pantoffelheld. Seine Frau, die ihm geistig weit überlegen war, führte das Regiment im Haus. Sie war eine gefeierte Schauspielerin gewesen, als Herr Morgan, ein reicher Müßiggänger, sie heiratete. Frau Morgan verließ die Bretter und ging unter die Blaustrümpfe. Ihre Broschüren über die Frauenemanzipation machten Sensation und schufen ihr einen bedeutenden Anhang in der Frauenwelt, besonders unter jenem Teil der Frauen, die eine neue Gesellschaft träumen, worin sie die ersten Rollen spielen würden. Um ihre Ideen noch weiter zu verbreiten, schuf sie die Zwitterloge "Zur Emanzipation" und wurde Konferenzlerin. Herr Morgan begleitete sie überall auf ihren Triumphzügen. Er sonnte sich im Glanz seiner Frau. Beide waren katholisch erzogen worden, doch hatten sie im Trubel der Hauptstadt schon vor ihrer Heirat jeden Glauben eingebüßt. Ihre Tochter ließen sie taufen, vielleicht hatten sie damals auch die Absicht, sie christlich erziehen zu lassen.
Als Frau Morgan am Nachmittag nach ihrer Konferenz im Konversationssaal des Frauentheaters erschien, wurde sie von den Herren und Damen ihrer Bekanntschaft zu ihrer Rede beglückwünscht. Unter ihnen befanden sich Abgeordnete, Senatoren, Akademiker, ein Dutzend Schriftstellerinnen und alle Mitgliederloge "Zur Emanzipation". Odette war auch da. Sie wurde, wie gewöhnlich, gehätschelt und geliebkost.
Herr Provost, ein Akademiker, hatte eben der Mutter seine Aufwartung gemacht und sich nach dem Stand der Kenntnisse der Tochter erkundigt. Wie alle Mütter, so war auch Frau Morgan stolz auf ihre Tochter, und um dem gelehrten Akademiker einen Beweis von ihrem Talent zu geben, forderte sie Odette auf, dem Herrn Provost ein Gedicht aufzusagen. Es bildete sich sogleich ein Kreis um das Kind, das mit anmutiger Stimme folgendes Gedicht in französischer Sprache deklamierte:
Emanzipation ist das Losungswort
Der neuen Weltordnung.
Auf den Flügeln der Freiheit,
Vom Lichte der Vernunft geleitet,
Aller Fesseln des Glaubens ledig,
Schweben wir durchs Leben.
Auf den Trümmern der Religion
Bauen wir unsere Gesellschaft auf.
Keines fabelhaften Gottes bedürfen wir.
Die Hölle schaffen wir ab,
Und auf Erden errichten wir
Den Himmel der neuen Menschheit.
Die arme Odette! Sie war zehn Jahre alt und kannte weder den lieben Gott, noch seine hochgebenedeite Mutter, noch ihren Schutzengel. Sie wusste nichts vom Himmel und von der Hölle. Man hatte sie gelehrt, das Dasein Gottes zu leugnen, und sie leugnete es. Sie war ein Krauskopf mit schwarzem Haar und großen, blauen Augen. Auf ihren bleichen Zügen lag eine tiefe Melancholie ausgebreitet. Es war wie der Widerschein eines ungestillten Sehnens nach etwas Höherem als nach diesem eitlen Tand und Flitterglanz, womit man sie umgab. Fast jeden Abend begleitete sie ihre Mutter in die Loge, in deren Register sie bereits als Freimaurerin eingeschrieben war. Ihr Leben rauschte dahin wie ein Wirbelwind. Ihr Geist schmückte sich zwar mit Kenntnissen, allein ihr Herz blieb leer.
Der Akademiker lobte ihre Aussprache und das Gefühl, das sie in ihre Deklamation legte, und nahm Abschied von Frau Morgan.
Als Mutter und Tochter eine halbe Stunde später nach Hause fuhren, mussten sie an einer Straßenecke anhalten, um einen Leichenzug vorüberzulassen.
"Mama"; fragte Odette, "wohin geht man, wenn man tot ist?"
Die Mutter sah ihre Tochter betroffen an.
"Man kehrt ins Nichts zurück, woher man gekommen ist", erwiderte sie dann etwas zögernd.
"Ins Nichts? O, dann möchte ich nicht sterben", murmelte Odette schaudernd.
3.
Bleich und fiebernd liegt Odette in ihrem kleinen Bett des elterlichen Hauses. Ihr Puls jagt und ihr Atem geht schwer. Auf dem Boden liegen weiche Teppiche, um die Schritte der ab- und zugehenden Personen zu dämpfen; am Fenster hängen lange herabwallende Gardinen, sie wehren den Sonnenstrahlen den Eintritt und hüllen alles in ein mystisches Halbdunkel. Am Bett stehen angstvoll und stumm, die Augen auf das Spitzenbett gerichtet, die Eltern. Das Kind hatte sich vor einigen Tagen, als es mit seiner Mutter in offener Kutsche spät abends aus der Loge nach Hause kam, erkältet. Der am folgenden Morgen herbeigerufene Arzt stellte eine Lungenentzündung fest. Die Krankheit nahm bald einen schlimmen Charakter an. Es war schon der siebente Tag, und noch hatte sich keine Besserung eingestellt. Noch mehr: Die Ärzte hatten erklärt, wenn heute keine Wendung eintreten würde, so wäre alles zu befürchten.
Die gesetzte Frist war eben abgelaufen, und die Krankheit machte furchtbare Fortschritte. Vielleicht eine Stunde noch und Odette war eine Leiche, und ihre Seele erschien vor Gott, von dem sie keine Ahnung hatte. Der Vater dachte in diesem Augenblick an die furchtbare Verantwortung, die auf ihm lastete. Sein Gewissen war erwacht. Ungestüm forderte es ihn auf, die letzten Momente, die seine Tochter noch zu leben hatte, zu benutzen, um ihr von Gott zu sprechen.
"Wie wäre es", sagte er mit furchtsamer, bittender Stimme zu seiner Frau, "wenn wir den Priester rufen ließen, um das Kind auf den Tod vorzubereiten?"
Frau Morgan zuckte die Achseln ohne zu antworten.
"Man hat Beispiele", fuhr der Vater fort, der sich jetzt der Lehren der Religion erinnerte, "wo die letzte Ölung eine körperliche Heilung bewirkte. Vielleicht -"
Er wagte es nicht, seinen Satz zu vollenden. Seine Frau sah ihn kopfschüttelnd an. Die Ärzte hatten das Kind aufgegeben, und sie glaubte nicht an Wunder.
"Ein Priester mit den Sterbesakramenten in unserem Haus!" erwiderte sie. "Bist du toll? Was würde die Welt dazu sagen?"
"Und ich will mein Kind retten, ich will, dass es zu Gott kommt, denn Gott lebt, trotz unseres Leugnens!"
Und er schritt hinaus, um der Kammerfrau den Befehl zu geben, schnell einen Priester zu holen.
Als er hinaus war, horchte die Mutter einen Augenblick auf die sich entfernenden Schritte.
"Odettchen", sagte sie dann, "hörst du mich?"
"Ach, Mutter, - ich habe Feuer in der Brust, - und ich fürchte - mich vor dem Tod, - vor dem Nichts", wimmerte Odette mit abgebrochenen Worten.
"Willst du nicht zu Gott beten?"
Odette richtete sich halb auf und sah ihre Mutter mit großen, fieberglühenden Augen an.
"Beten!" stieß sie hervor. "Ich kann nicht beten. - Du hast ja immer gesagt, - das Gebet sei eine Dummheit, - und Gott bestehe nicht. - Warum muss ich jetzt beten?"
Diese Worte schnitten der Mutter durch die Seele. Das war ihre Strafe. Sie ließ sich in einen Lehnstuhl nieder und rang in dumpfer Verzweiflung die Hände.
Bald danach ging die Tür auf, und Herr Morgan trat mit dem Priester ein. Er führte ihn an das Bett seiner Tochter. In ihrem Lehnstuhl stöhnte die Mutter. Unverständliche Laute drangen über ihre Lippen.
Der ehrwürdige Geistliche wollte einige Worte der Hoffnung an Odette richten, aber er hatte keine Zeit dazu. Kaum hatte das Mädchen ihn erblickt, so rief es mit übernatürlicher Anstrengung:
"Ein Betrüger! Ich will nicht betrogen sein!"
Sie wollte noch mehr sagen, allein ein furchtbarer Hustenanfall verhinderte sie daran. Vergebens rang sie nach Luft. Der Husten krampfte ihr den Hals zusammen. Einige Augenblicke noch, und sie sank in die Kissen zurück - eine Leiche.
Der Priester kniete nieder und empfahl dem Gott der Barmherzigkeit ihre Seele.
Es dauerte mehrere Jahre, ehe die unglücklichen Eltern sich von diesem furchtbaren Schlag erholten. Frau Morgan erschien nicht mehr in der Loge, und ihre Konferenzen fielen bald der Vergessenheit anheim. Sie zog sich gänzlich von der Welt zurück, um ihrem Gram und ihrem Schmerz zu leben. Bald trat die Religion mit ihren hoffnungsvollen, trostreichen Verheißungen wieder vor ihren in den Qualen des Unglaubens sich windenden Geist und stimmte ihr Herz weicher. Endlich kehrte sie zu den Ausübungen der Religion zurück. Heute wohnt sie mit ihrem Mann regelmäßig jeden Tag der Messe bei, geht häufig zur heiligen Kommunion und bereitet sich auf einen christlichen Tod vor, denn auch ihr graut vor dem Nichts. Ihre freie Zeit verwendet sie darauf, die armen, verlassenen Kinder des Volkes in den Vorschriften der Religion zu unterrichten und sie des Sonntags in die Kirche zu führen.
________________________________________________________________________

14. Ave Maria!
In Coimbra, einer Stadt in Spanien, predigte einstmals ein frommer Ordensmann auf offener Straße. Viel Volk war um den greisen Pater geschart und auch die Kinder fehlten nicht. Mit Neugierde und Dreistigkeit drängten sie sich dicht an den Ordensmann heran. Er sprach mit großer Begeisterung von unserem göttlichen Heiland, wie er als kleines Kindlein so arm geboren werden wollte, dass sogar sein erstes Bettlein, die Krippe, ein geborgtes war. Und als er dann auch von Maria, der reinsten, heiligsten Mutter, gesprochen hatte, die gewürdigt worden war, das Gotteskind zu betreuen und zu pflegen, forderte der gute Pater alle Zuhörer beim Schluss seiner Rede auf, zu Ehren der Mutter Gottes laut ein Ave Maria zu beten und zwar mit gefalteten Händen.
Doch nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder scheuten sich alle, laut auf dem Marktplatz zu beten. Die Hintersten entfernten sich und die Kinder wurden rot, sahen sich verschämt an und - schwiegen.
Da erfasste den Ordensmann ein tiefes Weh, dass niemand seinen Mund öffnete, um Maria zu preisen, und rief: "Will denn niemand die Gottesmutter grüßen?"
Wie die feigen Menschen alle noch schweigen, erhebt sich plötzlich ein ganz kleines Kind, das bisher noch wenig sprechen konnte und fängt an zu beten: "Gegrüßet seist du, Maria!"
Noch hat es die kleinen Hände fromm gefaltet und das herrliche Gebet nicht vollendet, da fallen, von Reue ergriffen und tief beschämt, die übrigen ein und beteten mit dem unschuldigen Kindlein: "Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen." -
Wir alle, groß und klein, wollen immer und überall dazu beitragen, dass das Lob und der Preis unserer himmlischen Mutter stets erschalle. Öffentlich in der Kirche oder im stillen Gebet und besonders auch während des Maimonats mögen unsere Lippen recht oft wiederholen: "Ave Maria", und ohne Scheu wollen wir singen und es bekennen: "Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn!
________________________________________________________________________

15. Mariens Macht
Einen auffallenden Beweis von der Macht der Fürbitte Mariens bildet folgendes Ereignis, das ein französischer Geistlicher als Augenzeuge folgendermaßen berichtet: In einem der römischen Spitäler befand sich am 23. September 1848 ein französischer Infanterist, den eine tödliche Krankheit allmählich seinem Ende entgegenführte. Schon vierzehn Tage hatte er da gelegen und jede Tröstung der Religion mit Verachtung zurückgewiesen, als ich das erste Mal an sein Schmerzenslager trat. Aus Klugheitsrücksichten vermied ich es bei meinem ersten Versuch, mit ihm von Religion zu sprechen. Einige Tage später benutzte ich jedoch eine günstige Gelegenheit, ihn zu ermahnen, seine Gedanken und sein Herz Gott zuzuwenden.
"Lassen Sie mich in Ruhe!" erwiderte er mir finster und unwillig, "ich bin Protestant, gehen Sie fort!" Ich zog mich sofort zurück und nahm meine Zuflucht zur Himmelskönigin, der ich diesen unglücklichen Kranken in heißem, dringenden Gebet empfahl. Auch die Schwestern vom heiligsten Herzen und andere fromme Seelen beteten mit mir für die Bekehrung dieses armen, verstockten Sünders.
Am 26. Oktober verließ ich die Maria gewidmete Kapelle der genannten Ordensfrauen, um einen neuen Versuch zu machen, den Widerspenstigen für den Himmel zu gewinnen. Ich trug eine geweihte Medaille der allerseligsten Jungfrau bei mir und hoffte von der Macht und Fürbitte Mariens den besten Erfolg. Ich fand den Kranken fast mit dem Tode ringen, aber in religiöser Beziehung um nichts besser gestimmt als früher. Er hatte noch kurze Zeit zuvor einem seiner Kameraden das Geständnis gemacht, er sei gar nicht Protestant, habe sich jedoch dafür ausgegeben, um die beständige Zudringlichkeit hinsichtlich des Empfangs der Sterbesakramente ein für allemal los zu werden. Ich setzte alles, was Vernunft mir an die Hand gab, in Bewegung, um den Kranken auf bessere Gesinnungen zu bringen; allein alles vergeblich. "Gehen Sie, gehen Sie", war das einzige Wort, das über die Lippen des Kranken kam und mein und seiner Kameraden Herz tief verwundete. Endlich warf ich mich zu Füßen des Kranken auf die Knie und betete still zu Maria für die Seele dieses Unglücklichen. Nach einer kleinen Weile erhob ich mich und sprach, die Medaille in der Hand, zum Sterbenden: "Mein Freund, da du nun einmal nicht beichten willst, so nimm wenigstens diese Medaille an; erlaube mir, dass ich sie dir umhänge." "Die Medaille! - nun, meinetwegen; das ist etwas ganz anderes; tun Sie damit, wie Ihnen beliebt. Aber Ihre Medaille wird mich nicht beichten machen; beichten werde ich unter keiner Bedingung." - Nach diesen Worten neigte der Kranke das Haupt vom Kissen nach vorn, damit ich ihm die Medaille anlege. Kaum ruhte sie aber auf diesem harten verstockten Herzen, so war es auch umgewandelt. Der Kranke seufzte tief auf; dieser Seufzer verkündigte den Triumph der Gnade. "Nun, mein Freund", sprach ich, die glückliche Veränderung bemerkend, "nun, willst du jetzt beichten?" "Ja, mein Herr, ich will beichten. Kommen Sie morgen wieder, dann werde ich Ihnen meine Beichte ablegen." - "Aber warum nicht sogleich, da Gott dir jetzt diesen guten Gedanken eingibt?" - "Ja, Sie haben recht. Helfen Sie mir." Hierauf begann er die Beichte und vollendete sie mit bewundernswerter Geistesgegenwart. Eine halbe Stunde danach empfing er die heilige Wegzehrung samt der hl. Ölung, und vierzig Stunden später verschied er in großer Seelenruhe und heiliger Andacht.
________________________________________________________________________

16. Maria, Heil der Kranken
Nach einem äußerst strengen und lange andauernden Winter hatte endlich der ersehnte Frühling seinen Einzug gehalten. Die Sonne sandte ihre erwärmenden und belebenden Strahlen auf die Erde hernieder, die ganze Natur erwachte wieder zu neuem Leben, und die Herzen der Menschen jubelten auf vor Lust und Wonne.
In der Familie des Tischlermeisters Franz Köhler herrschte indes eine gar trübselige Stimmung. Eine schwere Krankheit hatte den Vater heimgesucht und den ganzen Winter an das Bett gefesselt. Infolge seiner Arbeitsunfähigkeit geriet das Geschäft ins Stocken, und die Ersparnisse, die der fleißige und solide Mann in seinen gesunden Tagen erübrigt hatte, waren während der schweren Zeit verbraucht worden. Jetzt wieder genesen, hätte er gern durch verdoppelten Eifer den erlittenen Verlust wieder ausgeglichen, aber es fehlte an Aufträgen, die Kundschaft hatte sich während seiner Krankheit zurückgezogen.
Dazu gesellte sich ein neuer Unglücksfall, indem auch die Mutter von einem tückischen Leiden ergriffen wurde.
Der zu Rate gezogene Arzt machte ein bedenkliches Gesicht und erklärte: "Ein schweres Magenleiden, das nur durch eine glückliche Operation geheilt werden kann."
Köhler seufzte tief auf: "Ja, wenn wir dazu die Mittel hätten! Wieviel ist hierzu erforderlich?" fragte er in gepresstem Ton. "Operation und eine längere, sorgsame Pflege im Hospital werden mindestens zweihundert Mark kosten", gab der Arzt zur Antwort. Der arme Mann schaute seine Frau wehmütig an, und sie verstand seinen Blick. Zweihundert Mark! Wie konnten sie in ihrer jetzigen Lage diese Summe aufbringen? Zwei schon erwachsene Töchter unterstützten zwar die Eltern nach Kräften, aber deren Verdienst reichte kaum hin für den notwendigen Lebensunterhalt. Von Nachbarn und Verwandten war ebenfalls keine Hilfe zu erwarten, und so bestand gar keine Aussicht, der kranken Mutter zur Wiedererlangung der Gesundheit zu helfen.
Frau Köhler ertrug ihr trauriges Los mit christlicher Geduld und Ergebenheit; nur bereitete es ihr einen bitteren Schmerz, so jäh gehemmt zu sein in der Ausübung ihrer mütterlichen Pflichten und Sorgen ihre noch jüngeren Kinder betreffend. Ihr starker Glaube, sowie ihr unerschütterliches Gottvertrauen verliehen ihr jedoch Mut und Stärke und hielten sie aufrecht in dieser harten Prüfungszeit. "Es kann uns noch schneller geholfen werden, als wir ahnen", so sagte sie oft zu dem betrübten Gatten und den Kindern. "Wir wollen die hl. Mutter Gottes recht innig anrufen, sie ist die Trösterin der Betrübten und Helferin in allen Nöten."
Und es verging denn auch kein Morgen, kein Abend ohne ein dringendes Gebet zur Mutter unseres Herrn, der mildreichen Fürbitterin bei ihrem göttlichen Sohn.
So war der Maimonat herangekommen: Etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt stand auf der Bergesspitze eine der Himmelskönigin geweihte Kapelle, die besonders in diesem Monat recht eifrig besucht wurde. Eines Tages begann nun die kleine zehnjährige Sophie: "Liebe Eltern, lasst mich auch hinaufgehen zur Kapelle; ich will die hl. Mutter Gottes recht fromm und andächtig bitten, dass sie uns hilft."
"Den Gedanken hat dir der liebe Gott eingegeben", stimmten die Eltern freudig ein. "So führe ihn denn auch unter Gottes Beistand durch; das Gebet eines Kindes dringt durch die Wolken und findet jederzeit Erhörung bei unserem Herrn."
Nach beendeter Schulzeit machte sich Sophie auf den Weg. Den steilen Bergpfad hinaufwandern, war gewiss ein mühseliges Unternehmen für ein Kind, aber sie tat es gern und freudig, und mahlte sich schon das Glück der lieben Eltern aus, wenn sie aus ihrer bedrängten Lage befreit würden.
Nach einem anstrengenden Marsch langte die Kleine vor der Kapelle an und kniete ungesäumt vor dem festlich geschmückten Altar nieder, auf dem das Bild der Himmelskönigin stand, mild und huldreich auf die frommen Wallfahrer niederschauend. Eine feierliche Stille herrschte in dem kleinen Gotteshaus, und Sophie zog ein Gebetbüchlein aus der Tasche hervor und begann in kindlicher Unschuld und Andacht die Litanei von der immerwährenden Hilfe zu beten. Sodann betete sie das "Memorare des hl. Bernhard und mit rührender Einfalt eines kindlichen Gemütes klagte sie der Mutter Gottes das Leid ihrer Eltern und flehte um Beistand in dieser großen Bedrängnis.
Recht lange und mit kindlichem Vertrauen hatte Sophie gebetet, und es dunkelte bereits, als sie sich wieder auf den Heimweg machte. Die Eltern hatten sich schon über ihr langes Ausbleiben geängstigt, aber fröhlich und voller Hoffnung kam sie zurück. Freilich war die Mutter noch krank, und es war auch noch kein Engel vom Himmel gekommen, der Geld gebracht hätte, aber das Kind schmiegte sich zärtlich an die Mutter und flüsterte ihr zu: "Freue dich, liebe Mutter, Gott wird uns Hilfe senden."
Über die bekümmerten Züge der kranken Frau flog ein Lächeln. "So gewiss weißt du das, mein Kind?" fragte sie halb scherzend.
"Ja, ganz gewiss", beteuerte lebhaft die Kleine. "Morgen gehe ich wieder hinauf und auch an den folgenden Tagen; ich bete so lange, bis du wieder gesund geworden bist und der Vater wieder Arbeit erhalten hat. Dann gehen wir alle zusammen hinauf und sagen dem lieben Gott und der hl. Maria Dank."
Das waren Worte, wie sie nur aus einem kindlich frommen und schuldlosen Herzen hervorsprudeln konnten. Aber Sophie nahm es sehr ernst mit ihrem Vorhaben; denn Tag für Tag pilgerte sie den steilen Bergpfad hinauf und verrichtete in der Kapelle ihre Gebete. Die Eltern setzten jedoch nicht ihre Hoffnung einzig und allein auf das Gebet ihres zehnjährigen Kindes, sondern auch im Haus wurde in einer Novene zur allerseligsten Jungfrau der Himmel um Beistand angerufen.
Am neunten Tag, an einem Samstag, erklärte das Mädchen: "Heute brauche ich nicht zur Schule, da kann ich länger ausbleiben und beten."
"Tue das, mein Kind", versetzte die Mutter bewegt. "Möge Gott dein und unser Flehen erhören!" -
Die gebirgige Gegend lockte im Frühling und Sommer viele Touristen an, und droben auf dem Berg hatte man eine herrliche Aussicht. Zwei elegant gekleidete Fremde, des Weges sichtbar unkundig, hatten, anstatt das droben befindliche Gasthaus zu erreichen, den Seitenpfad nach links eingeschlagen, der zur Kapelle führte und dort vollständig aufhörte.
"Wir müssen zurück", bemerkte der eine der beiden Wanderer. "Der Weg führt gerade in die Kapelle, weiter aber können wir nicht."
"Ah, welch schmuckes Kirchlein!" rief der andere entzückt aus, und so herrlich und malerisch gelegen. Lassen Sie uns hineingehen, wir haben ja Zeit genug und es kann auch in keiner Weise schaden."
Die beiden Herren schritten auf das kleine, geweihte Gebäude zu und traten geräuschlos ein, denn sie erblickten vor dem Altar ein Mädchen in andächtigem Gebet. Sophie glaubte sich allein an dem trauten Ort und trug laut und flehentlich bittend der Maienkönigin ihr Anliegen vor.
Den Herren wurde gar seltsam zumute. Das Gebet des Kindes klang so rührend in der Stille des Gotteshauses, die Sonne glänzte so freundlich durch die bunten Fenster - es war so ergreifend, so feierlich, dass die Angekommenen ebenfalls zum Gebet niederknieten.
Endlich hatte Sophie ihre Andacht beendet und erhob sich - schrak aber zusammen, - als sie die beiden Fremden erblickte, die stille Zuhörer ihres lauten Gebetes gewesen waren. Eilig wollte sie davoneilen, aber die Herren hielten sie vor der Tür zurück.
"Fürchte dich nicht, mein liebes Kind", sagte der ältere von den beiden, ein Herr mit freundlichen Gesichtszügen. "Wir sind Zeugen deines andächtigen Gebetes gewesen und haben dein schweres Leid angehört. Willst du uns nicht nähere Auskunft geben?"
"Sie wollen wohl eine Art Vorsehung spielen, Herr Kommerzienrat?" fragte sein Begleiter in etwas spöttischem Ton.
"Spotten Sie nicht, Herr Direktor", verwies dieser ernst. "Diese Begegnung ruft eine ähnliche Episode aus meiner Jugendzeit in mir wach; ich könnte Ihnen einen Fall erzählen, wo meine Eltern ebenfalls in bittere Not geraten waren und durch vertrauensvolles und eifriges Flehen zur Mutter Gottes auf wunderbare Weise Erhörung fanden."
Sophie fasste zu dem freundlichen Herrn Zutrauen und berichtete in kindlicher Offenheit die Lage ihrer Eltern.
"Führe uns zu deinen Eltern", sagte der Kommerzienrat zu der Kleinen, und der Herr Direktor schloss sich, wenn auch mit sichtbarem Widerstreben, seinem Freund an.
Der Tischlermeister Köhler und seine Frau waren nicht wenig erstaunt, als ihr Töchterchen in Begleitung der zwei vornehmen Fremden die Wohnung betrat. Unter sichtbarer Erschütterung vernahmen sie nun die traurige Lage der Familie, und der Kommerzienrat sagte: "Dieses Zusammentreffen mit eurem Töchterchen ist ein Walten der göttlichen Vorsehung. Ich bin ein Fabrikant aus der nahen Großstadt, und mein Freund, der Dr. Sanitätsrat ist Direktor des Marienhospitals daselbst. Wenn Sie sich seinen bewährten Händen anvertrauen und einer Operation unterziehen wollen", wandte er sich an die leidende Frau, so glaube ich bestimmt annehmen zu dürfen, dass Sie Ihre Gesundheit wiedererlangen.
"Und wegen der Kosten brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen", erklärte der Direktor. "Morgen will ich Sie in einem Wagen abholen lassen, denn es ist die höchste Zeit."
"Sie haben also keine Beschäftigung mehr?" fragte der Fabrikant den Tischlermeister. "In meiner Fabrikanlage müssen eine Menge Schreinerarbeiten ausgeführt werden - wollen Sie die Arbeit übernehmen?"
Einen Moment leuchtete es in den Augen Köhlers freudig auf, dann aber flog ein Schatten über sein Gesicht.
"Mit Freuden nehme ich Aufträge an, aber - " er stockte.
"Sie besitzen nicht die Mittel zur Anschaffung des Materials", ergänzte der Kommerzienrat. "Nun, da gibt es Rat."
Bei diesen Worten entnahm er seinem Portefeuille ein Formular, füllte es aus und überreichte es dem Tischler. "Hier, auf diese Anweisung erhalten Sie an der Reichsbank die erforderlichen Geldmittel; es wäre mir sehr lieb, wenn Sie baldigst mit der Arbeit beginnen könnten."
Der arme Mann, der so plötzlich aus aller Verlegenheit befreit wurde, vermochte vor Glück und Freude keine Silbe hervorzubringen.
"Wie soll ich Ihnen danken?" stammelte er endlich und führte seines Wohltäters an seine Lippen.
Der Fabrikant wehrte die Dankesbezeugung sanft ab. "Danken Sie nächst Gott und seiner hl. Mutter Ihrem frommen Kind", bemerkte er mit einem wohlgefälligen Blick auf die Kleine.
"Wir sind nur ein Werkzeug in der Hand Gottes gewesen, und Eltern solcher braven Kinder kann man unbedingtes Vertrauen schenken."
Nachdem diese wie vom Himmel gesandten Retter einem jeden herzlich die Hand gedrückt hatten, empfahlen sie sich unter einem freundlichen: "Auf Wiedersehen!"
Welches Glück, welche Freude herrschte in der Familie Köhler! Unter Tränen der Rührung und Freude knieten die Eltern mit ihrem frommen Kind vor dem Bild der Gottesmutter nieder und sandten ein heißes Dankgebet zu ihr und ihrem göttlichen Sohn empor.
Die hl. Jungfrau erwies sich auch als "Heil der Kranken".
Nach mehreren Wochen kehrte Frau Köhler, glücklich und vollständig geheilt, aus der Stadt zurück.
Jedes Jahr im Monat Mai, sowie auch an allen Marienfesten aber wird der Altar in der Kapelle droben mit Blumen und Girlanden festlich geschmückt. Wer das tut, kann man wohl ahnen - es ist Sophie, die fromme Tochter der Eheleute Köhler.
________________________________________________________________________

17. Auf abschüssigem Pfad - Von Hermann Weber
Es war eine helle Nacht und die Gesichtszüge des quer über den Josephsplatz schreitenden Mannes waren darum ziemlich deutlich zu erkennen.
Der späte Wanderer stand in mittleren Jahren und war wie ein besserer Handwerker gekleidet; er verfolgte ein wenig unsicher seinen Weg und hatte den Hut weit in den Nacken geschoben, um die glühende Stirn der kalten Nachtluft preiszugeben.
Den Lippen des Mannes entströmten beständig kurze Sätze, die seine Gedanken offenbarten und in der stillen Nacht deutlich vernehmbar waren.
"Welch ein Unglücksabend!" murmelte er jetzt wieder und atmete keuchend. "Wie ist es nur möglich, dass ich in einer Stunde fast dreißig Mark verspielen konnte - dreißig Mark, wofür ich wochenlang über die Feierabendzeit gearbeitet habe, um meiner Familie gelegentlich eine unverhoffte Freude zu bereiten!"
Er machte einige Schritte, dann schien ein Gefühl der Scham und Reue ihn zu überkommen, denn seine Stirn legte sich in tiefe Falten und seine Lippen zuckten.
"O dieses unsinnige Spielen!" stieß er jetzt bitter hervor. "Wie oft habe ich schon gelobt, die Karten nicht mehr anzurühren und immer wieder falle ich in meine Fehler zurück! . . . Ich muss mich schämen, wenn meine Frau von der Sache erfährt!"
Der leichtsinnige Mann taumelte weiter und machte sich, wie er schon so oft vergebens getan, bittere Vorwürfe über seinen unordentlichen Lebenswandel. Als er in die Nähe seiner Wohnung gelangte, setzte er den Hut gerade, straffte sich ein wenig und stieg dann die Treppe empor.
Als Gerlach, der Mechaniker, einige Stunden später in Gemeinschaft mit Frau und Kind den Morgenkaffee trank, fragte die Frau: "Du bist wohl recht spät heimgekommen?"
"So gegen zwölf", antwortete der Mann unsicher, dann ging er rasch auf ein anderes Thema über und fügte hinzu, sich zu seinem neunjährigen Sohn wendend: "Hast du dein Schulzeugnis erhalten, Heinrich?"
"Ja, gestern Nachmittag", antwortete statt Heinrich die Frau. "Ich habe mich sehr gefreut, denn es ist wieder recht gut ausgefallen!"
Der flinke Knabe hatte schnell das Zeugnis herbeigeholt und reichte es stolz dem Vater. Er sah es aufmerksam durch, dann strich er liebkosend über den Kopf des Kindes und sagte anerkennend:
"Du bist ja recht fleißig gewesen, mein Junge! Wenn du so fortfährst, wird aus dir noch etwas Tüchtiges werden!"
Als Gerlach eine halbe Stunde später an seinem Werktisch stand, erfasste ihn wieder der Ärger über sein Spielerunglück vom gestrigen Abend. Sein Mitarbeiter, ein verschmitzt aussehender Mann, hatte ihn schon längere Zeit verstohlen beobachtet und sagte jetzt lauernd:
"Du hast wohl gestern Abend arg verspielt, Gerlach?"
"O, nur einige Mark", antwortete Gerlach, der nicht bekennen mochte, dass er den ganzen Betrag verloren hatte, den er sich durch stundenlange harte Arbeit erworben, worauf der Kamerad leichten Tones fortfuhr:
"Einige Mark kannst du ja wohl verschmerzen! Das ist nun einmal so mit dem Spiel: heute verliert man und morgen gewinnt man das Doppelte wieder. . . . Kommst du heute Abend eine Stunde mit in den "Adler"?"
Vergebens schützte Gerlach eine dringende Arbeit vor, da er mit Schrecken an seine nur aus wenigen Groschen bestehende Barschaft dachte, doch der Versucher ließ nicht nach, bis der willensschwache Gerlach schließlich seine Zustimmung gab. Vielleicht war ihm ja heute das Glück günstig - aber wie sollte er sich Geld verschaffen?
Er dachte ratlos hin und her, bis die Mittagsstunde schlug und alle Männer die Werkstätte verließen.
Als der Mechaniker zu Hause angelangt war und schweigend sein Mahl verzehrt hatte, durchfuhr ihn plötzlich ein böser Gedanke, gegen den er vergebens ankämpfte.
Stand nicht in der untersten Kommodenschublade ein kleines Kästchen, in dem seine Frau ihre ersparten Groschen aufbewahrte? Sollte er mit diesem Geld nicht das verlorene zurückgewinnen können?
Wie ein Ertrinkender nach einem Strohhalm greift, so erfasste der leichtsinnige Mann diesen Gedanken. Niemand würde von seiner Tat erfahren und morgen schon konnte er das Geld an seine Stelle zurücklegen, wenn ihm heute Abend das Glück hold war.
Scheinbar die Zeitung lesend, erwartete Gerlach jetzt einen günstigen Augenblick. Als seine Frau für kurze Zeit das Zimmer verließ, schaute er auf seinen Sohn, der eifrig mit seinen Schularbeiten beschäftigt war, und schlich dann wie ein Dieb in die Kammer.
Die Hände zitterten dem Mann, als er die Schublade öffnete und nach dem Kästchen tastete. Mit leidenschaftlicher Gier erfasste er es und öffnete hastig den Deckel. Es enthielt zwar nur wenige Mark in kleinen Geldmünzen, die ihm in diesem Augenblick aber wie ein Vermögen vorkamen.
Hastig ließ er den kleinen Betrag in seine Hand gleiten und verbarg ihn dann in seiner Tasche; als er in diesem Augenblick auf dem Korridor ein Geräusch zu hören glaubte, stellte er den Kasten rasch auf seinen Platz zurück, stieß die Schublade zu und eilte in die Küche zurück. Bleich und verstört nahm er dann Abschied von den Seinen.
Das veruntreute Geld brachte dem Leichtsinnigen indessen nicht den Segen, den er erhofft hatte.
Wohl schien Gerlach zu Anfang des Spiels vom Glück begünstigt zu sein, denn ein kleines Häufchen Nickel- und Silbergeld lag vor ihm aufgeschichtet, doch nach kurzer Zeit wandte sich das Blatt und langsam aber unaufhaltsam sah er die kleine Summe in anderen Besitz übergehen.
Als er dann den letzten Groschen verspielt hatte und nicht einmal mehr seine Zeche bezahlen konnte, ergriff er seinen Hut und taumelte hinaus.
Der Verzweiflung nahe, erreichte Gerlach seine Wohnung. Er beachtete nicht, dass das Schlafzimmerfenster, das von der Straße aus gesehen werden konnte, trotz der vorgerückten Stunde erleuchtet war, sondern schritt niedergedrückt die Treppe empor.
Wie er es gewohnt war, wollte er behutsam die Küchentür öffnen, stutzte aber, als er sah, dass ein schwacher Lichtschein durch die Fugen drang.
"Kommst du wieder so spät?" fragte seine Frau mit vorwurfsvollem Blick und machte ihm ein Zeichen, leise aufzutreten; als Gerlach nun aber die Spuren vergossener Tränen auf ihren Zügen sah, raffte er sich mit Gewalt zusammen und fragte besorgt:
"Ist hier etwas passiert? . . . Warum bist du noch nicht zu Bett gegangen?"
"Heinrich ist krank!" flüsterte bebend die Frau. "Seit einer Stunde liegt er wach und redet vor sich hin. - Du musst sofort zum Arzt gehen, denn er sieht so sonderbar aus!"
Der Gedanke an sein einziges Kind ließ den schuldigen Mann alles andere vergessen. Von seiner Frau gefolgt, eilte er in das Schlafzimmer und beugte sich zu dem Lager nieder. Der Knabe lag mit festgeschlossenen Augen in den Kissen; eine beängstigende Fieberglut schien seinen jungen Körper ergriffen zu haben, denn eine dunkle Röte lagerte auf seinen Gesichtszügen und schwere Schweißtropfen perlten auf seiner Stirn. Er schien seine Eltern nicht zu erkennen und murmelte, jetzt mit den Händen auf der Bettdecke umhertastend:
"Ich habe es ja nicht genommen, Mutter - ich habe es ganz gewiss nicht genommen!"
Gerlach zuckte zusammen bei diesen kaum verständlichen Worten und ein entsetzlicher Gedanke erfasste wie mit einer Eisenfaust sein ganzes Innere. . . . Sollte die Krankheit des Kindes mit seiner Schuld zusammenhängen?
"Gott im Himmel - was ist hier geschehen?" stammelte der Mechaniker. "Erkläre mir doch -"
"Gegen Abend wollte ich einen Gegenstand aus dem Schlafzimmer holen", begann hastig die Frau, "da sah ich, dass die untere Kommodenschublade nicht ganz geschlossen war, weil sich ein Stückchen Zeug in den Spalt geschoben hatte. Ich sah nach und fand das Kästchen, in dem ich meine kleinen Ersparnisse aufbewahre, leer. Da niemand zu uns kommt, konnte nur Heinrich das Geld genommen haben. Er weinte, als ich ihm sagte, dass er es gestohlen hätte, und als er nun seine Tat nicht bekennen wollte, habe ich ihn bestraft und zu Bett geschickt. . . . Jetzt liegt er im Fieber, kennt mich nicht und sagt beständig, dass er das Geld nicht genommen habe!"
Mit bebenden Knien und die Hände vor das Gesicht gepresst, war der entsetzte Mann zurückgewichen.
"Er hat es auch nicht genommen!" stöhnte er dann in bitterer Qual, "ich bin der Schuldige, Frau - ich habe deine Ersparnisse genommen, um verlorenes Geld damit zurück zu gewinnen!" Und als die erschrockene Frau ihn nun fassungslos anstarrte, durchfuhr ihn eine Kraft, die er bisher nicht gekannt hatte.
Voll starker Hoffnung richtete er sich auf, drückte um Verzeihung bittend die Hände der Gattin und rief: "Gott wird Barmherzigkeit mit mir haben!" Dann eilte er fort, um ärztliche Hilfe zu holen.
Mit gerunzelten Brauen hatte der Arzt das Bekenntnis des reuigen Vaters angehört. Dann sagte er, dass die Seele des Kindes eine schwere Erschütterung erlitten habe, die in eine schwere Krankheit ausarten könne. Nachdem er dann noch seine Verhaltensanweisungen erteilt und ein Heilmittel verschrieben hatte, versprach er, am folgenden Tag wiederzukommen.
Bis zum Morgengrauen saß Gerlach am Bett seines Sohnes und horchte auf die hervorgestammelten Worte, die ihn immer wieder an seine Schuld gemahnten; sie zeigten ihm deutlich den Abgrund, an dessen Rand er gestanden hat, aber sie gaben ihm auch eine innere Kraft und Widerstandsfähigkeit gegen die Versuchungen des Lebens, die ihm bisher gefehlt hatte.
Zur unaussprechlichen Freude seiner Eltern genas der Knabe; er blieb aber noch lange Zeit still und in sich gekehrt und erhielt erst nach Monaten seinen frohen Jugendmut zurück.
Der Mechaniker hat die Karten nicht wieder angerührt; die Stunden am Bett seines für ihn leidenden Kindes haben sein Inneres gefestigt.
________________________________________________________________________

18. Das Kloster von den Rosen - Von Stephardt
Im Süden Frankreichs liegt ein weiter Landstrich, der ehemals eine eigene Herrschaft, die Grafschaft Quercy, bildete. Es ist ein Hügelland, reich an fruchtbaren Feldern und grünen Wiesen, so dass den Bewohnern für sich und ihr Vieh reichliche Nahrung geboten ist und sie, was das Zeitliche anbetrifft, glückliche und wohlhabende Menschen sein können. Im Osten aber wird der Landstrich der ehemaligen Grafschaft eingeschlossen von einer Bergkette, die zum Teil steile, nackte Felsen, zum Teil liebliche, mit Wäldern bedeckte Höhen zeigt. Auf einer dieser Höhen steht ein altes Kloster, dessen Mauern jedoch langsam zerbröckeln. Ringsherum wachsen alte Eichen, knorrig und stark, die ihre Äste weit ausstrecken, als wollten sie sich gegenseitig erfassen und das alte Kloster mit ihren Armen schirmend umfangen, um es vor dem gänzlichen Verfall zu bewahren. An den Mauern, die in einfachem gotischen Stil erbaut sind, und sonst keine besondere Merkwürdigkeit zeigen, die unsere Bewunderung verdiente, lenkt ein oft und oft wiederkehrendes Abzeichen unsere Aufmerksamkeit auf sich. Es ist dieses eigentümliche Abzeichen nicht nur über den Tür- und Fensterbogen, sondern auch an allen sonst noch hervorragenden und in das Auge fallenden Teilen des Hauses zu sehen. Wohin man blickt, überall sieht man ein Brot in Stein gehauen, auf dem eine volle Rose ruht. Das Volk nennt das weite Gebäude das "Kloster von den Rosen", und das eingemeißelte Brot mit der darauf ruhenden Rose soll an die Entstehung des Klosters erinnern, über die uns eine alte Legende etwa folgendes zu erzählen weiß:
Bald nach Vollendung der Kreuzzüge, in denen das Hl. Land den Christen zurückerobert war, herrschte über Quercy ein mächtiger Graf. Der fromme Sinn seiner Vorfahren, die im Heiligen Land gekämpft und für die Verteidigung Jerusalems ihr Blut vergossen hatten, schien in ihm erloschen zu sein. Er wollte nicht viel von der Religion und ihrer Ausübung wissen, man sah ihn nie nach der Sitte der damaligen glaubensinnigen Zeit eine demütige Pilgerfahrt nach irgend einem Gnadenort machen. Statt dessen liebte er es, auf die Jagd zu gehen, wo er bis zur völligen Erschöpfung seiner Begleiter die wilden und zahmen Tiere der Wälder verfolgte, oder er lag mit seinen Nachbarn in Fehde und der blutige Krieg wütete zwischen ihnen. Seine Vasallen und Untertanen behandelte er stolz und ungerecht, die Armen verachtete er als tief unter ihm stehende Menschen und wies sie ohne Brot oder sonstige Almosen und Unterstützungen von seinem Schloss fort. Von einem christlichen Ritter, der Recht und Gerechtigkeit verteidigen und die Armen, diese Boten des lieben Gottes, schützen und unterstützen sollte, war also nichts in ihm. Deswegen war der Graf von Quercy auch nirgends beliebt. Ja, man hasste ihn und ging ihm aus dem Weg, wo man nur konnte. Ritt der stolze Graf vorüber, so kam es nicht selten vor, dass Bauern hinter ihren Fenstern und Toren standen, die Faust ballten und zähneknirschend murmelten: "Ha, du stolzer Ritter, wenn unsere Faust dich nur fassen könnte." . . . Wenn aber die Bäuerin solches Gemurmel ihres Mannes hörte, dann fasste sie ihn begütigend beim Arm und sagte: "Ja, der Ritter ist nicht gut mit uns armen Leuten. Um so besser aber ist sein holdes Töchterlein. Ach, wenn alle Ritterfräulein so wären wie sie! Du glaubst gar nicht, wie gut sie ist. Neulich noch, als die alte Kathrin gefallen war und sich den Arm gebrochen hatte, da hat das Ritterfräulein sie gepflegt und alles für sie getan, wie eine Tochter es nicht besser für ihre Mutter tun kann. Und als meine Base, die Trine, ihre Ziege kürzlich verlor, da hat das Ritterfräulein ihr so viel Geld gegeben, dass sie sich eine neue kaufen konnte."
"Was nützt uns das", entgegnete der Bauersmann, "wir unterstehen leider nicht dem Fräulein, das ja so gut sein mag wie ein Engel, sondern wir unterstehen dem Ritter selbst, und der ist hartherzig, der würde uns das Pferd vor dem Pflug wegnehmen, wenn er es gerade gebrauchen könnte."
"Lass es gut sein und schimpfe nicht so sehr. Du wirst sehen, die Tochter wird ihren Vater bekehren, und er wird so gut und lieb werden wie das Fräulein."
"Haha, das müsste wunderbar zugehen."
"Nun, pass auf. Ich meine eben das: die vielen guten Werke und die vielen frommen Bitten, die die Tochter für ihren Vater, für seine Bekehrung verrichtet, können doch unmöglich verloren sein."
Je weniger man den Graf liebte, um so inniger verehrte man seine Tochter, die edle Maria. Sie war gerade das Gegenteil ihres Vaters. Sanft und lieb, freundlich und zuvorkommend gegen jedermann, nannte man sie den Engel von Quercy, und besonders die Unglücklichen und Armen wussten, dass sie diesen schönen Namen nicht mit Unrecht trug. Die alten Chroniken jener Zeit erzählen von ihr, dass sie die Armen mehr liebte als sich selbst, dass sie bescheiden, demütig, freundlich war, dass sie mit den Frohen die Freude, mit den Unglücklichen das Leid teilte, dass sie zu helfen suchte, wo sie nur konnte. "Dieser Blume der Tugenden", heißt es dann weiter in den alten Aufzeichnungen, "dieser lieblich duftenden Menschenblume legte der Himmel milde tröstende Worte auf die Lippen, die wie erfrischender Tau in heißen Sommernächten, wie heilender Balsam für alle Wunden, wie kräftige Medizin in jeder Krankheit wirkten. Um ihre reine hohe Stirn schienen Rosen gewunden zu sein, die nicht auf Erden wachsen, sondern nur im Paradies des Herrn blühen. Darum liebte und verehrte man sie wie eine Heilige."
Wenn der Vater auf der Jagd war, kamen die Armen an das Schlosstor, um von Maria, der nach dem Tod der Mutter die Führung des Hauswesens oblag, Brot und milde Gaben zu erbitten. Die Grafentochter, die sich am glücklichsten fühlte, wenn sie andere beglücken konnte, teilte mit freigebiger Hand aus, was ihr zur Verfügung stand. Als der Vater eines Tages von dieser Freigebigkeit erfuhr, war er sehr aufgebracht, stellte Maria zur Rede und tadelte ihr Almosengeben, das nichts anderes wie Verschwendung sei. Das fromme Mädchen erwiderte in aller Bescheidenheit, dass Freigebigkeit in der rechten Weise angebracht, gewiss keine Sünde sei, dass im Gegenteil heiße, man leihe dem lieben Gott, was man den Armen gebe, und er werde es mit reichen Zinsen zurückzahlen. Da schwieg der Vater, brummte etwas in seinen Bart und ging dann mit den Worten: "Tue, was du willst", in sein Zimmer.
Maria freute sich; denn sie meinte, ihre Worte hätten den Vater überzeugt, er werde nun anderen Sinnes werden und ihrem Almosengeben kein Hindernis mehr in den Weg legen. Sie hegte die schönsten Hoffnungen für die Zukunft. Wie schön würde es sein, wenn er wie andere christliche Ritter handelte. Das ganze Land werde mit Begeisterung ihm anhangen und seinen Namen mit Liebe und Verehrung nennen.
So hoffte und sann die edle Tochter. Doch, sie hatte sich getäuscht. Als sie am nächsten Tag, an dem die Armen kamen, um ihre gewohnten Gaben zu empfangen, die Almosen zurechtlegen wollte, fand sie die Geldlade und den Brotkasten verschlossen und den Schlüssel abgenommen. Der Vater war auf der Jagd. Er hatte, ohne ein Wort zu sagen, alles gesperrt und die Schlüssel zu sich gesteckt, um so das Almosengeben seiner Tochter unmöglich zu machen.
Was nun? Traurig und betrübt ging Maria in ihren Garten hinab, um dort zu überlegen, was zu tun sei. Es war zwar noch nicht die eigentliche Zeit dazu, aber vielleicht hingen doch schon da und dort reife Früchte an den Bäumen, die sie pflücken und den Armen heute geben könnte. Doch nein, das Obst war alles noch ganz unreif. Nur die Rosen und einige andere Blumen standen in voller Pracht und boten die einzige Gabe, die aus dem Garten zu haben war.
Da kamen auch schon die Armen.
"Ach, liebe Leutchen", sagte Maria traurig zu ihnen, "ich habe heute nichts, was ich euch geben könnte. Der Vater hat vergessen, mir den Schlüssel für den Brotkasten zu lassen, und die Früchte an den Bäumen meines Gartens sind noch nicht reif. Kommt und seht selbst. Wie gerne möchte ich euch etwas geben, aber ich habe heute nichts, rein gar nichts."
Die Armen wussten, dass Maria, wenn sie so sprach, wirklich nichts hatte; sie waren zufrieden, "ihren Engel" gesehen zu haben und wollten sich ohne Klage entfernen, als das fromme Mädchen, einer plötzlichen Eingebung folgend, auf einmal rief:
"Wartet, wartet! Ganz umsonst sollt ihr doch nicht zu mir gekommen sein. In meinem Garten blühen ja die Rosen, wunderschöne Rosen. Die liebe Gottesmutter, zu deren Bild ich sie immer bringe, wird mir nicht zürnen, wenn ich in Ermangelung jeder anderen Gabe euch einige dieser Blumen zum Andenken gebe."
Mit diesen Worten eilte Maria in den Garten zurück, um bald darauf wiederzukehren mit einem prächtigen Strauß weißer und roter Rosen in der Hand. "Nehmt diese Blumen", sagte sie zu den Armen, "und denkt, dass sie euch mit inniger Liebe gegeben werden. Es ist heute das einzige, was ich geben kann. Möge der liebe Gott auch diese kleine Gabe segnen!"
Die Armen nahmen die duftenden Rosen in Empfang und freuten sich der schönen Blumen. Sie priesen ihre geliebte Wohltäterin, die doch immer eine Freude für sie bereit habe, mit herzlichen Dankesworten und innigem "Vergelt`s Gott". Da, o Wunder! Kaum hatte der letzte Arme, ein blinder Mann, seine Rose bekommen, da hielten die Armen nicht mehr Blumen in den Händen, sondern jeder von ihnen hatte statt der duftenden Rose ein frisches Brot in den Händen.
Alle staunten und wussten vor Staunen kein Wort hervorzubringen. Das fromme Grafenkind aber blickte zum Himmel und sprach erst leise, dann laut: "Das hat Gott getan. Der die Vöglein nicht vergisst, er will die Armen speisen."
Die Nachricht von diesem Wunder, das der liebe Gott wirkte, um zu zeigen, wie lieb ihm Barmherzigkeit und Güte den Armen gegenüber sei, verbreitete sich sehr schnell in der ganzen Umgegend. Von allen Seiten kamen die Leute herbei, um die wunderbaren Brote zu sehen und von ihnen zu kosten. Maria aber war nach dem Wunder in ihr Zimmer geeilt, um dort, hingestreckt zu den Füßen einer lieblichen Muttergottesstatue, dem lieben Gott innigst zu danken und ihm zu geloben, ihr ganzes fürderes Leben dem Dienst der Armen und Unglücklichen zu weihen.
Auch der Graf erfuhr von dem Wunder. Schon auf dem Heimweg von der Jagd sprach man ihm davon. Er wollte es zuerst nicht glauben und lachte laut auf, als er hörte, was geschehen sei. Als er sich dann aber durch Untersuchung der Rosenstöcke und den Anblick des Brotes von der Wahrheit dessen überzeugt hatte, was die Armen ihm unter lauten Lobpreisungen seiner Tochter immer und immer wieder erzählten, da wurde sein hartes Herz weich und Tränen stürzten aus seinen Augen. Ja, er beschloss sogar, dem Streit und Jagen zu entsagen, und an der Stelle, wo er an diesem Tag mit den Schlüsseln zu den Gaben für die Armen in der Tasche gejagt hatte, ein Kloster zu bauen. So entstand auf den bewaldeten höhen der Grafschaft Quercy ein neues, schönes großes Kloster, das zum Andenken an das Wunder, dem es seine Entstehung verdankt, mit einem in Stein eingemeißelten Brot und einer Rose darauf geziert wurde. Das Volk aber nannte den Bau von allem Anfang an "das Kloster von den Rosen". Und dieser Name ist ihm geblieben bis auf den heutigen Tag.
________________________________________________________________________
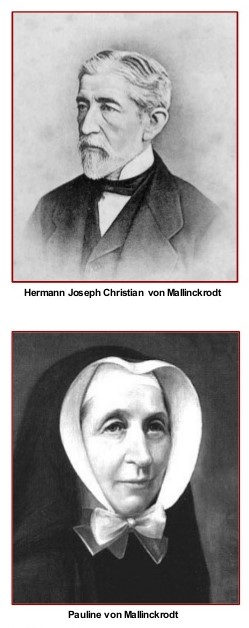
19. Der Tod eines Führers der Katholiken in schweren Zeiten
Die Zeit des Kulturkampfes mit ihren Heldenmütigen Glaubensbekennern und ihrer katholischen Begeisterung ist aus dem Gesichtskreis der Menschen von heute schon recht fern gerückt. Aber eine Gestalt, so hehr und licht, wie die eines Hermann von Mallinckrodt, sollte den Katholiken Deutschlands nie verloren gehen. Für heute wollen wir die Stunde seiner Vollendung nach heftigen politischen Kämpfen näher betrachten.
Es war im Mai des Jahres 1874, als sich der Zentrumsführer mit den Vorbereitungen zur Abreise nach der Heimat beschäftigte, da wurde er von einer Rippenfellentzündung, zu der sich später die Lungenentzündung gesellte, überfallen. Am Pfingstmorgen wurde zu seiner Pflege eine Graue Schwester an das Krankenbett gerufen. Als sie ihr Amt antrat, sagte Mallinckrodt: "Nun machen Sie Ihre Autorität geltend, dass ich gut folge." Als er sich beruhigt hatte, zog sich die Schwester zurück und begann die Tagzeiten zu beten. Aber er bemerkte es alsbald und meinte: "Können wir nicht zusammen den Rosenkranz beten?"
"Sie dürfen aber nicht sprechen."
"Gut, dann bete ich still mit."
Nach dem ersten Gesätzchen bestimmte die Schwester eine Pause, er behielt aber doch den Rosenkranz noch in den Händen und blieb noch länger damit beschäftigt, selbst dann noh, als bereits zeitweises Phantasieren eingetreten war.
In seiner ganzen Krankheit äußerte er kein Wort der Sorge für zeitliche Angelegenheiten oder Familienverhältnisse.
Am Abend kam Pater Ceslaus. In aller Schonung und mit Hinweis auf die bei dieser Krankheit auch im günstigsten Verlauf oft vorkommende Gefahr, legte er dem Kranken nahe, die heiligen Sakramente zu empfangen. Mit größter Bereitwilligkeit und Ruhe ging Mallinckrodt darauf ein.
"Ich sterbe gern", hatte er am Tag vorher gesagt, jetzt meinte er: "Was Gott will, kann man natürlich nicht wissen, aber ich kann mir ganz gut zurechtlegen, dass er gerade jetzt mich abberuft."
Als die Beichte beendet war, machte Mallinckrodt dem Beichtvater den Vorschlag, mit der heiligen Wegzehrung zu warten bis zur Frühe des anderen Tages. Es war zwischen 7 und 8 Uhr abends, die Kirche, von wo aus das heilige Sakrament geholt werden musste, lag in beträchtlicher Entfernung und nach einer Stunde musste der Zug von Paderborn mit der Gattin eintreffen.
Aber was für Mallinckrodt entscheidend war, bestand darin, dass er den Anordnungen der Kirche gemäß die heilige Kommunion im nüchternen Zustand empfangen wollte. Doch der Pater erwiderte dem Kranken, sein Zustand gestatte den Empfang der heiligen Kommunion auch jetzt.
Die heilige Wegzehrung empfing er mit der größten Innigkeit und Einfachheit, und während sonst schon Erschlaffung der geistigen Kräfte und Gedankenverwirrung entstehen, blieb der Kranke vollständig seiner mächtig.
Er selbst sprach vor der heiligen Kommunion das "Confiteor".
Sobald der Pater ihn verlassen hatte, ließ der Kranke das Kruzifix und die Kerzen entfernen, die für die heilige Handlung aufgestellt waren. Er wollte nicht, dass die Gattin bei ihrem ersten Eintreten erschreckt werde. Aus ähnlichen Rücksichten hatte er es sich auch verbeten, dass die Germania von seiner Erkrankung irgendwelche Nachricht brachte.
Endlich war der Kranke so glücklich, seine Frau in seiner Nähe zu wissen. Sie übernahm sofort die Pflege und wich nicht von seiner Seite.
In der Nacht steigerte sich das Fieber in rascher Zunahme. Der Kranke hatte viele Schmerzen, aber kein Laut der Klage kam über seine Lippen. Besonders gegen Mitternacht verschlimmerte sich der Zustand in hohem Grad, das Röcheln nahm zu. Wenn es in seiner Brust rasselte und kämpfte, sagte er zur Beschwichtigung der Umstehenden: "Es hört sich nur so schrecklich an, es ist aber leicht zu ertragen." Sonst betete er am liebsten: "Jesus, Maria und Joseph, euch schenke ich meinen Leib und meine Seele."
Als es während der Nacht so schlimm wurde, wollte ihm seine Gemahlin ihr Sterbekreuz reichen. Er aber verlangte sein eigenes, das neben dem Rosenkranz im Pult lag.
Am Morgen wurde es schlimmer und schlimmer. In aller Eile wurde der Pfarrer von St. Matthias gerufen, dem Sterbenden die letzte Ölung zu spenden und den Sterbeablass zu erteilen. Die behandelnden Ärzte glaubten das Ende nicht mehr fern. Gegen Mittag schien noch einmal eine Besserung einzutreten.
Überwiegend beschäftigte er sich in seinen Phantasien mit den Maigesetzen und Bismarck, mit dem er so manche scharfe Klinge gekreuzt hatte. "Ich wollte doch mit jedermann in Frieden leben, aber Gerechtigkeit muss doch sein", pflegte er oft zu sagen.
Wie hoch das teure Leben eingeschätzt wurde, zeigte sich in dem Umstand, dass in allen Kirchen Berlins unter Nennung seines Namens Gebete für ihn dargebracht wurden, ebenso in der Liebfrauenkirche in München, wo das Allerheiligste ausgesetzt wurde.
Pfingstmontag hatte man an die Oberin Pauline von Mallinckrodt nach Paderborn telegraphiert, über ihr Kommen zeigte der Kranke die größte Freude. Er sprach zu ihr: "Du könntest wohl für mich den Rosenkranz beten." Oft sprach er den Wunsch aus, man möge ihm das vorhin erwähnte Gebetchen vorsprechen. Der Pater Ceslaus machte ihm den Vorschlag, er wolle ein Gebet zu Ehren des hl. Dominikus über ihn beten, das, vom hl. Vinzenz stammend, über Fieberkranke gebetet zu werden pflegt und schon vielen Genesung erfleht habe. Der Kranke ging darauf ein und da in dem Gebet mehrfach Segnungen vorkommen, machte er jedes Mal das heilige Kreuzzeichen mit.
An diesem Morgen war auch von Rom das Telegramm gekommen, dass Papst Pius IX. dem Sterbenden seinen Segen erteile.
Nicht die geringste Klage, nicht der geringste Ausdruck der Besorgnis, nicht der leiseste Wunsch, Gott möge es so oder so wenden, kam über seine Lippen.
Der Kranke verlangte nach seiner Brille, Papier und Bleistift. Mühsam schrieb er: "Für Wahrheit, Freiheit und Recht!" Dann ruhte er ein wenig aus. Als die Gattin wieder mit rotgeweinten Augen an sein Bett trat und fragte: "Hast du Kopfweh?" wünschte er abermals seine Brille. Das Auge hatte sich bereits verfinstert, es dauerte noch etwa 2 Minuten, noch einige tiefe Atemzüge und Hermann von Mallinckrodt hatte sein reines, edles Leben geendet.
Am 28. Mai wurde des Abends in aller Stille, nachdem am Morgen in der St. Hedwigskirche ein Trauergottesdienst unter ungeheurer Beteiligung alle Volksschichten und Abgeordneten stattgefunden hatte, die Leiche durch den Propst Herzog eingesegnet. Befreundete Damen, so auch die Fürstin von Radziwill, hatten für eine liebevolle Ausschmückung gesorgt. Nach der Einsegnung sprach der Propst Worte des Trostes an die Versammelten. Er gedachte der hervorragenden Stellung des Verblichenen im gegenwärtigen Kampf, seiner Abberufung gerade in einem Augenblick, da sein mächtiges Wort und mannhaftes Wirken für die hl. Sache unentbehrlich sei. Mose sei es vergönnt gewesen, nach langer, beschwerlicher Wanderung vom Berg herab das verheißene Land zu schauen - solcher Trost sei dem Verstorbenen nicht beschieden gewesen, dafür schaue er jetzt das Land der Verheißung im Jenseits, das des ewigen Friedens.
Der Sarg wurde geschlossen; als einer der Angehörigen dem Schutzmann, der vorschriftsmäßig dabei anwesend sein musste, einen Taler in die Hand drücken wollte, wies er es mit Entschiedenheit zurück. Bei der Leiche eines solchen Mannes nehme er nichts. Einer von den Trägern sagte gleichfalls, sie müssten sich ja schämen, wenn sie etwas nähmen für den Dienst, den sie dem toten Herrn von Mallinckrodt erwiesen hätten.
Nachts gegen 10 Uhr kam der Sarg in der St. Meinolphuskapelle in Böddeken bei Paderborn an, gegen 2000 Menschen füllten das stille Waldtal. Am folgenden Tag fand die Beisetzung der Leiche statt. Der westfälische Adel, viele Abgeordnete waren zugegen. Der erste, der eine Schaufel Erde auf den Sarg des Verblichenen warf, war Windthorst. Der Franziskanerpater Jeiler sprach unter Anwendung des Spruchs: "Den guten Kampf habe ich gekämpft", eine tiefempfundene Trauerrede.
________________________________________________________________________

20. Das Marienbild - Geschichtliche Erzählung
von Ernst Schultheiß
Auf einem Bergrücken im Elsass lagen zwei Rittersitze. Die von Ibichstein wohnten in einem weitschichtigen prächtigen Schloss. Sie waren sehr begütert und hatten die Lehenshoheit über mehr als hundert Bauernhöfe. Im sicheren Keller lagen Fässer voll vollwichtiger Münzen und in der Rüstkammer hingen silberne und vergoldete Panzer an den Wänden. Und wenn auf Ibichstein ein Fest veranstaltet wurde, so ging es hoch her, der edle Wein floss in Strömen und auserlesene Sänger erschienen.
Vom Erkerfenster zeigte der Ritter Kurt dann wohl seinen Gästen die Wolfsburg mit ihren halbverfallenen Gebäulichkeiten. Denn die Wolfsburger waren seit alter Zeit arg verschuldet, die Straßburger Händlerschaft hatte sie in ihren Fängen und presste sie derart, dass sie niemals auf einen grünen Zweig kamen.
Der jetzige Besitzer, Kuno von Wolfsburg, aß und trank nicht besser als seine Einlieger. Aber er vergab sich nichts von seiner Ritterlichkeit und ließ sich trotz seiner landbekannten Armut kein Unrecht gefallen. Er saß in seinem Lehnstuhl, das Haupt sorgenvoll auf die Hand gestützt. Dann sprang er auf, lief durch das Zimmer und rief: "Bei St. Georg, diese Schmach muss bitter gerächt werden. Schwer werde ich es dem Ibichsteiner gedenken, dass er mit seinem Tross von Knappen und Knechten in mein Jagdgebiet schnöde eingebrochen ist und meinen Wildstand ruiniert hat. Der glaubt wohl, der arme Wolfsburger ließe sich das Fell zerzausen. Wie hätte er sonst meinen Knappen, der Aufklärung und Entschädigung verlangte, mit Hohn und Spott zurückschicken können." Es war an einem Maitag, als der wundersame Friede Gottes über der im Lenzesschmuck prangenden Landschaft lag, da gürtete Kuno von Wolfsburg sein Schwert, nahm die Armbrust auf die Achsel und schritt in den Wald. Sein Recht wollte er behaupten und den Einbrecher bestrafen, wo er ihn fände. Er stellte sich hinter eine uralte Eiche von seltenem Umfang, weshalb sie unter dem Namen "Urbaum" bekannt war. Ein frommer Mönch von St. Odilien hatte an dem Baum ein Marienbild angebracht. Es stellte die heilige Maria dar, wie sie das segnende Jesuskind auf dem Arm hält. Das Bild machte in seiner schlichten, aber lebenswahren Ausführung einen tiefen Eindruck und wurde in der ganzen Umgebung verehrt. Und die Wanderer, die auf steilem Gebirgspfad durch das Dickicht schritten, unterließen nicht, vor dem Bild ihre Andacht zu halten, um durch die Mutter Gottes Fürbitte für ihre Wanderung zu erbitten.
Der Harrende hörte das Brechen und Knacken der Zweige. Gespannt lugte er hinter dem Urbaum hervor. Ein Schimmer der Befriedigung glitt über sein Gesicht. Aber was geschah? Kurt von Ibichstein legte seine Waffenrüstung ab, entblößte sein Haupt und kniete auf der Steinbank vor dem Bild am Urbaum.
Der Rachelustige wich unwillkürlich zurück und vernahm wider Willen, wie sich der Beter mit tiefempfundenen Worten an die Gottesmutter wandte, dass sie ihm beistehe, abzulassen von seinem hochmütigen Wesen und auch den Armen schätzen und lieben lerne. Dann bat er für seine Gemahlin und seine Söhne. Hierauf legte er seine Rüstung wieder an und schritt wohlgemut und im Herzen den Frieden von dannen.
Kuno von Wolfsburg griff unwillkürlich nach seiner Armbrust, zuckte aber erschreckt zusammen. Er widerstand dem Versucher, der ihn zur bösen Tat zu reizen trachtete.
Auch er kniete vor dem Marienbild und betete um Lebensbesserung.
Am anderen Tag schritt Kuno von Wolfsburg über die Zugbrücke in den Schlosshof zu Ibichstein. Als der weißhaarige Burgvogt sein Kommen bemerkte, schlug er die Hände zusammen und rief aus: "Bei St. Dagobert, meinem vielgepriesenen Namenspatron, dass ich das noch erlebe, hätte ich nie gehofft. Denn uralt ist die Feindschaft zwischen den beiden Geschlechtern, die doch in einem nachbarlichen Verhältnis stehen sollten."
"Vom heutigen Tag an wird es schon anders werden, lieber Alter. Ist übrigens euer Herr zu einem Morgenspruch zu haben?"
"Er sitzt im Turmzimmer und liest in einem alten Folianten. Es wundert mich schier, dass er nicht zum Waidwerk hinausgeritten ist."
"Gott grüß euch, Herr Ritter!" sprach der von Ibichstein und schüttelte dem Eintretenden kräftig die Hand.
Er war über den unerwartet freundlichen Empfang sehr erstaunt und wich unwillkürlich einige Schritte zurück.
""Ich bekenne freimütig, dass ich mich ungerechterweise in die Wolfsburger Wälder begeben habe und euch Schaden zugefügt habe. Ich bin bereit, ihn zu ersetzen."
"Und ich muss noch Schlimmeres gestehen, ich hegte die frevle Absicht, euch gestern aus dem Hinterhalt einen tödlichen Pfeil in die Brust zu jagen. Nur das Gebet vor dem Marienbild war eure Rettung. Gelobt sei Maria!"
"Fortan wollen wir Lieb und Freundschaft halten, wie es adeliger Sinn erheischt. Ich bin begütert und will euch so viel Geld vorstrecken, zinslos, damit auch die Wolfsburger wieder zu Blut kommen. Wir wollen aber geloben, in eigener Person Gestein und Holz zusammen zu tragen und in der Nähe des Urbaumes ein Kirchlein errichten zu Ehren Unserer Lieben Frau."
________________________________________________________________________
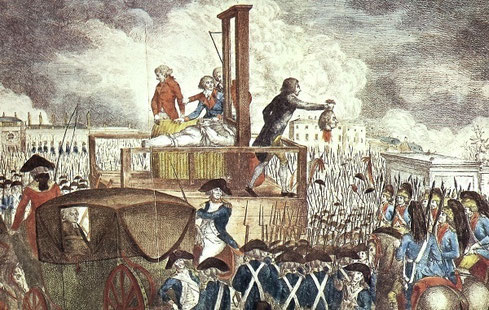
21. Mut - trotz wütender Revolutionäre - Von Stephardt
Es war im Jahr 1793, zu der Zeit, da Frankreich von den Stürmen der Revolution durchtobt wurde und kein Priester im Land seines Lebens sicher war. Kein Jagdhund verfolgt die Spur des Wildes so hartnäckig und mit solchem Eifer, wie damals die Priester in Frankreich verfolgt wurden. Wie in den ersten Zeiten der blutigen Verfolgungen, so bewahrheitete sich auch damals mehr denn je das Wort des göttlichen Heilandes, das er einst zu den Aposteln sprach und durch sie zu allen seinen Priestern: "Sie haben mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen."
In jener traurigen Zeit lebte im Kloster der Ehrwürdigen Ursulinen zu Gex der hochwürdige Herr Ravenaz als Seelsorger der Klostergemeinde. Er lebte dort still und verborgen, kümmerte sich wenig um die Welt und ihr Getriebe, sondern arbeitete nur in seinem heiligen Dienst, dem er alle seine Kräfte widmete. Doch die Blutmenschen wurden auf ihn aufmerksam, sie erfuhren, dass im Kloster ein Priester sei und stürzten sich wie blutgierige Raubtiere auf ihn. Eines Tages wurde der hochwürdige Herr gefangen genommen und wie ein gemeiner Verbrecher in das Gefängnis geschleppt, um wenige Tage darauf vor das Revolutionsgericht gestellt zu werden und seine Verurteilung zum Tod zu vernehmen.
Als der seeleneifrige fromme Priester am Tag der Verhandlung gegen ihn in den Gerichtssaal geführt wurde, erblickte sein Auge unter den Beweismitteln, die man als Zeichen und einzige Zeugen seiner angeblich staatsgefährlichen Tätigkeit auf einem Tischchen neben den Richtern aufgestellt hatte, auch das Ziborium des Klosterkirchleins, das man gottesräuberischer Weise aus dem Tabernakel gerissen und hierher gebracht hatte. Als der hochwürdige Herr das Ziborium erblickte, erinnerte er sich sofort, dass am Tag seiner Gefangennahme noch mehrere konsekrierte heilige Hostien in ihm gewesen waren. Was mochte mit diesen Hostien, mit dem unter Brotsgestalt verborgenen Leib des Herrn geschehen sein? Der Priester wollte sich Gewissheit verschaffen. Ohne ein Wort zu sagen, ohne sich durch die Blutmenschen auch nur im geringsten einschüchtern zu lassen, trat er sofort auf das Tischchen zu, um den Deckel des Ziboriums abzuheben und nachzusehen, ob man die heiligen Hostien im Kelch belassen, oder ob man sie herausgenommen und verstreut habe. Die Blutmenschen hatten wahrscheinlich nicht an das Vorhandensein der heiligen Hostien gedacht, für sie hatte nur das Ziborium wert, insofern es zuerst gegen den Priester zeugen und dann eingeschmolzen werden sollte, und so fand der hochwürdige Herr Ravenaz die heiligen Hostien unberührt, man könnte fast sagen, ganz so, wie er sie in das Ziborium hineingelegt hatte. Sofort fiel er auf seine Knie, um in inniger Andacht dem eucharistischen Heiland seine Liebe und Ehrfurcht zu bezeigen. Dann stand er auf und nahm entschlossen, wenn auch mit zitternder Hand, die heiligen Hostien, um sie zu genießen und dadurch vor weiterer Verunehrung durch die gottlosen Menschen zu schützen.
Als die Blutmenschen sahen, was der Priester tat, als sie merkten, dass er sich nicht scheue, hier öffentlich in ihrer Gegenwart seinen Glauben zu bekennen, sprangen sie in höchster Erregung von ihren Sitzen auf und stürzten sich auf den Geistlichen, um ihn an seinem Beginnen zu hindern. Doch der hochwürdige Herr Ravenaz hatte sein Werk schon vollendet. Jetzt richtete er sich hoch auf, blickte wie verklärt auf die wütenden Menschen und sagte: "Ich habe dem göttlichen Heiland, der uns mit seinem kostbaren Blut am Stamm des heiligen Kreuzes erlöst hat, meine Liebe und Ehrfurcht bezeigt, ich habe die heiligen Hostien vor Verunehrung geschützt, ich habe die heilige Wegzehrung empfangen und mich auf den Tod vorbereitet; nun bin ich, muss es sein, zum Sterben bereit. Dem göttlichen Heiland sei Lob und Dank und Preis jetzt und in alle Ewigkeit."
Bei diesen Worten des mutigen Priesters entstand ungeheurer Lärm. Man hörte Rufe, wie: "Was brauchen wir noch Zeugen? Wozu bedarf es noch weiterer Verhandlung?" Ja, was brauchte es bei den Blutmenschen, bei den Hassern der Religion noch weitere Beweise für die Schuld des Priesters. War das, was er jetzt getan hatte, nicht ein Verbrechen, wie es nicht ärger, nicht größer sein konnte, ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft werden musste? Als der Vorsitzende sich endlich Gehör verschaffen konnte und fragte: "Was denkt ihr von diesem Bürger?" da lautete die Antwort, wie sie einst beim lieben Heiland gelautet hatte: "Er ist des Todes schuldig." Daraufhin wurde der mutige Priester, der Bekenner des allerheiligsten Altarsakramentes, ohne weiteres gerichtliches Verfahren sofort zum Tod verurteilt.
Abbé Ravenaz erschrak nicht, als er sein Urteil hörte. Er hatte es ja vorausgesehen, als er sich beugte, um dem göttlichen Heiland seine Ehrfurcht zu bezeigen, um die heiligen Hostien zu genießen und sie vor Verunehrung zu schützen. Nun starb er für das Bekenntnis seines heiligen Glaubens. In dem allgemeinen Tumult blieb er allein still und gefasst. Sein geistiges Auge sah wohl den lieben Heiland, wie er einst von seinen Feinden umringt war, die seinen Tod forderten; in seinem priesterlichen Herzen aber klang das Wort des göttlichen Erlösers wieder: "Wer mich bekennen wird vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln."
________________________________________________________________________

22. Bin ich`s? - Von Benedicta
Bin ich`s? - In banger, schmerzdurchzitterter Frage trat es zum wievielten Mal auf die Lippen des alten Pfarrherrn. Alt? Ach, er war noch so jung, trotzdem schneeweißes Haar sein Haupt schmückte, trotz der tiefen Falten um den Mund, die fremde Schuld gegraben und die vom Kreuzweg eines Priesterherzens erzählen. - Wer ihn so sah in dem kleinen, einer Klosterzelle ähnlichen Stübchen, zurückgelehnt in den steifen, hochlehnigen Sessel, mit dem müden Ausdruck in den großen, einst so lebhaften Augen, dem schmalen, blassen Antlitz, aus dem angestrengte, geistige Arbeit, strenge Aszese und - wer es wusste, ein großes Leid sprach, der nannte ihn: den alten Pfarrherrn. Die Dörfler freilich sagten es so gedankenlos hin zum Unterschied von dem neuen.
Am Fenster blühten und dufteten Rosen, Reseden und Goldlack. Über Blatt und Blüten hinweg fand das goldene Sonnenlicht seinen Weg ins Innere des Stübchens, und dort tauchte es die weißgetünchten Wände und den einzigen Schmuck derselben, ein mächtiges Gemälde, den guten Hirten darstellend, in purpurne Glut.
Wem es vergönnt war, einen Blick in die stille Wohnung des einsamen Mannes zu tun, der blieb in andächtigem Staunen und tiefer Bewunderung vor dem Bild stehen.
Wohl selten war die rührende Parabel vom guten Hirten in solch meisterhafter Weise bildlich wiedergegeben wie hier. Der ergreifende Moment, wo der göttliche Hirte, seiner nicht achtend, sich ins Dornengestrüpp begibt, um das verlorene Schäflein zu suchen. Das ganze Seelengemälde eines liebenden, suchenden Menschen, die schmerzlichste Liebe, Angst und Hoffnung, alles dies war auf dem edelschönen Antlitz des Erlösers mit packender Gewalt und wunderbarer Feinheit zum Ausdruck gebracht. - Tiefes Eindringen in den erhabenen Gegenstand, ein verwandtes Herz und eine Künstlerhand von Gottes Gnaden nur konnte dies geschaffen haben. - Unter der Gestalt des guten Hirten aber stand, dem Auge des Beschauers fast unsichtbar: "Bin ich`s?" Das Bild aber hatte der Pfarrer gemalt.
* * *
Da war die Kreszenz von der Talmühle, des Talmüllers einziges Töchterlein. Schlank wie eine Edeltanne und schön und unberührt vom Hauch der Sünde.
Eben war sie dagewesen, um vom alten Pfarrherrn Abschied zu nehmen, vielleicht für ein ganzes Leben. Sie hatte die Erstlingsblüten ihrer jungen, reinen Liebe dem Herrn zum Opfer gebracht, sich ihm und seinem Dienst für immer geweiht. Morgen schon ging es fort in die Fremde, wo man ihrer gesunden, jungen Arme, ihres starken, mutigen Herzens und der Überfülle von Geduld und Liebe so sehr bedurfte.
Und wie sie nun so vor ihm gestanden mit den leuchtenden Augen, aus denen die schöne, unschuldsvolle Seele, der ganze große Opfermut eines starken Frauengeistes schauten, da war es fast wie Neid über ihn gekommen und - wie stille Trauer.
Wie Sonnenschein hatte dies reine, fromme Leben in sein trauerverdüstertes Dasein geleuchtet. Er hatte sie getauft, hatte sie emporwachsen sehen, fromm und gut, trotz des sie umgebenden Lasters. Wie eine Wunderblume, eine Mimosa sensitiva, unberührt von der Sünde, die wie üppiges Unkraut nicht allein auf dem Talhof, sondern auch im ganzen Dorf emporwucherte und alles um sie her verdarb und erstickte.
Aber der Herr hielt die junge Menschenseele, die ihm entgegenflog, mit starker Hand, und nun nahm er sie fort aus dem Elternhaus, das kein Verständnis für Gottes- und Nächstenliebe hatte. Fort aus dem Heimatort, aus der Umgebung und den Menschen, für die das reine Engelleben des frommen Kindes ein lebendiger steter Vorwurf, eine schwere Schuld war.
Und er berief sie in seinen Weinberg, zu den Ärmsten seiner Kinder, die ihn nicht kannten, und denen sie helfen sollte, ihn kennen und lieben zu lernen.
Mit reichen Segenswünschen hatte der alte Pfarrer sie entlassen.
Erschöpft, wie von großer seelischer Anstrengung, war er auf seinen Sessel zurückgesunken. Sein Blick fiel auf das Bild des guten Hirten, das von den hereinbrechenden Sonnenstrahlen wie von goldener Gloriole umflutet war.
"Bin ich`s?" seufzte er leise, und mit fragendem Blick schaute er auf das Antlitz des Erlösers, als könne ihm dorther Antwort und Ruhe kommen.
Der Abschied der Kindes hatte Bitteres in ihm aufgerührt. Sie, die schwache Frau, ging, um für den Herrn zu arbeiten, um zu arbeiten und zu wuchern mit dem Talent, das er ihr anvertraut hat - während er - - - Ja, konnte er anders? War er nicht wie von unsichtbarer Hand gehalten? Und doch, war er nicht auch in der Nachfolge des Herrn gewesen - hatte er nicht auch am Königsholz getragen gleich den anderen, am Pflug gestanden gleich den anderen und mit liebender Sorge und unermüdlicher Geduld Furche um Furche des anvertrauten Bodens gelockert und der Gnade bereitgehalten? - Freilich! - Aber als raue Stürme über ihn dahinzogen, da verlor er den Mut. Des Zweifels und der Selbstqual Schatten verdunkelten nun fürderhin seinen Lebensweg.
Wie die Kreszenz, war auch er einst mit jugendlicher, glühender Begeisterung hingeeilt, um das Ackerfeld, das die Vorsehung ihm anvertraut hatte, zu bebauen. Es war ein harter, unfruchtbarer Boden, von Disteln und Dornen überreich bewuchert. Aber nichts schreckte ihn zurück. Sein glühender Eifer für den Dienst des Herrn, sein Opfermut, seine Liebe zu den armen, verkommenen Seelen überwand alle Schwierigkeiten. Ob er sich auch Hand und Herz an den scharfen Dornen blutig ritzte, ob auch die Füße mühevolle, bittere und - ach, oft so nutzlose Wege wanderten, er achtete es nicht. Achtete nicht der harten Arbeiten, die oft über seine Kräfte zu gehen schienen.
"Mut! Mut!" tröstete er seine Seele, wenn sie müde der Arbeit wurde, wenn sie keinen Fortschritt zum Besseren wahrnahm, wenn es galt, immer wieder die alten Wunden zu verbinden und gegen Sünde und Laster zu kämpfen.
Stunden des Zweifels und der Mutlosigkeit fanden ihn dann im stillen Heiligtum vor dem eucharistischen Gott - Geduld, Liebe und verzeihendes Erbarmen für sich, Licht und Gnade für die armen, blinden Seelen erflehend.
Doch endlich - langsam freilich, dem Auge der Liebe und banger Erwartung nur sichtbar, schien sich der Boden zu lockern und reichster Segen hervorzuschießen.
Wie sein Herz erbebte vor Freude; wie es in ihm jubelte und jauchzte. Doch gleich dem wegemüden Wanderer, der endlich nach übergroßer Anstrengung das Ziel seiner Wünsche, das gelobte Land seines Herzens in der Ferne erblickend, sich doch weder Ruhe noch Rast gönnt, bis er es betreten, so gönnte auch er Geist und Körper keine Ruhe, um das so hart Errungene zu hüten und die zerstreute Herde in die Hürde des guten Hirten zu sammeln.
Ach, es gab so manche, denen der neue Pfarrherr ein Dorn im Auge war, die sich mit süßer Miene und dennoch zähneknirschend nur in die neugeschaffenen Verhältnisse gaben, weil sie doch nicht allein die räudigen Schafe der Gemeinde sein wollten.
Und andere, Reiche, die sonst nur mit stolzer Verachtung auf das niedere Gewürm herabsahen, sie mussten es sich gefallen lassen, dass der einfache Priester an ihre geheimen Seelenwunden rührte, dass er wie ein zweiter St. Johannes ihr Doppelspiel, ihr Pharisäertum geißelte und ihnen kühn das Wort entgegenrief: "Es ist dir nicht erlaubt!" - Und wie damals, so fand sich auch hier eine Herodias in Gestalt böswilliger Verleumdung.
Man wusste nicht, woher das Gerede kam, aber es war da und wurde eilig weiter getragen. Und ehe der dritte Tag vollendet, da war das reine, makellose Vorleben des edlen Mannes durch den Kot des niedrigsten Klatsches gezogen und er selbst zur Verbrecherseele gestempelt.
Die Bösen, denen er von Anfang an ein Stein des Anstoßes gewesen war, triumphierten, die Guten trauerten. Aber da sie die Minderheit und selbst noch zu schwach im Glauben waren, so wagten sie nicht, offen für ihn einzutreten. Und selbst als seine Unschuld bewiesen war, da war der Nimbus und der Glorienschein seines untadelhaften Wandels, der so manche zum Guten geführt hatte, von ihm genommen, und sie sahen aus dem Glashaus eigener Schwäche in ihm denn auch nur den sündhaften, gebrechlichen Menschen.
Und er? - dass man ihm moralisch den Tod gegeben, dass man undankbar und lieblos gegen ihn gehandelt hat, das schmerzte nicht so sehr - er war eine Hirten- und eine Opferseele. Aber dass er eine Schlangenbrut am Herzen großgezogen hat, dass sein mühsam aufgebautes Werk wie ein elendes Kartenhaus zusammenbrach, das war mehr als er ertragen konnte.
Von dem in der Luft umherschwirrenden Gerücht war ihm hin und wieder etwas zu Ohren gekommen, aber er achtete dessen nicht und er verteidigte sich nicht, er wusste sich unschuldig und vom besten Willen beseelt. Aber als das nicht half, entblödete man sich nicht, die mit Niedertracht und Tücke gewürzte Anklage mit brutaler Deutlichkeit ihm entgegen zu schleudern.
Fassungslos, geisterbleich und keines Wortes mächtig, stand er der unerhörten Bosheit gegenüber. Hatte der schwache Körper den harten Arbeiten und Mühen stand gehalten, hier verließ ihn die physische Kraft, und ohne die ganze Schwere der Anklage voll begriffen zu haben, stürzte er ohnmächtig zusammen.
Wie eine Binde fiel es nun von den Augen der Dörfler. Man hatte ihm Unrecht getan. Man hatte mit schamloser Lüge dem besten, dem gütigsten Vaterherzen, wie es die Gemeinde seit Jahrzehnten nicht besessen hat, den Tod gegeben. Ob man aber jetzt auch klagte, ob man den Himmel bestürmte um Erhaltung des so teuren Lebens, die lange Ohnmacht ging in ein schweres Leiden über.
Wochenlang hielt der Todesengel am Lager des Kranken Wache, und als er endlich, der Genesung entgegengehend, sich des neu geschenkten Lebens freuen sollte, da war er mehr ein lebendiger Toter.
Weder die Beweise der Teilnahme und Freude seiner Gemeinde über seine Genesung, noch das neu geschenkte Leben vermochten ihn aus seiner Lethargie herauszureißen. Es war, als sei eine Saite in seinem Herzen gesprungen. Als sei das Herz, das sich vormals in Liebe und Sorge um die geliebte Herde geradezu verzehrt, jetzt tot und kalt, als habe die Rückwirkung der furchtbaren Enttäuschung alles in ihm versteinert.
Mit Schmerz und Sorge sahen es due Guten, mit Beschämung oder auch mit geheimer Genugtuung die Schuldigen. Mit triumphierender Freude sahen sie es, dass sich der alte Pfarrherr, wie man ihn jetzt der schneeweißen Haare halber, die ihm die schweren Leidenswochen gebracht, nannte, zurückzog.
Kein Bitten seiner Pfarrkinder, aber auch kein Wunsch der Oberen hatten ihn vermocht, seine Hirtenbürde weiter zu tragen.
Konnte er anders? Konnte er, für die Gemeinde auf hohe Warte gestellt, mit dem toten Herzen und dem besudelten Gewand für sie noch ferner Vorbild und Lehrer sein?
Aber er ging auch nicht fort. Mitten im Dorf, inmitten seiner Pfarrkinder führte er ein stilles, zurückgezogenes Einsiedlerleben.
"Der alte Pfarrherr ist krank am Herzen", sagten die Guten, wenn sie der hohen, einst so von Tatkraft und Feuer zeugenden Gestalt, die jetzt so gebrochen einher wandelte, nachsahen. - "Nein, er ist krank im Kopf", entschieden die Übelwollenden. Er indessen ging unberührt von allem Für und Wider seinen Weg. Er wusste selbst nicht, was ihm geschehen, war er doch sich selbst und anderen fremd geworden.
Und dann war die volle Genesung gekommen und mit ihr neuer Lebensmut und neue Tatkraft. Jetzt hätte er ernten können, was er einst mit den Händen des Gebetes in Arbeit und Mühe, in Leid und Schmerz gesät hatte. Wie sehnte man sich nach der alten Ordnung zurück, und wie ging jetzt, ledig der festen, leitenden, liebenden Hand des Seelenhirten, alles wieder den verderblichen Schlendrian. Wie nahmen die alten Missstände, die dank seiner Hingabe und seines Opfermutes fast ganz geschwunden, wieder überhand. Wie waren die Armen und Unglücklichen, die gewohnt, ihre Leiden und Kümmernisse in das Herz und die allzeit, hilfsbereiten und tatkräftigen Hände des guten Seelenhirten zu legen, wie waren sie jetzt verlassen und verwaist!
So mancher unglücklichen Ehe hatte er den Frieden wiedergebracht, hatte Sünde und Elend gesteuert und war allen alles geworden. Wie hatte er für die Ehre seines Gottes geeifert!
Das Gotteshaus, das ehemals so recht von dem verwahrlosten Charakter der Dörfler Zeugnis gab, war jetzt ihr Schmuck, ihre Zierde, ihr Stolz.
Und wie das Gotteshaus, so hatte die Gemeinde selbst ein neues Gepräge erhalten. Sie war nicht mehr, wie ehedem, der Schandfleck der Gegend, die Wanderstätte der Seelsorger. - Aber wie lange hattes es gedauert und wie lange würde es noch dauern und - sie wird die königliche Tafel verlassen und sich wieder an den Träbern der unreinen Tiere ergötzen.
Er sah es, er fühlte den eisigen Sturm heranbrausen, der seinen Blumen und Blüten, die er mit tausend Schmerzen zur Entfaltung gebracht, den Tod bringen würde. Und doch stand er rat- und tatlos dem gegenüber.
Er war wie ein tönendes Erz und eine klingende Schelle geworden. Die treibende Kraft, die göttliche Liebe, die ihn ehedem Mitleid und Erbarmen mit den Unglücklichen empfinden ließ, sie war erstickt und erstorben.
"Es hilft dir und ihnen nichts", beruhigte er seine Seele, "sie werden dein Herzblut nehmen und dennoch zur Hölle fahren, weil sie dem Ruf der Gnade hartnäckig ihr Ohr verschließen."
Wieder und immer wieder bot er sein Leben zum Opfer dar, aber es schien, als sei der Herr taub für sein Bitten, als wolle er sein Wirken, nicht sein Leben.
* * *
"Herr Pfarrer, Sie müssen kommen, Sie dürfen uns nicht im Stich lassen. Es wäre ja eine unerhörte Schande, wenn am Fest unseres Kirchenpatrons unser Gotteshaus leer stände."
Mit ängstlichem, verlegenem Gesicht stand das Dorfoberhaupt, derselbe, der ehemals am lautesten mit ins Horn gestoßen, als es galt, den Pfarrherrn an den Pranger zu stellen, jetzt vor ihm.
Dem hochmütigen Mann war dieser Bittgang ein entsetzlicher Weg gewesen, aber doch musste er gegangen werden, denn der neue Pfarrer, ein stets kränkelnder Herr, war leidender denn je und unfähig, selbst am Festtag der Gemeinde den Gottesdienst zu halten, und wo sollte man an dem weltentlegenen Fleck rasch Ersatz hernehmen.
"Geht zu eurem früheren Pfarrherrn, der wird`s tun", entschied der Kranke.
Mit Angst und Sorge hatte das Dorfoberhaupt sich auf den Weg gemacht und mit Freude und Genugtuung die Zusage erhalten. Wenn ihm, dem aufgeklärten Mann, an dem Gottesdienst und der Predigt auch nichts gelegen war, so durfte er sich`s doch von den Festbesuchern nicht anmerken lassen, und er musste sorgen, dass auch die kirchliche Feier so prunkvoll wie möglich verlief; das war man den Gästen schon schuldig.
So kam denn der Tag des Kirchenpatrons, ein golden schöner Tag. Wie seit langem nicht war das Gotteshaus auf das herrlichste mit Blumen und Laubgewinden geschmückt. Durch die Bogenfenster brach das Sonnenlicht und umwob den Altar mit goldenem Schimmer - und umflossen von dieser Lichtflut, wie eine Erscheinung aus fremder Welt, stand im weißen Messgewand der alte Pfarrherr.
Seit Jahren zum ersten Mal brachte er an dieser Stätte für seine armen Kinder das heilige Opfer dar.
War die Schranke zwischen ihm und der einst so geliebten Herde niedergerissen? Konnte er von neuem anfangen, für sie wiederum der sorgende, liebende, gute Hirte zu werden?
Und die Gemeinde? Ach, die heilige Handlung hatte wenig des Anziehenden für sie. - Sie war so vergraben in die Interessen des Lebens, so verstrickt in Sünde und Laster, dass das geistige Auge ganz erblindet schien für alles Höhere. - Dennoch ließ man kein Auge vom Altar, von der edlen, königlichen Gestalt da oben in den weißen Gewändern.
Wie tiefe Beschämung überkam es manche. Wie hatte man es wagen können, diese reine Erscheinung, aus dessen Antlitz der lauterste Wandel sprach, mit dem Schmutz schamloser Verdächtigung zu besudeln? Würde er sich nun rächen? Würde er ihrer Schuld gedenken?
Lautlose Stille herrschte, als der alte Pfarrherr die Kanzel bestieg. Mit unendlicher Liebe überflog sein Blick die gedrängte Menge. Ja, sie waren alle da, die Guten, die Lauen, die Kalten, die ihn ans Kreuz geschlagen, die es ruhig hatten geschehen lassen, und die wenigen, die seine Unschuld verteidigt; aber daran dachte er jetzt nicht.
Mit leiser, fast monotoner Stimme hub er an über das Leben und die Vorzüge ihres hohen Patrons zu sprechen. Dann aber hob sich seine Stimme und übergehend auf die Liebe des guten Hirten, sprach er mit hinreißender Gewalt und Begeisterung von der unendlichen, uferlosen Liebe dieses göttlichen Hirtenherzens.
Die hohe, hagere Gestalt da oben schien zu wachsen, und in lodernden Wortflammen ergoss es sich über die Zuhörer, als er des Herrn Liebe und der Undankbarkeit und Härte der menschlichen Herzen gedachte, die die Güte und Erbarmung Gottes mit frevelnder Hand zurückstoßen.
Das war nicht mehr der alte Pfarrherr! Das durchgeistigte Antlitz geisterhaft bleich, die großen, sprechenden Augen in fast überirdischem Glanz leuchtend, erschien er ihnen wie ein Gottesbote, wie ein Racheengel des Herrn, der gekommen war, ihm, dem verstockten Volk, die Strafe der erzürnten Gottheit anzudrohen.
Der Neugier und dem Interesse waren bald tiefes Schamgefühl, Schmerz, ja Entsetzen gefolgt. War er ein Prophet, der mit Seherblick alles zu durchschauen schien? Der so unbarmherzig die Binde von ihren Augen riss und sie in die Abgründe, die sie sich selbst geschaffen, blicken ließ? Der die entsetzlichen Zustände in der Herde, und in dem Leben der einzelnen mit schonungslosester Klarheit aufdeckte?
Alles, was an brennendem Schmerz und sorgender Angst in dem guten Hirtenherzen verborgen, das brach jetzt mit neu erwachter Heftigkeit und Liebe hervor und strömte wie glühende Lava in die Herzen der Zuhörer.
So war nie zu ihnen gesprochen worden, und es war wohl kaum einer im Gotteshaus, der nicht gleich dem Zöllner sich vor Gott schuldig bekannte.
Als aber der alte Pfarrherr, von der Strenge zur Milde übergehend, in warmen Herzenstönen flehende Worte der Liebe und der Erbarmung zu ihnen sprach, als die weiße Gestalt da oben mit den ausgebreiteten Armen in gleichsam göttlicher Hirtenliebe die verloren geglaubte Herde zu umfangen schien, da blieb kein Auge trocken.
Der alte Pfarrherr sah es, er fühlte, wie die Kluft, die ihn getrennt, sich zu überbrücken schien. Wie selige Verklärung zog es über das weiße Antlitz. Noch einmal hob er die Arme, der Mund öffnete sich, aber nur ein Schrei, - ein lauter, heller Liebesschrei hallte durch den stillen Raum. Dann sanken die Arme schlaff hernieder und mit Entsetzen sah man die geliebte Gestalt da oben wanken, sah man einen Blutstrom über die Lippen sich ergießen und das weiße Gewand blutig färben.
Ein lauter, hundertfacher Schmerzensschrei durchhallte das alte Gotteshaus, das den Opfertod eines guten Menschen sah.
Der Gemeinde bestes Vaterherz hatte aufgehört zu schlagen. Hatte Gott sein Flehen erhört? Hatte der unsträfliche Mann sich zwischen die Gemeinde und die beleidigte Gottheit gestellt?
Dies Ereignis schaffte in der jetzt doppelt verwaisten Gemeinde tief einschneidenden Wandel. Die Morgenröte einer besseren Zeit brach an, die beste Ehrung des jetzt so hoch verehrten, verklärten Seelenhirten.
"Bin ich`s?" - Ja, er war es, der gute Hirt, der sein Leben dahingegeben hat für seine Herde.
________________________________________________________________________

hl. Brigitta von Schweden
23. Nord, Süd, Ost und West - Von Pia Rainer
In einer der Vorstädte einer holländischen Stadt steht ein Brigittenkloster. Der Klostergarten ist auf allen vier Seiten von einer hohen Ziegelmauer eingeschlossen, von außen hässlich genug anzusehen, doch innen bedecken die Süd- und Westseite über und über Obstbäume der verschiedensten Gattung. Im Frühling bietet die Blütenpracht der Pfirsiche und Birnen, der Äpfel und Pflaumen, Aprikosen und Kirschen einen Anblick dar, der jedes Künstlers Auge entzücken würde, und im Herbst machen die herrlichen Früchte der schwerbeladenen Zweige jedem, der sie sieht, den Mund wässrig, außer den frommen Nonnen, deren abgetötete Sinne über derartige Genüsse erhaben sind.
Auf der Nord- und Ostseite sind die inneren Mauern ganz verborgen unter weißen und roten Rosen, Clematis und virginischer Weinrebe, deren Laub im Herbst in prachtvollen Farben leuchtet. Innerhalb der Umfriedung ist der Garten in steifem, gleichmäßigem Stil angelegt; gerade, breite Kieswege laufen in rechten Winkeln ineinander, wie die Straßen einer amerikanischen Stadt, bisweilen einen Grasplatz einschließend, oder Blumenrabatten, die wieder in kleinere Felder mit schmäleren Kieswegen abgeteilt sind.
Das Kloster, ein schlichter Bau, trennt den Küchengarten auf der Rückseite von dem Teil, den wir eben beschrieben haben. Der Welt scheint es wie ein Gefängnis und den Nonnen ist es ein irdisches Paradies.
An Sommerabenden um sieben Uhr, wenn die Glocke läutete, fanden sich die Nonnen dort zu ihrer abendlichen Erholungsstunde zusammen.
Sie gehörten dem Orden vom Heiligsten Erlöser an, den die heilige Brigitta von Schweden gegründet hat, weshalb sie auch Brigittinnen genannt werden; sie tragen graue Gewänder, die Professschwestern schwarze Schleier, die Novizen weiße, wie in den meisten Orden, aber über ihren Schleier haben die Brigittenschwestern auch eine Art Kranz oder Diadem von Leinen mit fünf kleinen roten Kreuzen darauf, welche die fünf Wunden unseres Heilandes darstellen sollen.
Sie teilten sich in einzelne Gruppen, als sie lachend und plaudernd herauskamen, war es doch nur für eine kurze halbe Stunde, denn dann herrschte wieder feierliches Stillschweigen bis nach der heiligen Messe am anderen Morgen. Nur mit einer dieser Gruppen haben wir zu tun, einer Gruppe von vier Schwestern, die für sich allein gingen. Die eine von ihnen, die Äbtissin, war schon älter, und die zweite, eine Schwedin, in mittleren Jahren, mit Namen Antonia. Die beiden anderen waren noch jung; die eine war eine Engländerin mit dem Ordensnamen Schwester Klara und die vierte, die gleich der Äbtissin Holländerin war, hieß Schwester Katharina.
Sie gingen in dem Garten auf und ab, aber jedes Mal, wenn sie zu der Stelle kamen, wo das große Kruzifix auf einer Anhöhe stand, blieben sie stehen und beteten einige Vaterunser mit dem Zusatz "Ehre sei dem Vater" usw., um Gott den Allmächtigen zu preisen für alle diejenigen, die ihn nicht preisen wie diese Nonnen es Tag und Nacht tun, obwohl die Welt sagt, sie gehen müßig. Und während sie diesen kleinen Akt der Anbetung vollzogen, gedachte die Äbtissin ganz besonders ihres Sohnes, denn sie war eine Witwe, Schwester Antonia gedachte ihres einzigen Bruders, Schwester Klara ihres Vaters und Schwester Katharina des Mannes, der sie leidenschaftlich geliebt hatte und den auch sie wiederliebte, aber nicht hatte heiraten wollen, weil er von Gott nichts wissen wollte.
Um halb acht Uhr ertönte die Glocke wieder und von diesem Augenblick an breitete sich wieder Stillschweigen über das Kloster. Die Nonnen gingen hinein zur Komplet und Betrachtung und Abendgebet, dann um neun Uhr zu Bett, um sich zu Mitternacht wieder zu erheben zur Matutin und Laudes, während die schlafende Welt sagt, sie täten nichts.
Norden
Weit in der Ferne, im Land der Mitternachtssonne, kämpften zehn tapfere Männer, um Seele und Leib zusammenzuhalten bei den schmalen Rationen, die sie sich bei dem immer mehr schwindenden Vorrat nur noch gestatten konnten. Mit aller Kraft suchten sie ihren Mut aufrecht zu erhalten, um nicht der Verzweiflung zu erliegen, wenn ihre einzige Hoffnung schwinden sollte, - die Hoffnung, dass eine Hilfsexpedition ausgesandt würde und sie auffände, bevor ein zweiter Winter eintrat.
Der Kapitän war ein Schwede und seine Schwester eine Klosterfrau, die Brigittenschwester Antonia, die ihr Leben im Gebet verbrachte, während ihr Bruder das seinige im Dienst der Wissenschaft aufs Spiel setzte, um den Nordpol zu erreichen. Sein Schiff war zu Anfang des vergangenen Winters zugrunde gegangen, und sie hatten mit Schlitten und Hunden ihren Rückzug bis zu dieser letzten Station bewerkstelligen müssen, wo sie nun von den Eiern der Seevögel lebten und den geringen Vorräten, die sie auf ihrem Weg nach Norden hier zurückgelassen hatten. Nun warteten sie hoffend und betend, dass Hilfe kommen möchte.
Tag für Tag und Stunde für Stunde strengten sie ihre Augen an, um am Horizont des klaren, blauen arktischen Himmels den Rauch eines Dampfers zu erspähen, und jeden Tag wurden sie aufs neue getäuscht. Und dann kam ein Tag, wo es dem Kapitän schien, als sähe er eine kleine Wolke am fernen Horizont, aber die anderen verlachten und verspotteten ihn. Die kleine Wolke kam indes näher und nun war er sicher, dass die Wolke Rauch war, und die anderen lachten nicht mehr, sondern jauchzten vor Freude. Als der Rauch immer näher und näher kam, nach und nach die Masten und Schornsteine und zuletzt das Schiff selbst sichtbar wurde, da waren sie alle fast närrisch vor Freude.
Einige Stunden später waren sie gerettet, und als sie sich alle an Bord befanden, fragte der Kapitän nach dem Namen des Schiffes, das gleich ihm zu Schweden gehörte. Als sie ihm sagten, dass es St. Brigitta sei, da wusste er, dass die Gebete seiner Schwester es gesandt hatten, und er nahm seine Mütze ab und dankte Gott für diejenigen, die ihn in ihren Gebeten loben und preisen und danken Tag und Nacht.
Süden
Die Saison in Monte Carlo hatte ihren Höhepunkt erreicht, die Spieltische waren dicht besetzt, Vermögen wurden verloren und gewonnen, die Croupiers harken die Goldhaufen zusammen. Es war das gewohnte Bild: die geschminkten Weltdamen, die alten Gewohnheitsspieler und die jungen, denen der Reiz noch neu war. Frauen und Männer, alt, jung und mittelalterlich, reich und arm, einige verwegen setzend, andere scheinbar unempfindlich gegen alles, wieder andere vom Glück berauscht oder vor Verzweiflung wie von Sinnen.
Draußen in der Natur war die Szenerie eine der lieblichsten, die man sich denken kann, drinnen in den Sälen aber die allerabschreckendste, trotz der prunkvollen Umgebung, denn hier wüteten die schlimmsten Leidenschaften und Laster der menschlichen Natur.
An einem Tisch saß ein junger Mann, ein Holländer. Er hatte ein einnehmendes Äußere, aber dem Ausdruck der hübschen Züge mangelte Charakterstärke. Die Szene war ihm neu; nur widerwillig war er einem Freund hierher gefolgt; denn als er das letzte Mal ein gewisses Kloster in Holland besuchte, dessen Äbtissin seine Mutter war, gab er ihr das Versprechen, nie zu spielen. Jetzt hatte er den Bitten seines Freundes, es sich nur anzusehen, nachgegeben, während er die anderen beobachtete, erfasste ihn selbst die Erregung und fast instinktmäßig suchte er in seinen Taschen nach einem Goldstück. Im Begriff, es auf den Tisch zu legen, überkam ihn eine plötzliche Schwäche, und als er seine Augen für einen Augenblick schloss, sah er seine Mutter, die Äbtissin, wie sie ihm zuwinkte. Es war nur der Eindruck eines Augenblicks, eine Vision, ein Traum, ein Spiel der Einbildung, mag man es nennen wie man will, aber dieser Moment genügte. Er dachte an das harte Leben, das seine Mutter in Buße und Abtötung, Gebet und Entsagung führte, und da wandte er sich ab, ließ die Münze in seine Tasche gleiten und wankte hinaus in die frische Luft, sich im stillen gelobend, nie mehr seinen Fuß da hinein zu setzen. Und er wusste, dass die Gebete seiner Mutter ihn gerettet hatten.
Osten
In Indien waren, wie dies öfters in den nordwestlichen Provinzen geschieht, Unruhen ausgebrochen. Ein gewisser englischer Offizier, der ein einheimisches Reiterregiment befehligte, war ausgesandt worden, sie zu unterdrücken. Einige feindliche Stämme hatten Einfälle in englisches Gebiet gemacht und da sollte er und seine braven, kleinen Ghurkas sie vertreiben. Aber, wie das schon früher geschehen war, so hatte auch diesmal sein Vorgesetzter die Stärke des Feindes unterschätzt, und so sah sich der Oberst vor eine schwere Aufgabe gestellt. Doch er war tapfer, beinahe bis zur Verwegenheit, und ohne Verstärkung abzuwarten, führte er seine Leute in den Kampf. Da traf ihn plötzlich eine Kugel oberhalb des Herzens. Er fühlte jedoch weder einen Schmerz, noch ein Unbehagen, und bemerkte nur das durch das Eindringen der Kugel gebohrte Loch in seiner Khaki-Uniform. Die Gefahr erhitzte sein Blut und er focht wie ein Besessener, ganz vergessend darauf, dass er angeschossen worden war. Die Schlacht hatte er gewonnen.
Als er am Abend ins Lager zurückkehrte und seinen Überrock auszog, fiel eine Kugel heraus und beim herunterblicken bemerkte er die Medaille, die er stets unter seiner Uniform trug. Außen auf ihr hatte er verschiedene Medaillen, auf die er sehr stolz war, aber zu seinem Erstaunen bemerkte er, dass gerade auf dieser immer getragenen Medaille die Kugel sich abgedrückt hatte und dadurch abgewendet worden war. Und da gedachte er seiner Tochter, Schwester Klara, die ihn gebeten hatte, sie zu tragen und sie ihm selbst um den Hals gehangen an einer von einer Locke ihres schönen Goldhaares gefertigte Kette, das man ihr am Tag ihrer Einkleidung abgeschnitten hatte. Er wusste, dass ihre Gebete ihm das Leben gerettet hatten, und so pries und dankte auch er für die, deren Leben ein beständiges Opfer für ihn war.
Und die Welt sagt, dass Schwester Klara und ihre Mitschwestern ihre Zeit unnütz vergeudeten.
Westen
Es war im Westend von London in einem eleganten Zimmer einer der vornehmen Straßen. Photographien von Schauspielerinnen und Modeschönheiten bedeckten den Kaminsims, Bilder zweifelhaften Geschmacks schmückten die Wände. Französische Romane der schlimmsten Sorte und gottlästerliche Literatur lagen in dem luxuriös ausgestatteten Zimmer umher.
Inmitten von all dem saß ein Mann am Tisch, den Kopf in die Hände gestützt, ein Bild größter Verzweiflung; auf der einen Seite lag ein offener Brief, auf der anderen ein geladener Revolver. Der Brief war von seinem Bankier, der ihm darin mitteilte, dass sein Kredit erschöpft sei und dass sein Vater seinen Zuschuss eingestellt habe, wie er ihm dies das letzte Mal, als er ihn wieder überschritten, schon angedroht hatte. Jetzt blieb ihm nur, so sagte er sich, die Wahl zwischen zwei Dingen: entweder seine Lebensweise zu bereuen und dem verlorenen Sohn gleich zu seinem Vater zu gehen und zu bekennen, dass er gesündigt habe, und er wusste, dass ihm alles verziehen würde. Oder, was das kürzere und leichtere für einen so stolzen Sinnes wie er war, sich eine Kugel durch den Kopf zu jagen.
An ein ewiges Leben glaubte er nicht; wenigstens sagte er sich das so vor und andere auch. Warum sollte man da nicht diesem hier ein Ende machen? Er war ohnedies Lebensmüde, müde des Vergnügens, müde der Sünde, müde der Welt. Ja, er wollte es tun, aber die Welt sollte wissen, was ihn in diese Lage gebracht hatte. Wenn sie, die nun Schwester Katharina in einem holländischen Kloster war, ihn geheiratet hätte, dann würde alles gut geworden sein, so glaubte er wenigstens.
Er warf den Brief des Bankiers in den Papierkorb und sein Schreibpult aufschließend, entnahm er ihm einen anderen Brief, breitete ihn vor sich aus und nahm den Revolver wieder zur Hand. Dabei fielen seine Augen auf folgende, in seiner Muttersprache geschriebenen Worte:
"Mein ganzes Leben soll dem Gebet für Dich gewidmet sein; all meine Bußübungen will ich für dich aufopfern. Mein Geist wird Dir näher sein, wenn ich im Kloster bin, als wenn ich Deine Gattin geworden wäre. Wenn Du in Gefahr bist, werde ich Dir nahe sein, um Dich mit meinen Gebeten zu schützen, und wenn dies kurze Leben vorüber ist, dann werden wir vereint werden, und er, an den Du jetzt nicht glauben kannst, wird Dich aufnehmen um meinetwillen, denn er liebt Dich mehr als selbst ich."
Und aus dem offenen Brief fiel ein Heiligenbild heraus, unter dem die Worte standen: "Ich will aufstehen und zu meinem Vater gehen."
Und der junge Mann legte den Revolver beiseite, stand auf und ging.
Und auch er lebte, um Gott zu loben und zu danken für diejenigen, die ihr Leben ihm geweiht haben, obwohl die Welt sagt, dass sie unnütz sind.
________________________________________________________________________

24. Auf rechter Bahn - Von Silesia
Droben im bayerischen Allgäu ist es, in einem Dörfchen, dessen Hütten zerstreut umherliegen. Dort kämpft ein Menschenleben den letzten schweren Kampf. Es ist Mutter Haßlinger, die Witwe eines Steinbrucharbeiters, eine Frau in den vierziger Jahren. Auf dem bleichen Antlitz, dem der Tod bereits seinen Stempel aufgeprägt hat, ruht stiller Friede. Der liebe Heiland ist heute noch einmal bei ihr eingekehrt und ihm hat sie anvertraut, was ihr Herz sorgenvoll macht beim Scheiden aus dieser Welt; nun ist sie auch hierüber beruhigt.
"Kinder", flüstert sie jetzt und lässt ihre Blicke auf drei prächtigen blonden Söhnen ruhen, die schluchzend an ihrem Lager knien, "weint nicht. Ich scheide gern, da der liebe Gott mich ruft. Euch, die ihr mein Glück gewesen seid und meine Freude, aber auch meine Sorge, habe ich dem lieben Heiland anempfohlen. Er wird euch nicht verlassen, wenn ihr stets treu zu ihm haltet. Und dass ihr das tun wollt, sollt ihr mir jetzt feierlich versprechen. Michael und Joseph, gebt mir die Hand darauf, dass ihr stets dem heiligen katholischen Glauben treu bleiben und die Sünde fliehen wollt, nach allen euren Kräften. Wollt ihr das?"
"Ja, ja, Mutter, immer und allezeit," kam es schluchzend aus dem Mund der beiden Burschen, die achtzehn- und sechzehnjährig, der eine als Geselle, der andere als Lehrling bei einem Steinmetzmeister arbeiteten, und fest umschlangen ihre rauen Hände die erkaltende Hand der Mutter.
"Dann noch etwas", flüsterte sie aufs neue, "verlasst mir das Hannesle nicht. Seid ihm Erzieher, Ernährer und geht ihm mit guten Beispiel voran. Ihm, dem fünfjährigen Buben, wird die Mutter am meisten fehlen. - O, mein Hannesle, mein Hannesle!" Und in überwallender Mutterliebe und Muttersorge zog die Sterbende das Büblein an sich.
"Mutter, sorge dich nicht", schluchzte Michael, für das Hannesle wollen wir sorgen, als wenn du selbst es tätest, und hoch und heilig versprechen wir dir, dass es nur Gutes von uns lernen soll."
"Dann kann ich im Frieden sterben," kam es wie ein Hauch von ihren Lippen, "kommt her, beten wir noch einmal zusammen und dann möge der liebe Herrgott kommen und mich holen."
- - - Als der Abendfriede sich über das stille Gebirgstal herabsenkte, wurde das Zügenglöcklein geläutet; die Seele der guten Mutter Haßlinger war zur ewigen Ruhe eingegangen.
* * *
Vier Wochen später standen an dem frischaufgeworfenen Grab, das die irdischen Überreste Mutter Haßlingers barg, ihre drei Söhne. Sie waren reisefertig angetan und kamen, Abschied zu nehmen. Michael hatte in M. gute Stellung mit besserem Lohn angeboten erhalten, er durfte auch seinen Bruder als Mitgesellen mitbringen und Hannesle wollten sie auch in ihrer Nähe haben.
"So, Mutterle, jetzt wäre es soweit, und nun "Behüt` Gott!" sagte Michael, und er, der bisher resolut als Familienoberhaupt gehandelt hatte, schlug die Hände vors Gesicht und weinte bitterlich.
"Und was wir dir versprachen, dabei bleibt es. Nichts soll uns abbringen von der rechten Bahn." Noch ein stilles Vaterunser und dann schritten die Brüder, den kleinsten in der Mitte, hinaus, einer unbekannten Zukunft entgegen. Ihr Häuschen, das Erbteil ihrer Eltern, hatten sie in Miete gegeben und der Obhut des Vormunds anvertraut. Den kleinen Bruder nahmen sie mit, um ihn in M. einem von Ordensschwestern geleiteten Waisenhaus anzuvertrauen, so lange, bis er aus der Schule entlassen war. Die Kosten dafür gedachten sie aus ihrem Arbeitslohn aufzubringen.
"Er ist unserer Mutter Vermächtnis, und ich glaube, dass wir ihn bei den Schwestern am besten aufgehoben haben. Müssen wir uns auch seinetwegen einschränken, später, wenn wir höheren Lohn erhalten, wird es uns kaum schwer werden. Und was wir für Hannesle durch Einschränkung an Kost und Kleidern, durch Versagung von Vergnügungen zum Opfer bringen, wird uns schon wieder hereinkommen!"
Wie immer stimmte Joseph dem Bruder bei, und so finden wir sie auf dem Weg hinaus ins Leben. Was wird es ihnen bringen? - Werden sie dem Versprechen, das sie der sterbenden Mutter gaben, treu bleiben? -
* * *
Darüber ist manches Jahr vergangen. Zum zwanzigsten Mal umspielen die Sommerwinde das stille Muttergrab in den bayerischen Bergen. Aber nicht dahin bitte ich die lieben Leser mir diesmal zu folgen, sondern dorthin, wo die Höhenzüge der Sudeten ihre Kuppe aufgebaut haben.
Die letzten Jahre brachten diesen Gegenden schweres Unheil. Hochwasserfluten gingen hernieder und hatten furchtbare Verheerungen im Gefolge. Rastlos arbeitete der Menschengeist, dies alles in Zukunft zu steuern, und nach fachmännisch ausgedachten Plänen, die die Zustimmung der Staatsregierung fanden, unter Aufwendung enormer Kosten, wurden Vorsichtsmaßregeln getroffen im Bau von Talsperren, Staubecken und Stauweihern, die bestimmt sind, bei Hochwassergefahr die Fluten zu regulieren und in sich aufzunehmen.
In der Gegens von N. ist auch ein solcher Stauweiher im Entstehen begriffen. Eine Arbeit, ein Werk, das das Staunen aller hervorruft, die es betrachten. Die Anlage, die Technik ist eine großartige, und das Mauerwerk in seiner festen, außerordentlich sauberen Granitfügung erinnert an die Bauten der alten Ägypter.
Natürlich nimmt ein solches Werk, nebst Maschinen mit Dampfkraft, Hunderte von Menschenkräften in Anspruch, und in der Tat glaubt man zur Zeit des Betriebes einen Bienenschwarm zu sehen, so viele fleißige Hände sind draußen in dem weiten Talkessel beschäftigt.
* * *
Es ist an einem schönen Spätherbstsonntag und die Glocken der Pfarrkirche zu N. rufen zum Gottesdienst. Das herrliche, weite Gotteshaus, das an die ehemalige Zisterzienserabtei sich anschließt, ist bald mit Gläubigen gefüllt. Kurz vor Beginn der Predigt treten zwei Herren und ein Jüngling ein, prächtige Gestalten, an die Recken der deutschen Vorzeit erinnernd. Mit Andacht folgen sie dem Gang der heiligen Handlung, so dass sie mehrfach das Interesse der Kirchenbesucher erwecken.
"Wer sind sie denn diese drei Prachtgestalten?" fragt nach dem Gottesdienst ein Herr einen andern, als die Fremden an ihnen vorübergingen, "ich habe sie schon wiederholt in der Kirche beobachtet. Anscheinend sind es Brüder."
"Das sind sie allerdings", erklärte der Gefragte, "und zwar aus Bayern. Die Gebrüder Haßlinger, die die Steinarbeiten draußen am Stauweiher ausführen. Tüchtige, intelligente Leute. Besonders der ältere gebietet gleich einem Feldherrn unter dem Heer von Arbeitern. Sahen Sie nicht die Italiener, Bosnier, Kroaten in der Kirche? - Das sind die Truppen der Herren Haßlinger und gut im Zug haben sie es. Herr Haßlinger führt ein mildes Regiment, aber ein sicheres, und es ist erstaunlich, wie er die verschiedensten Elemente des Arbeiterheeres beherrscht. Ausschreitungen kommen hier nicht vor."
* * *
In der Tat sehen wir in den Bauherrn des Stauweihers Von N. alte Bekannte wieder. Auf den drei Brüdern, die vom Sterbebett der Mutter hinaus in die Welt zogen, hat Gottes Segen gelegen. Trotz all der Versuchungen und Gefahren, die ihnen in Zahl und Fülle wie anderen entgegentraten, haben sie das Versprechen erfüllt, das sie der sterbenden Mutter gegeben hatten. Sie bewahrten sich Glauben und gute Sitte wie als Lehrling, so als Gesellen, wie auch zur Zeit, da sie des Königs Rock trugen und ihrer Militärpflicht genügten. Die lebendige Erinnerung an die Mutter, Arbeit und Opfer haben sie reif gemacht. Nachdem Hannesle im Waisenhaus eine gute Erziehung genossen und der Schule entwachsen war, nahmen sie ihn zu sich, und unter ihren Augen entwickelte er sich gleich ihnen zum tüchtigen Arbeiter. Den rastlos vorwärtsstrebenden jungen Leuten gelang es nach Jahren, durch Fleiß und Sparsamkeit, Zuverlässigkeit und soliden Charakter ein eigenes Geschäft größeren Stils zu gründen. Der Kredit wuchs und sie konnten zur Ausführung monumentaler Steinarbeiten schreiten.
Manch schönes Werk auf diesem Gebiet ist ihnen bereits gelungen und hat ihr Name darüber einen guten Klang erhalten. Der Muttersegen brachte Glück und Gottes Segen begleitete sie auf der rechten Bahn.
________________________________________________________________________

25. Der Teufel soll dich holen!
An einem schönen Sommermorgen fuhr auf der Straße eine prachtvolle Kutsche dahin. In ihr saß ein schön gekleideter Herr, rauchte eine wohlriechende Zigarre und las in einer Zeitung. - Sie kamen in einen Wald. - Ach, wie es im Wald schön ist!
Der Herr in der Kutsche legte die Zeitung beiseite, lehnte sich in die weichen Kissen und schaute in den schönen Wald hinein. - Ja, auch den Stadtherren pflegen die Wälder zu gefallen und manchen nicht nur wegen des Gewinns, den sie gewähren.
Plötzlich tauchte auf dem Weg ein Herr auf in Jägerkleidung, mit einer Hahnenfeder am Hut. - Er lächelte freundlich, winkte dem Kutscher, stehen zu bleiben, verneigte sich höflich vor dem Herrn in der Kutsche und bat, ihn ein Stück Weges mitzunehmen, da ihn der Schuh drücke.
"Wird mir ein großes Vergnügen sein", verneigte sich der Herr in der Kutsche und setzte sich auf die linke Seite.
Der fremde Herr schwang sich in die Kutsche und sagte im freundlichen Ton: "Bitte um Entschuldigung, wenn ich belästige. Mit wem habe ich die Ehre, wenn ich fragen darf?"
"Ich bin ein Advokat aus der Stadt", antwortete der Herr selbstbewusst. - "Und mit wem habe ich die Ehre?"
"Ich bin der Höllenfürst - der Teufel."
Der Advokat lächelte, sah aber doch seinem Gast auf die Füße. Kaum aber sah er den Pferdefuß, zuckte er zusammen und drückte sich in die Ecke.
Der Teufel lachte hellauf. - "Wenn ich nicht sicher wüsste, dass Sie ein Advokat sind, möchte ich es gar nicht glauben! Ein Advokat, - der den Teufel fürchtet! Ich bitte Sie, Freund, wissen Sie nicht, dass wir Fachkollegen sind? - Wie oft haben Sie wohl die Wahrheit und die Gesetzesparagraphen ebenso verdreht wie ich!?"
"Ja, ja! Wollen Sie entschuldigen", sagte der Advokat, "aber ich war nie so glücklich, die Bekanntschaft Ihrer Person . . . ."
"Verstehe schon, geehrter Herr!" und der Teufel drückte ihm die Hand. "Ihr Menschen seit etwas furchtsam, scheu - mit Unsereinem. Ich kenne das! - Wo fahren Sie hin?"
"In die Dörfer da herum. Habe da einige Arbeit."
"Weiß schon! - Sie fahren, die Schuldner zu mahnen, die Ihnen für verlorene Prozesse noch schulden. - Aber, Sie Schelm, Sie haben gleich anfangs gewusst, wie es ausfallen würde, weil Sie eine ungerechte Sache vertraten."
"Ich bitte Sie, der Mensch will leben", entschuldigte sich der Advokat.
"Aber, Herr, wozu denn diese Entschuldigung? Ganz gut haben Sie gehandelt. Der Mensch lebt ja nicht nur vom Wort Gottes, sondern - hauptsächlich von dem auf jede Art verdienten Brot", scherzte der Teufel. Und er spann das Gespräch weiter und weiter, so geschickt und witzig, dass der Advokat der Pferdefuß vergaß, zum Teufel näher heranrückte und endlich selbst zu scherzen begann. Er zog ein Stück Schinken aus seiner Reisetasche Hervor und forderte seinen Gast auf: "Bitte, wollen Sie sich bedienen, wenn Sie nämlich in der Hölle keinen Fasttag haben."
"O, kommt mir gerade recht." Der Teufel schnitt sich ein Stück Schinken ab, aß mit Appetit und zog dann plötzlich eine Flasche und ein Gläschen hervor. Er schenkte ein und reichte es dem Herrn Advokaten: "Bitte, wollen Sie den Wein kosten. Ist in meinen eigenen Weinbergen gewachsen."
Der Advokat trank, er schnalzte mit der Zunge und lobte den Tropfen! "Das ist ein Wein! Einen solchen habe ich noch nicht getrunken! Der besitzt Feuer!"
"Jawohl!" lächelte der Teufel verschmitzt.
Der Advokat war von dort an eitel Witz und Scherz.
"Und wohin fahren Sie, geehrter Freund?" fragte er den Teufel.
"Ich? Ich fahre so in der Welt umher, um etwas zu erjagen."
In dem Augenblick kamen sie aus dem Wald heraus. Sie holten eine Frau ein. Sie fuhr auf einem mit einer Kuh bespannten Karren Rüben ein.
"Haho!" schrie der Kutscher.
Die Kuh erschrak, sprang in den Straßengraben hinein und warf den Wagen um.
"Der Teufel soll dich holen, du abscheuliches Vieh!" schrie die Frau.
Der Advokat neigte sich zu dem Teufel hin und flüsterte ihm ins Ohr: "Bitte, wollen Sie die Kuh an sich nehmen. Sie ist Ihnen ja überwiesen."
"Sie irren sich!" lachte der Teufel. "Die Frau sprach nur so in den Wind, es kam ihr nicht von Herzen! Die Kuh ist ihr einziges Vermögen. Wenn ich ihr sie nehmen würde, würde sie über mich ihr Lebtag jammern und alle Leute gegen mich aufhetzen."
Sie fuhren weiter. Die Straße führte über einen steilen Hügel. Die Pferde gingen langsam und schnaubten schwer. Noch schwerer aber atmete der Mann, der vor ihnen einen Zweiräder mit Töpfergeschirr bergauf schleppte. Hinten auf dem Karren saß ein etwa zehnjähriger Knabe. Eigentlich sollte er nicht sitzen. Er sollte gehen und dem Vater durch nachschieben behilflich sein.
Plötzlich blieb der Mann stehen, sah sich um, und als er den Knaben sitzen sah, schrie er: "Du verdammter Bub, so schiebst du nach? Der Teufel soll dich holen!"
Der Advokat lachte und sagte dem Teufel: "Der Bub ist doch der Konfiskation wert! - Er gehört Ihnen!"
"Mit Nichten! Der Vater hat es nicht ehrlich gemeint. Der Bub ist sein einziger, und wenn ich ihn wegnehmen würde, würde der Vater in einem Jahr sterben - und noch dazu reuevoll! Nein, nein! Fahren wir weiter!" -
Als sie den Hügel überwunden hatten, sahen sie ein Dorf vor sich.
"Hier habe ich zu tun", sagte der Advokat.
"Wenn Sie erlauben, fahre ich mit Ihnen und erwarte Sie."
"Wie Sie wollen!"
Im Dorf blieb die Kutsche stehen und beide Herren gingen in das Haus Nr. 16.
Als der Bauer den Advokaten sah, brummte er etwas vor sich hin.
"Nun, Bauer", fragte ihn der Advokat, "warum schicken Sie mir kein Geld? Ich habe Ihnen schon zweimal geschrieben!"
"Geld? Und wofür? Ich hab ja verloren!"
"Das geht mich nichts an. Ich hatte Arbeit und Auslagen; dafür verlange ich Zahlung! Wenn Sie es nicht im Guten tun, lass ich Sie pfänden", sagte der Advokat trocken.
"Warum haben Sie eine ungerechte Sache vertreten?" murrte der Bauer.
"Und warum haben Sie ungerechterweise geklagt? Warum haben Sie mir nicht gleich die Wahrheit gesagt? Sie haben mich betrogen! Zahlen Sie, sonst . . ."
"Wie viel macht es denn?" fragte der Bauer.
"Ich habe es schon aufgeschrieben! 130 Taler." Der Advokat legte dem Bauern die Rechnung vor.
Der Bauer schlug die Hände zusammen und ging ins Nebenzimmer. Im Augenblick kam er zurück, nahm das Geld, zählte es dem Advokaten vor und erbat sich von ihm die Quittung.
Als alles in Ordnung war und der Advokat süß lächelnd dem Bauern zum Abschied die Hand reichte, sagte der: "Der Teufel soll dich holen!"
Der Advokat lachte dazu und ging von dannen. An der Tür erwartete ihn der Teufel. Er verneigte sich vor dem Advokaten und sagte verschmitzt: "Dem ist es vom Herzen gekommen! Bitte, lieber Freund, wollen Sie mitgehen?"
* * *
Wenn ich auch diese Geschichte geschrieben habe, so wollte ich damit nicht etwa sagen, dass alle Advokaten unehrlich wären. Dies zu behaupten, wäre eine Ungerechtigkeit; denn der Advokatenstand ist auch ein ehrenwerter Stand und die meisten seiner Mitglieder sind ehrenwert gegenüber solchen, die es nicht sind, deshalb kann nicht der ganze Stand dafür zur Verantwortung gezogen werden. - Der Teufel holt sich aber nicht nur unehrliche Advokaten, er holt auch andere unehrliche Leute. Darum hüte dich, dass dich der Teufel einmal nicht hole. Sei ehrlich in jeder Beziehung und sollten sie dich deshalb auch einen Rückschrittler oder Finsterling nennen. Sei ein Christ! Die Hölle ist nicht unser Vaterland - sondern der Himmel! -
________________________________________________________________________

26. Der Landsknecht - Von Hermann Weber
Ein Apriltag des Jahres 1633 war angebrochen.
Ungewöhnlich früh hatte der raue Winter seinen Abschied genommen; hell und warm schien die Sonne vom Himmel hernieder und trieb das junge Grün zur Entfaltung - doch im Herzen der Menschen wollte der Frühling nicht auferstehen. Eine schwere Kriegszeit hatte die deutschen Staaten verwüstet und lag wie ein Bann auf den Bewohnern. -
Auf der Landstraße zwischen den bayerischen Ortschaften Buchloe und Landsberg rollte eine altertümliche Reisekutsche dahin.
Der Führer des Gefährtes trieb seine Pferde ununterbrochen zur Eile an, um möglichst bald nach dem befestigten Landsberg zu gelangen, denn das Gerücht, dass der Schwedenführer Torstenson mit seinen Scharen im Anmarsch sei, hatte sich schreckenerregend verbreitet.
Im Innern des Reisewagens befanden sich zwei Personen: eine bejahrte, ehrwürdige Dame, die Mutter des Bürgermeisters Buchner von Landsberg, und ihr Enkelkind Maximilian, ein frischer, zwölfjähriger Knabe.
"Wie schrecklich ist doch diese Zeit; nichts wie Krieg und Verderben!" seufzte die Greisin und streichelte liebkosend den Kopf des Knaben. "Gebe Gott, dass wir noch rechtzeitig in unsere Stadt gelangen, ehe die wilden Schweden herbeikommen. Hätten wir doch unseren Besuch in Buchloe abgekürzt und wären einige Tage früher aufgebrochen!"
"Gräme dich nicht, Großmutter", antwortete aber lebhaft der Knabe, "bevor wir unsere Reise antraten, habe ich noch einmal recht innig zum lieben Gottessohn gebetet, damit er uns seinen Schutz angedeihen lässt: er wird uns gewiss beistehen, wenn eine Gefahr an uns herantreten sollte!"
"Du hast recht, mein Kind; wir wollen dem Schöpfer vertrauen!" murmelte die alte Frau, dann aber setzte sie wieder besorgt hinzu: "Noch gestern vernahm ich, dass die Schweden näher sind als man gedacht hat; ihre Kundschafter sollen schon die Straßen unsicher machen, und die größeren Abteilungen, die an verborgener Stelle rasten, können jeden Tag hervorbrechen."
Während dieses Gespräches hatte die Kutsche eine Strecke der Landstraße erreicht, deren Boden tief ausgefahren und uneben war, und das Gefährt schwankte jetzt so heftig hin und her, dass die Unterhaltung zwischen Großmutter und Enkel stockte und beide sich dicht zusammenschmiegten.
Jetzt tauchte dort, wo die Landstraße eine weite Biegung machte, ein breiter Streifen dunklen Buschwerkes auf, und kaum hatte der Reisewagen diese Stelle erreicht, als eine raue Stimme durch die Luft dröhnte und der Knall eines Pistolenschusses folgte.
Der Kutscher peitschte angstvoll auf die Pferde, so dass die Tiere in rasender Schnelligkeit dahinstürmten, doch hinter ihnen erscholl rasch näherkommendes Pferdegetrappel, und als die alte Frau jetzt einen Blick durch das Fenster des Wagens warf, sank sie mit einem lauten Aufschrei auf ihren Sitz zurück.
In gestrecktem Galopp, tief auf den Hals der Pferde niedergebeugt, sprengten zwei schwedische Söldner heran. Ihre wilden Gesichtszüge glühten in Hass und Raubgier und auf ihren blanken Waffen spiegelte sich die Sonne; ohne Zweifel hatten sie, in dem Gebüsch verborgen, das Näherkommen der Reisekutsche erwartet, um die Insassen anzufallen und auszurauben.
Nach einigen Minuten schon hatten sie die keuchenden Wagenpferde überholt.
Der eine der Wegelagerer griff den Tieren in die Zügel und riss gleichzeitig das breite Schwert aus der Scheide, um den Wagenlenker unschädlich zu machen, falls dieser sich zur Wehr setzen würde. Doch der waffenlose Mann hatte das Nutzlose eines Widerstandes eingesehen und die Zügel sinken lassen.
Der zweite der wilden Gesellen sprang jetzt vom Pferd und öffnete den Schlag der Kutsche. Während die Greisin ohnmächtig zurückgesunken war, streckte der Knabe zitternd die Hände empor.
"O tut uns nichts zuleide!" flehte er mit angstvollen Blicken. "Ihr sollt ja alles erhalten, was wir bei uns führen, aber schont unser Leben!"
"Gebt euer Geld und eure Kostbarkeiten heraus!" rief der Söldner mit roher Stimme und durchsuchte rasch die Taschen der Ohnmächtigen.
Nachdem das geschehen war, ergriff er die kleine Geldbörse, die der Knabe ihm hinreichte, und war noch beschäftigt, der alten Frau einen goldenen Reif mit Gewalt vom Finger zu ziehen, als sein Gefährte, der bisher den Kutscher überwacht und die Landstraße hinabgespäht hatte, sein Schwert in die Scheide zurückstieß und erschrocken ausrief:
"Achtung, Olaf - dort kommt Hillebrecht, unser Korporal!"
Der am Boden stehende Schwede hatte kaum diese Worte vernommen, als er hastig zurücksprang und die geringwertige Beute in seiner Tasche verbarg. Jetzt bestieg er mit einer wilden Verwünschung sein Pferd und winkte dem Kutscher, den Weg fortzusetzen. Doch der, vom Schreck noch halb gelähmt, vermochte nicht sofort, seiner Weisung zu folgen.
Die Straße herauf, dem Ort des Überfalls zu, kam ein einzelner jugendlicher Landsknecht geritten.
Er war von wahrhaft herkulischem Gliederbau und überragte wohl um Kopfeslänge seine plündernden Kriegsgenossen; seine Gesichtszüge waren von kraftvollem, männlichem Ausdruck und das lockige, blonde Kopfhaar hing ihm bis fast auf die breiten Schultern hernieder.
Ein Gefecht vermutend, hatte der Reiter die Pistolen aus dem Gürtel gezogen und stürmte jetzt mit lautem Kampfruf heran. Doch erstaunt wich er zurück, als er den Reisewagen erreicht und einen Blick in das Innere geworfen hatte.
"Was tut ihr hier?" wandte er sich dann mit finsteren Gesichtszügen an die beiden Söldner.
"Wir haben ein wenig Beute gemacht", antwortete der ältere der Wegelagerer, "schimpfe nicht mit uns, Hillebrecht: sobald wir die Sachen verkauft haben, sollst Du als Anteil ein Drittel des Erlöses erhalten."
"Feige Burschen!" zürnte aber der Korporal mit unverkennbar deutschem Ausdruck in der Sprache. "Anstatt die Befehle unseres Obersten auszuführen und die Stärke der Landsberger auszukundschaften, überfallt ihr Frauen und Kinder? . . . Gebt sofort die geraubten Sachen zurück und dann fort mit euch, wenn ihr nicht wollt, dass ich beim Obersten Meldung erstatte!"
"Beutemachen ist Kriegsbrauch!" murmelte der ältere der Gemaßregelten, und machte einen Versuch, sich zu widersetzen, doch mit einem Zügeldruck warf Hillebrecht sein Pferd herum und fasste ihn an die Schulter, so dass der Widerspenstige im Sattel wankte und sich scheu zusammenduckte. Dann setzte der Korporal mit funkelnden Blicken hinzu:
"Gebt sofort die Sachen zurück oder ihr sollt mich kennen lernen!"
Einen Blick voll Hass und Furcht auf seinen Vorgesetzten werfend, ließ der Schwede die Wertsachen zu Boden gleiten. Dann setzte er sich im Sattel zurecht und ritt, von seinem Gefährten gefolgt, davon.
Der Korporal sprang vom Pferd, raffte die Gegenstände zusammen und trat an den Wagenschlag heran.
"Nehmt euer Eigentum zurück", sagte er rau, aber nicht unfreundlich, "und beeilt euch, in den Schutz eurer Stadtmauern zu gelangen, denn auf dieser Straße ist kein Platz mehr für Frauen und Kinder! Ehe drei Tage vergehen, wird der Lärm des Krieges hier ertönen."
Er reichte die Wertsachen der wiedererwachten alten Frau und wollte sich abwenden, doch dann fügte er erstaunt hinzu: "Was tust du, Knabe?"
Der Bürgermeistersohn, der bisher auf dem Boden des Wagens gekniet hatte, erhob sich jetzt und sagte leise:
"Ich habe zu Gott gebetet, dass er uns aus großer Gefahr gerettet hat!"
"Du hast gebetet?" lachte der Korporal, "nun, so ein Gebet mag ja recht heilsam sein für alte Leute und schwache Kinder, ein Mann aber muss sich selbst zu helfen wissen! Sie her" - und mit raschem Griff hatte er das scharfe Schwert entblößt und schwang es sausend im Kreis - "dies ist mein Gebet, Knabe, und solange ich noch kraftvoll den Stahl führen kann, brauche ich kein anderes! . . . Doch nun fort mit euch; von den Burschen, die vorausgeritten sind, habt ihr nichts zu befürchten, denn ich werde sie im Auge behalten." -
Um Landsbergs Mauern brannten die Wachtfeuer.
Im wilden Ansturm hatten die Schweden den Kampf begonnen, doch war es ihnen bisher nicht gelungen, die tapferen Bewohner der kleinen Stadt zur Übergabe zu zwingen.
Da brachte einer der Spione die Nachricht, dass eine Strecke der südlichen Stadtmauer recht schwach besetzt sei; sofort schickte Oberst Torstenson unter dem Dunkel der Nacht mehrere Geschütze, sogenannte Feldschlangen, die Eisenkugeln von zwanzig Pfund Gewicht warfen, dorthin und stellte eine kleine Schar der bewährtesten Krieger unter den Befehl des Korporals Hillebrecht, damit bald ein Eingang in die Stadt erzwungen würde.
Die Landsberger waren aber auf der Hut.
Wohl war die schwache Besatzung in weiten Abständen verteilt, doch als beim Morgengrauen aufs neue der Kampf begann und mit verstärktem Eifer auf jene südliche Stadtmauer gerichtet war, da beteiligten sich alle Bewohner an der Verteidigung: halbwüchsige Knaben und zarte Jungfrauen, zitternde Greise und schwache Mütter, niemand wollte zurückbleiben, wo es galt, die Vaterstadt zu retten.
Schwere Steine warf man auf die stürmenden Schweden, kochendes Wasser goss man auf sie hernieder und krachende Donnerbüchsen sandten den Tod in ihre Reihen.
Wild tobte der Verzweiflungskampf und schon glaubten die Landsberger, den Sturm siegreich zurückgeschlagen zu haben, als ein Teil der zerschossenen Stadtmauer zerbrochen zusammenstürzte.
Mit Entsetzen sahen die Verteidiger dieses Unglück; dann aber eilten eine Anzahl der tapfersten Männer an die klaffende Bresche und es gelang ihnen, den Trupp eingedrungener Schweden zu umzingeln, die Nachstürmenden zurückzuwerfen und die Bresche mit schweren Gegenständen notdürftig zu verschließen.
Der Schwedenoberst gab Befehl zum Rückzug, als der Sturm abgeschlagen war, und eine Ruhepause trat ein. Mittlerweile hatten die eingedrungenen Söldner, an ihrer Spitze Hillebrecht, den Kampf fortgesetzt und waren getötet worden, da sie sich nicht ergeben wollten; nur der deutsche Anführer, geschwächt und verwundet, stand noch aufrecht.
Da traf ein Keulenhieb seinen Arm; klirrend stürzte das zerbrochene Schwert nieder, das Hillebrecht bisher verzweifelt geschwungen hatte und stöhnend sank der starke Mann zusammen.
Einer der erbitterten Landsberger rief einige Worte, die jubelnd aufgenommen wurden, zu seinen Kameraden hinüber; dann zerrte man den wehrlosen Landsknecht zu einer alten Linde hin, die ihre Äste und Zweige über die Stadtmauer emporstreckte.
Ein junger Bursche erkletterte den Baum und warf das Ende eines Strickes über den stärksten Ast. Dann legte man eine rasch geknotete Schlinge um den Hals des Korporals und wollte ihn, als abschreckendes Beispiel für seine Kriegsgenossen, erbarmungslos emporziehen, als ein lauter Aufschrei ertönte.
Durch die Reihen der Zuschauer stürzte Maximilian Buchner, der Sohn des Bürgermeisters; er hatte an der Verteidigung der Stadt wacker mitgeholfen, denn seine Kleidung war zerrissen und mit Schmutz bedeckt. Voll tiefen Mitleids betrachtete er einen Augenblick die kaum noch erkennbare Gestalt des Landsknechtes, dann wandte er sich bittend zu den Männern.
"Schenkt ihm das Leben!" sagte er flehend. "Er ist ein guter Mann, wenn er auch zu unseren Feinden gehört, denn er hat noch vor einigen Tagen die Großmutter und mich beschützt, als uns die Kundschafter der Schweden auf der Landstraße überfallen hatten."
"Er hat aber gegen uns gestritten und viele unserer Männer verwundet!" rief einer der Landsberger.
"Das ist im offenen Kampf geschehen", antwortete ihm der Knabe, "was ihr aber jetzt beginnen wollt, ist tapferer Krieger unwürdig!"
"Wir haben den Mann gefangen und werden mit ihm tun, was uns beliebt", bestimmte der Soldat trotzig, "also tritt zur Seite, damit wir ein Ende machen."
"Ist denn niemand hier, der mir beisteht!" rief der Bürgermeistersohn ratlos und verzweifelt - dann aber glitt es plötzlich wie ein Hoffnungsschimmer über seine Züge. "Ihr dürft den Mann nicht töten, bevor er nicht mit seinem Gott gesprochen hat!" fügte er in eindringlichem Ton hinzu. "Gönnt ihm eine Frist, dass er ein Gebet sprechen und rechte Einkehr mit sich selbst halten kann - wollt ihr mir das versprechen?"
"Die Frist soll ihm gewährt werden; niemand soll ihn stören bei seinen letzten Gedanken!" scholl es zurück.
Mit zwei Schritten stand Maximilian jetzt vor dem Verurteilten, der ihn mit seltsamen Blicken anschaute.
"Betet zu Gott, dass er Euch barmherzig sei!" sagte der Knabe und fügte leise und bedeutungsvoll hinzu: "Betet recht lange und inbrünstig, denn bevor Ihr nicht selbst das Zeichen gebt, wird man nicht Hand an Euch legen!"
Damit verschwand er unter der Menge, die sich schweigend zusammenscharte und unwillkürlich die Blicke senkte.
Der Verurteilte stand regungslos und schaute zu dem blauen Himmel empor; doch wie ein Flor lag es vor seinen Blicken. Er wollte beten, aber er konnte keine zusammenhängenden Sätze finden.
"Herr, mein Gott, vergib" - murmelte er leise und machte einen Versuch, die Hände zu falten; dann schlossen sich seine Augen, die so oft die Gräuel des Krieges gesehen hatten, und eine wundersame Ruhe und Ergebenheit zog in das Herz des rauen Mannes ein. Seine Gedanken wanderten weit zurück in eine stille Heidegegend des deutschen Landes, wo eine alte Mutter seit Jahren auf seine Rückkehr wartete; er sah alles wieder, was er im Lärm des Kriegerlebens vergessen hatte: das strohgedeckte Heimathäuschen, die grünen Wiesen und die dunklen Tannenwälder, und eine schmerzliche Sehnsucht nach diesen friedlichen Stätten erfasste ihn plötzlich.
Ein Schluchzen rang sich aus der Brust des Mannes und machte seine Glieder erzittern; noch einmal schaute er zur Sonne hinauf, dann streckte sich seine starke Gestalt und seine Lippen flüsterten: "Mein Herrgott, Barmherzigkeit!"
Ein Ruck, eine zitternde Bewegung geht durch den Strick - schon suchen die Füße des Unglücklichen vergebens nach einem Ruhepunkt - da sprengt ein Kurier des Obersten de Fossa, des Kommandanten von Landsberg, auf den Platz und ruft schon von weitem: "Halt! Halt!" Und hinter ihm drein eilt Maximilian Buchner und schwingt jubelnd ein Stück Papier in der Hand.
Der Strick gleitet aus den Händen der Männer und schwer stürzt der Korporal nieder. Aber sein Leben ist gerettet: Oberst de Fossa, der Menschenfreund, hat ihn begnadigt. -
Einige Tage später zog Graf Otto Heinrich Fugger mit seinen Kriegsleuten heran und befreite Landsberg von den Schwedenhorden. Der deutsche Landsknecht blieb noch mehrere Wochen im Haus des Bürgermeisters, und als er dann genesen war, rüstete er sich, um in die Heimat zurückzukehren und sesshaft zu werden.
Eine ernste Wandlung war im Innern des jungen Mannes vorgegangen. Wohl war er noch stark und mutig, wie früher, aber in seinem Herzen hatten auch der Glaube und die Demut ihren Platz gefunden.
Er hatte eingesehen, dass auch der kraftvollste Arm und das schärfste Schwert wertlos sind, wenn sie sich erkühnen, gegen den Höchsten ankämpfen zu wollen.
________________________________________________________________________

27. Der Sohn des Sklaven - Von Stephardt
Es war am 15. März 1735. In Marseille, der südfranzösischen Hafenstadt, hatte der Frühling schon seinen Einzug gehalten und heute strahlte die Sonne so freundlich und blühten die Blumen so schön, als wollte die ganze, neu erwachte Natur teilnehmen an dem Fest, das die Stadt beging. Der Tag war ein Freudentag. Und das mit vollem Recht. Gestern Abend war ein Schiff im Hafen gelandet, an dessen Bord sich mehrere fromme Priester aus dem Orden von der heiligsten Dreifaltigkeit befanden, die in Afrika gewesen waren, um dort Christensklaven aus den Fesseln der Sklaverei zu befreien und in ihr Vaterland zurückzuführen. Den nimmermüden Bemühungen der Ordensleute, die dabei gar oft ihre Freiheit und ihr Leben aufs Spiel setzten, war es gelungen, eine beträchtliche Anzahl von Christenjungen loszukaufen und ihnen die Freiheit wiederzugeben. Diese losgekauften Christensklaven waren zugleich mit den Ordenspriestern auf dem Schiff und warteten voll Sehnsucht auf den Augenblick, wo sie wieder heimatlichen Boden betreten konnten, um die alte Heimat und liebe Verwandte und Bekannte, die für ihre Befreiung vielleicht den letzten Pfennig geopfert hatten, zu begrüßen. Und denen, die alles getan hatten, um ihren durch die Korsaren, von denen es damals noch wimmelte auf dem Mittelmeer, geraubten Lieben mit Hilfe der opfermütigen Ordensleute die Freiheit wiederzugeben, warteten voll Ungeduld am Ufer auf die Ausschiffung der Angekommenen. O, wie manches Herz klopfte da in banger Freude! Hier hoffte eine Familie den Vater wiederzufinden, dort ein Vater den Sohn, eine Mutter die Tochter.
Die ganze Stadt schien in Bewegung zu sein und strömte hinaus nach dem Hafen. Jedermann wollte dabei sein, wenn die Ordensleute ausstiegen und wenn die befreiten Sklaven die heimatliche Erde wieder betraten. Gegen zehn Uhr kam auch der hochwürdigste Herr Bischof mit dem Klerus und nun begann sofort die Ausschiffung. Währenddessen läuteten die Glocken der Stadt, die Fahnen wehten und aus tausend Menschenkehlen erscholl ein Freudenruf, als die erste Barke vom Schiff abstieß und nach dem Land ruderte. Dieser ersten Barke folgte sofort eine zweite, dann eine dritte usw., bis alle, die auf dem Schiff gekommen waren, wieder festen Boden unter den Füßen hatten. Sooft sich eine Barke dem Ufer näherte, drängte sich das Volk heran, und jeder wollte den Aussteigenden zuerst die Hand reichen zum Gruß in der christlichen Heimat. Die Ordner hatten vollauf zu tun, um ein Unglück zu verhüten. Wie manch schönes Wiedersehen wurde da gefeiert, wie viele Freudentränen flossen! Hier rief ein Kind seinen Vater, eine Schwester ihren Bruder, dort streckte ein Freund seine Arme aus nach dem Freund, den er schon von fern erblickt hatte.
Die Patres waren vollauf beschäftigt, Ordnung zu halten. Sie leiteten die Ausschiffung, legten überall hilfreiche Hand an, sagten hier noch ein Wort des Trostes zum Abschied, freuten sich dort mit den Freunden oder trösteten die, die unter den Befreiten ihre Anverwandten nicht gefunden und sich vergeblich auf ein Wiedersehen gefreut hatten. Als dann alles geordnet war und sich kein aus der Sklaverei Befreiter mehr auf dem Schiff befand, zogen sie, ohne ein Wort des Dankes abzuwarten, still von dannen, um ihr Kloster aufzusuchen und dort vor dem Tabernakel dem lieben Gott für die glückliche Heimkehr zu danken für alles, was sie Gutes wirken konnten. Sie sehnten sich nicht nach dem Lohn und Dank der Welt; ihr einziges Verlangen für all die Mühen und Opfer, die sie auf sich genommen hatten, um die Unglücklichen zu befreien, war Gottes Lohn. Man ließ die Patres ziehen. Niemand schien auf sie zu achten. Jetzt hatte man nur Auge und Sinn für die aus der Sklaverei Befreiten. -
Unter der Menge, die der Ausschiffung zugesehen hatte, war auch ein Fremder, der seiner Kleidung nach ein wohlhabender Herr sein musste. Als die Patres sich zum Fortgehen anschickten, verließ auch er seinen Platz und folgte den Priestern nach. Sobald er sie erreicht hatte, wandte er sich an einen von ihnen, den er für den Vorgesetzten hielt und sagte: "Ehrwürdiger Herr, verübeln Sie mir es nicht, dass ich mich an Sie herandränge und Sie belästige, um noch einiges über Ihre Arbeiten in Afrika und über die Sklaverei dort selbst zu erfahren. Ist es Ihnen nicht lästig, mir einiges zu erzählen?"
"Nicht im geringsten", entgegnete der Angeredete freundlich und ging sofort an die Seite des Unbekannten, um ihm alle Fragen leichter beantworten zu können.
"Wenn ich mich nicht täusche", nahm der Fremde das Wort, "überstieg die Zahl der durch Sie befreiten Christensklaven, die heute ihre Heimat wiedersahen, zweihundert. Ist es nicht so?"
"Ja", gab der Ordensmann zur Antwort, "es ist so. Es waren über zweihundert und doch so wenige im Vergleich zu den vielen, die noch in den Ketten der Sklaverei seufzen und sich nach Freiheit und Rückkehr in die Heimat sehnen. Die Almosen, die die christliche Liebe der Gläubigen uns in den drei letzten Jahren zukommen ließ, waren aufgebraucht, und so weh es auch dem Herzen tat, so viele Unglückliche zurücklassen zu müssen, konnten wir doch niemand mehr befreien. Es sind ohnedies drei unserer Patres zurückgeblieben, um durch ihre Hingabe noch drei Slaven zu befreien."
"Warum das?"
"Warum unsere Brüder dort blieben, um für andere die Sklavenketten zu übernehmen? Die Liebe Christi drängt uns, dem hl. Apostel Paulus gleich allen alles zu werden, und die heiligen Stifter unseres Ordens, Johannes von Matha und Felix von Valois, verlangen von uns, dass wir bereit sind, in besonderen Fällen uns für die Befreiung armer Christensklaven hinzugeben. Und solch besondere Fälle waren eben hier. Die drei zuletzt noch befreiten Sklaven waren alt, sie hätten die Gefangenschaft und die harten Sklavendienste also nicht mehr lange ertragen, und ihr Herz sehnte sich so sehr nach Freiheit und nach der Heimat."
Der Fremde seufzte. "Hochwürden", sagte er, "wie schade, dass Sie nur französische Christensklaven befreien."
"Wer sagt denn das?" fiel der Ordensmann rasch ein. "In unserem Orden sind Brüder aus fast allen Nationen, von allen christlichen Nationen empfangen wir Almosen für die Befreiung armer Christensklaven, und wenn wir in Afrika sind, fragen wir nicht nach der Nation, der jeder angehört. Ob der christliche Sklave, den wir finden aus dem Norden oder Süden stammt, alle sind uns gleich lieb, für alle tun wir das gleiche."
In den Augen des Fremden leuchtete es auf wie ein froher Hoffnungsstrahl. "Befreien Sie also auch Italiener?" fragte er.
"Gewiss!" gab der Ordensmann zur Antwort. "Und um Ihnen zu beweisen, dass dem wirklich so ist, will ich Ihnen gleich sagen, dass die drei befreiten Sklaven, für die drei Mitbrüder in Afrika blieben, alle drei Italiener waren."
"Wie? Drei Italiener?" rief der Fremde.
"Ja, drei Italiener."
"Und alt waren sie?"
"Ja, sie waren alt."
"Und wissen Hochwürden vielleicht zufällig, aus welcher Gegend Italiens die drei befreiten Sklaven stammten?"
"Wenn ich mich nicht täusche, sind es Sizilianer. Aber das können wir ja gleich sehen, wenn es Sie interessiert; ich habe mir nämlich nicht nur die Heimat der befreiten Christensklaven, sondern auch ihre Namen und die Art aufgeschrieben, wie sie in die Gefangenschaft gekommen waren."
"Wie? Sie haben die Namen aufgeschrieben, die Namen der drei italienischen befreiten Christensklaven? Bitte, bitte, sagen Sie mir ihre Namen. Es liegt mir sehr viel, ungeheuer viel daran, sie zu erfahren."
Der Mönch griff in die Tasche seines weißen, auf der Brust mit einem großen blau roten Kreuz geschmückten Ordenskleides und zog ein Büchlein hervor, das er öffnete und darin blätterte. Endlich hatte er die gesuchten Namen gefunden. "Hier sind sie", sagte er, "ich werde sie Ihnen vorlesen. Hören Sie also. 1. Paul Guarnero, 75 Jahre alt, wurde geboren in Catania und von den Korsaren auf dem neapolitanischen Schiff "Vesuvio", dessen Schiffsarzt er war, im Jahr 1719 gefangen genommen, war also 16 Jahre in der Sklaverei. 2. Paul Bancolo, 80 Jahre alt, wurde geboren . . . ."
"Wie? Wie? rief der Fremde, indem er hastig den Arm des Mönches erfasste und drückte. "Wie? Haben Sie sich nicht verlesen? Heißt es wirklich Paul Bancolo? Bitte, bitte, lesen Sie den Namen noch einmal."
"Nein, ich habe mich nicht verlesen. Doch, überzeugen Sie sich selbst davon. Hier steht der Name. Bitte lesen Sie, damit Sie sehen, dass ich ihn richtig gelesen habe."
Der Fremde nahm das dargebotene Büchlein und las. Ja, da stand wirklich, wie der Mönch gelesen hatte: Paul Bancolo, 80 Jahre alt, . . . . gefangen genommen und in die Sklaverei geschleppt bei der Insel Sira.
"Ja, ja, er ist es", sagte der Fremde, als er das Buch zurückgab, "er muss es sein", und seine Stimme zitterte leise, als er weiter fragte: "Hochwürden, können Sie mir vielleicht sagen, wo dieser arme Greis sich jetzt befindet?"
"Auch das kann ich Ihnen sagen", gab der Mönch zur Antwort. "Paul Bancolo fand beim Grafen Lonzeron, dem Gouverneur von Marseille, gastliche Aufnahme. Dieser edle Herr ist immer zum Helfen bereit, nicht nur, wenn Krieg und Krankheit das Vaterland verwüsten, sondern auch in den Zeiten des Friedens ist sein Haus für die Armen und Unglücklichen immer geöffnet. Er nimmt die befreiten Christensklaven immer bei sich auf und pflegt sie, bis sich Gelegenheit zur Weiterreise in die Heimat bietet. So fand auch Paul Bancolo beim Gouverneur gastliche Aufnahme, und er wird so lange dort bleiben, bis ein Schiff nach Italien fährt, das ihn zurückbringen kann in die Heimat, zurück zu den lieben Seinen, die ihn gewiss sehnsüchtig erwarten. Doch sagen Sie, ist Paul Bancolo vielleicht ein Verwandter von Ihnen?"
"Das sollen Sie heute noch erfahren", entgegnete der Fremde. "Wo kann ich Sie wieder treffen?"
"Kommen Sie zu unserem Kloster und fragen Sie dort nach dem Pater Blasius."
"Und wann kann ich kommen?"
"Wie es passt für Sie. Ich bin jeder Zeit zu Ihrer Verfügung."
"Ich werde kommen, Hochwürden. Und nun erst recht herzlichen Dank für das, was Sie mir gesagt haben. Wenn es wahr ist, was ich hoffe, dann haben Sie mir die glücklichste Mitteilung meines Lebens gemacht. Also, auf Wiedersehen und vorläufig nochmals herzlichen Dank."
"Behüt Sie Gott! Auf Wiedersehen."
Der Fremde entfernte sich eiligen Schrittes und Pater Blasius schaute ihm verwundert nach. Der Mönch wusste nicht, was er von den Worten des unbekannten Mannes halten sollte. "Die schönste Nachricht seines ganzen Lebens!" Was konnte das sein? -
Das Kloster war erreicht. Die Klosterpforte öffnete sich und die Mönche traten ein in ihr stilles Heim, das sie vor etwa Jahresfrist verlassen hatten, um armen Christensklaven, deren es damals Tausende und Tausende im heißen Afrika gab, die ersehnte Freiheit zu bringen. Ihr erster Gang galt nun dem friedlichen Klosterkirchlein. Dort knieten sie nieder und weilten lange still im Gebet vor dem Tabernakel, um dem göttlichen Heiland für die glücklich vollendete Reise zu danken und dafür, dass es ihnen gelungen war, so viele Unglückliche aus den Ketten der Sklaverei zu befreien. Und das ewige Lichtlein warf seine roten Lichtwellen auf die stille Beter, und es flackerte auf, als freue es sich über den Opfersinn jener, die von der gefahrvollen Arbeit heimgekehrt, an den Stufen des Altares knieten. - - -
Der Abend war gekommen und die Glocken der Klosterkirche sangen der lieben Gottesmutter soeben ihr Avelied. Da schellte es an der Klosterpforte und zwei Fremde begehrten den Pater Blasius zu sprechen.
Der Bruder Pförtner hieß die beiden in das einfache, freundliche Sprechzimmer des Klosters eintreten und ging dann, um den Pater zu rufen.
Es dauerte nicht lange, da war Pater Blasius zur Stelle. Kaum hatte er die beiden Fremden erblickt, so eilte er auf den älteren von ihnen zu und rief: "O Bancolo, Sie sind es?"
"Ja, ich selbst", entgegnete der Angeredete, ein Greis im Silberhaar, dem tiefe Furchen, die Zeugen von schwerem Leid ins Antlitz geschrieben waren. "Ich bin es, Pater Blasius. Und hier" - der Greis deutete auf den jüngeren Herrn - "ist mein Sohn, der denselben Namen hat, wie ich, Paul Bancolo."
Pater Blasius sah auf und erkannte sofort den Fremden, mit dem er am Nachmittag gesprochen hatte.
"Ihr Sohn?"
"Ja, Hochwürden", nahm der jüngere Herr das Wort, "Paul Bancolo ist mein Vater. Ich vergaß heute morgen ganz, Ihnen meinen Namen zu nennen, und so konnten Sie nicht ahnen, was mich so aufregte, als Sie den Namen Paul Bancolo nannten. Das war ja der Name meines Vaters, von dem die Mutter und ich meinen mussten, er sei längst gestorben, den wir längst als einen Toten beweinten."
"Und der doch noch lebte", fiel der Greis ein, "und der es diesen frommen Ordensleuten verdankt, dass er nun die Seinen noch einmal wiedersehen darf, dass er in der Heimat sterben kann, und dass seine Gebeine einst in geweihter Erde ruhen werden. Dafür kann ich nie genug danken, nie, nie, um so weniger, da ich nicht einmal mit Geld losgekauft wurde, sondern einer Ihrer Mitbrüder sich für mich in die Sklaverei gab. Hochwürden, wie soll ich Ihnen das danken?"
"Indem Sie dem lieben Gott für die wiedererlangte Freiheit danken, diese gut gebrauchen, und indem Sie Ihrer armen, in Afrika noch zurückgebliebenen Mitbrüder nicht vergessen."
"Nein, ich werde nie vergessen, was ich die langen Jahre hindurch gelitten habe, was ich Ihnen verdanke, und wie ich dem lieben Gott für die wiedererlangte Freiheit dankbar sein muss. Und was ich für meine in Afrika zurückgebliebenen Mitbrüder tun kann, das werde ich tun."
"Wobei der Sohn dem Vater treu zur Seite stehen wird", setzte des befreiten Bancolo Sohn hinzu. "Ich war noch ein Knabe", fuhr er fort, "als entmenschte Seeräuber uns den Vater raubten. Er hatte als königlicher Beamter viel für einige griechische Kaufleute zu ihrem Schutz getan. Zum Dank dafür wurde er von diesen zu einem Besuch ihrer Heimat eingeladen. Der Vater folgte dieser Einladung und schiffte sich im Hafen von Catania ein, um nach Griechenland zu fahren. Seit diesem Tag war er verschollen und es war uns unmöglich, irgendwelche Nachricht über ihn zu bekommen. Das Schiff war ein griechisches Fahrzeug, und da wir hier keine Nachricht über den Verbleib desselben bekommen konnten, schickte meine arme Mutter eine Vertrauensperson nach Griechenland und ließ die Kaufleute fragen, ob sie nichts vom Vater wüssten. Der Vater war nicht angekommen. Die Kaufleute leisteten einen Eid, dass sie den Vater, den sie ihren Wohltäter nannten, nicht gesehen hätten, dass sie aber alles aufbieten würden, um zu erfahren, ob er in Griechenland gelandet sei. Die Nachforschungen ergaben, dass das Schiff in Griechenland nicht ankam, dass ihm wahrscheinlich ein Unglück zugestoßen sei, da man verkohlte Reste des Schiffes gefunden hatte. So mussten wir annehmen, das Schiff sei untergegangen und habe alle, die sich auf ihm befanden, mit sich hinabgezogen in die Tiefe des Meeres. Wir betrauerten den Vater und beteten für ihn wie für einen Verstorbenen."
"Und mir war es unmöglich, irgend eine Nachricht zu geben, dass ich noch lebte", fuhr der Vater fort. "Wir waren schon nahe bei der Insel Sira, als uns im hellen Mondschein drei Seeräuberschiffe entdeckten und sofort zu verfolgen begannen. Es entspann sich eine wilde Jagd auf Leben und Tod, wobei wir leider unterliegen mussten, weil unser Schiff Feuer fing und bald in hellen Flammen stand. So fielen wir in die Hände der Barbaren, die uns alle nach Afrika brachten und an den Bey von Tunis verkauften. Der schickte uns weiter nach dem Innern Afrikas, damit wir unter strenger Beaufsichtigung dort an der Grenze seines Reiches am Bau einer Festung und bei anderen schweren Arbeiten Hilfe leisteten. Eine Handvoll Reis und einige Datteln, höchst selten ein Stückchen Fleisch war dabei unsere Nahrung, der harte Boden meist unser Lager. In der langen Zeit meiner Sklaverei bekam ich keine anderen Europäer zu sehen, als meine Leidensgenossen, von denen die meisten starben und fern der Heimat begraben liegen. Ich weiß auch, welcher Mut und welche Opferkraft dazu gehören, das zu tun, was diese hochwürdigen Patres tun. Und sich gar hingeben für einen armen Sklaven, ihn befreien und dafür die Sklavenketten auf sich nehmen, das ist Heroismus, das kann nur, wer die Kraft der Wahrheit in sich hat, wer aus Liebe zu Gott allen alles werden will."
"Hochwürden", nahm nun der junge Bancolo wieder das Wort, "es soll nicht beim Vorsatz bleiben, wir wollen diesen Vorsatz rasch in die Tat umsetzen. Wie viel Geld wäre wohl notwendig, um weitere zweihundert Sklaven zu befreien?"
"Die Mohammedaner fordern oft hohe Summen und geben die Christensklaven nur um viel Geld frei. Nichtsdestoweniger glaube ich, dass zwanzigtausend Louisdor reichen würden."
"Gut, Hochwürden, ich hoffe, Ihnen diese Summe innerhalb eines Jahres geben zu können. Die Summe ist hoch, aber wie gesagt, ich hoffe sie zusammenzubringen. Und wäre Ihr Orden wohl bereit, einige Patres mit diesem Geld nach Afrika zu schicken, um arme Gefangene loszukaufen?"
"Ich selbst würde meine Vorgesetzten bitten, dass sie mich mit einigen Mitbrüdern nach Afrika schicken."
"Sie fürchten die Reise nicht?"
"Wie sollte ich sie fürchten? Mein Leben ist dem Dienst des Herrn geweiht, der gesagt hat: Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan."
"Aber die Reise nach Afrika ist beschwerlich und die Mühen, dort die Christensklaven zu suchen und loszukaufen, müssen ungeheuer sein."
"Macht das etwas? Mit unbegrenztem Vertrauen auf Gottes Hilfe habe ich einen großen Teil meines Lebens auf Reisen zugebracht, habe aus Liebe zu Gott und den Menschen die Wüsten Afrikas durchzogen, habe die Steppen der Tatarei und des weiten Persien durchwandert. Überall waren Mühseligkeiten und Opfer meine beständigen Begleiter. Viermal blieb ich in der Gefangenschaft zurück, um durch mein Bleiben noch einen armen Christensklaven zu befreien. Und wenn ich nun auf einer Reise zur Befreiung der Christensklaven sterben würde, welch schöneren Lebensabschluss könnte ich mir wünschen? Wäre das nicht der Tod eines Kriegers, der auf dem Schlachtfeld fällt?"
Vater und Sohn hörten mit Bewunderung den begeisterten Worten des Mönches zu. Wieviel Opfersinn und Hingabe an Gott lag darin! So konnten nur Menschen sprechen, die sich vom Irdischen losgelöst hatten, um ganz Gott und dem Wohl der Mitmenschen zu leben.
"Gut denn", sagte der junge Bancolo nach einer Weile. "Pater Blasius, wäre es Ihnen möglich, im nächsten Jahr am Tag vor Aschermittwoch mit mir in Venedig zusammenzukommen?"
"Die Erlaubnis meines Obern vorausgesetzt, wenn ich noch lebe, ja."
"Gut, so wollen wir uns an diesem Tag in einem Haus, das ich Ihnen brieflich noch näher bezeichnen werde, zu Venedig treffen. Ich werde dann dort bestimmt die Summe von 20.000 Louisdor zur Befreiung armer Christensklaven, vor allem zum Loskauf der drei zurückgebliebenen Mönche in Ihre Hände legen. Wollen Sie inzwischen alles ordnen, um dann von Venedig aus sofort die Reise zu beginnen? Und dann noch eins. Ich habe nicht gern, dass man unseren Namen bei dieser jedenfalls guten Handlung viel nennt. Darum wäre es mir lieb, wenn es vorläufig nur Ihnen und Ihrem Vorgesetzten bekannt bliebe, wer das Geld gibt. Gott sieht die Tat und wird sie vergelten. Darf ich also auf Ihre Verschwiegenheit rechnen?"
"Sie dürfen darauf rechnen."
"Nun denn auf Wiedersehen in Venedig. Und nochmals tausend herzinnigen Dank für das, was Sie an meinem Vater getan haben." -
Das Jahr verging schnell und der Vorabend des Aschermittwoch war gekommen. Wir eilen nach der Lagunenstadt Venedig. Dort sollte Pater Blasius ja den jungen Bancolo wiederfinden und aus seiner Hand die Summe empfangen, die nach seiner Meinung hinreichte, zweihundert Christensklaven die Freiheit wiederzugeben.
War das ein Leben! Die Schiffer mit den schwarzen Barken hatten vollauf zu tun, um den Wünschen der Fremden zu genügen. Ganz Italien schien seine Vertreter geschickt zu haben. Und von Mund zu Mund ging der Name. "Bancolo" - die Leute nannten ihn zumeist bei seinem Künstlernamen, der ein anderer war, - "Bancolo tritt auf, und es heißt, dass er in diesem Jahr, wenn nicht überhaupt, zum letzten Mal auftritt. Da müssen wir ihn sehen, ihn hören, ihn noch einmal im Theater bewundern. Und wisst ihr es schon? Das Stück, das gegeben wird, und in dem Bancolo die Hauptrolle spielt, ist von ihm selbst verfasst. Niemand will sagen, was der Inhalt des Stückes ist. Nur so viel konnte man erfahren, dass es ein ziemlich getreues Lebensbild des Verfassers sein soll, das auch seine Pläne für die Zukunft ahnen lässt."
Lange vor der festgesetzten Stunde war der Zuschauerraum im Theater Fenice bis auf das letzte Plätzchen besetzt. Vorn in der ersten Reihe waren auf Wunsch des Verfassers 4 Sitze für ebenso viele Patres aus dem Orden von der heiligsten Dreifaltigkeit vorbehalten.
Endlich ging der Vorhang in die Höhe. Das Drama begann. Ein Knabe - das war der kurze Inhalt des Stückes - verlor in früher Jugend seinen Vater, den Seeräuber gefangen nahmen und fortführten. Durch verschiedene Umstände kam der Knabe und seine Mutter aus großem Reichtum in die bitterste Armut. Trotzdem hören sie nicht auf, nach dem Vater zu suchen. Um dabei vielleicht mehr zu erreichen, wird der Knabe, zum jungen Mann herangewachsen, Marinesoldat. Doch von jeder Fahrt kehrt er heim, ohne eine Spur vom Vater gefunden zu haben. Ein reicher Kaufmann entdeckt zufällig das dramatische Talent des jungen Mannes und lässt ihn für das Theater ausbilden, wo der junge Mann bald die größten Triumphe feiert. Doch bei all diesen Triumphen bleibt die Sehnsucht nach dem Vater gleich rege und in einer Stunde stiller Andacht macht der junge Mann vor einem Marienbild das Gelübde, ein für ihn sehr schweres Opfer zu bringen und dem Bühnenleben zu entsagen, wenn er seinen Vater doch noch wiederfinden sollte. Kurz darauf trifft er einen Mönch aus dem Orden von der allerheiligsten Dreifaltigkeit, von dem er erfährt, dass der Vater gerettet ist und sich in seiner Nähe befindet. Daraus erkennt er, dass der liebe Gott sein Opfer, dem Bühnenleben zu entsagen, angenommen hat, und trotz der mannigfachsten Gegengründe und Schwierigkeiten löst er nun sein Gelübde und tritt von der Bühne zurück, um sein ganzes weiteres Leben nur Gott zu weihen. Ein Schlussbild zeigt den jungen Mann im Ordenskleid, von befreiten Christensklaven umgeben.
Bancolo übertraf sich selbst beim Geben der Hauptrolle. So schön, so begeistert, so hinreißend hatte er noch nie gespielt.
Als das Stück zu Ende war, herrschte zunächst lautlose Stille. Dann aber brach ein Sturm des Beifalls los, wie er hier noch nie gewesen war. Tausende riefen nach dem Künstler und verlangten ihn zu sehen.
Bancolo erschien, verneigte sich dankend und gab dann mit der Hand winkend ein Zeichen zum Schweigen.
Sofort ging es durch den Saal: "Still, Bancolo will reden", und lautlose Stille trat ein.
Bancolo dankte zunächst für den ihm gewordenen Beifall und fuhr dann fort: "Ehe ich nun Abschied nehme, hätte ich noch eine Bitte an euch: Beschließt diesen Abend mit einem guten Werk. Während wir uns hier freuen, leben so viele unserer Landsleute in der Sklaverei, seufzen und rufen nach Erlösung. Sie zeigen uns ihre verwundeten Schultern, heben die abgemagerten Arme empor und flehen uns um Erbarmen an. Soll ihr Flehen, ihr Hilferufen vergebens sein? O, ich bitte, eilen wir den Armen zu Hilfe, lassen wir sie nicht vergeblich bitten." Dann winkte Bancolo in die Kulissen und ein Greis trat hervor. "Hier", fuhr der Künstler fort, "stelle ich euch meinen Vater vor. Mehr wie zwanzig Jahre schmachtete er in der Sklaverei, und nur durch den edlen Opfermut eines Ordenspriesters wurde er befreit und seiner Familie zurückgegeben. Da das Geld nicht mehr reichte, die für ihn geforderte Kaufsumme zu erlegen, blieb der Pater aus dem Orden von der allerheiligsten Dreifaltigkeit für ihn zurück und trägt nun an Stelle meines Vaters die Sklavenketten, bis man kommt, um ihn zu befreien, wenn er nicht inzwischen weiter verkauft wurde und sein Aufenthaltsort dann nicht mehr zu finden ist. Lasst uns nun, und das ist meine Bitte, in die Hände dieser Ordensleute niederlegen, was unsere Liebe geben kann, um das Schicksal der armen Christensklaven zu erleichtern. In den Händen dieser Ordensleute, von denen ihr einige auf mein Bitten hin hier in eurer Mitte seht, und die bereit sind, sich selbst in die traurige Sklaverei zu geben, wenn ihre Mittel nicht mehr reichen, einem Sklaven, der danach verlangt und dessen besonders bedürftig ist, die Freiheit zu geben, ist eure Gabe wohl geborgen und wird bestimmt bis auf den letzten Pfennig zu dem Zweck verwendet, zu dem sie gegeben wurde."
Fast kein Auge blieb tränenleer. Die Opfer waren reichlich. Neben Geld wurden auch andere Gegenstände geopfert. Mädchen opferten ihre goldenen Ohrringe, Frauen ihre Schmucksachen, alles gab man hin für die Erlösung der gefangenen Christensklaven.
Am anderen Tag eilte Bancolo zu Pater Blasius und legte eine große, mit Gold im Wert von mehr als 20.000 Louisdor gefüllte Börse in dessen Hand. "Hochwürden", sagte er, "ich komme, um mein Versprechen zu halten. Hier ist das Geld; es ist mehr als ich versprochen hatte. Die christliche Liebe ist noch nicht erkaltet, die christliche Liebe gibt gern. Beten Sie für mich, Hochwürden, damit ich meinen Vorsatz ausführen kann. Dann bin ich bald einer der Ihrigen."
Der Ordenspriester schloss den gefeierten Künstler gerührt in seine Arme. "Möge Gott Ihnen vergelten, was Sie für die unglücklichen Glaubensbrüder getan haben und noch tun werden. Gottes reichster Segen sei mit Ihnen immerdar."
Noch in derselben Woche bestieg Pater Blasius mit seinen Ordensbrüdern ein Schiff, das gerade nach Afrika segelte. Allein, auch die große Summe war bald ausgegeben, wieder waren viele Christensklaven befreit; aber noch immer seufzten viele in den Ketten der Sklaverei. Da gab Pater Blasius, als er kein Geld mehr in den Händen hatte, sich selbst zur Befreiung eines Christensklaven, der unter den fortwährenden Quälereien nahe daran war, seinen Glauben zu verlieren, für diesen in die Sklaverei und blieb in Afrika zurück. Der Opfermutige Ordensmann sah sein Heimatland nicht wieder. Als man nach zwei Jahren kam, um das Lösegeld für ihn zu zahlen und ihn zu befreien, da war Pater Blasius nicht mehr unter den Lebenden, da hatte er in der heißen Erde Afrikas sein Grab gefunden.
Mehrere Jahre später kam ein anderer Pater Blasius aus demselben Orden von der allerheiligsten Dreifaltigkeit nach Afrika, um dort mit besonderem Eifer zur Befreiung der armen Christensklaven zu wirken. Diejenigen, die das Vorleben dieses Mönches, der sich durch seinen Eifer besonders auszeichnete, genauer kannten, sagten, er sei ehemals ein sehr berühmter Bühnenkünstler gewesen. Es war Bancolo, der dem Bühnenleben wirklich entsagt hatte, um ein demütiger Mönch zu werden, der nicht den Ruhm der Welt sucht, sondern die Rettung der Seelen, die Betätigung der Liebe zu Gott und den Menschen. Auch der neue Pater Blasius fand schließlich bei der Betätigung seines Liebeswerkes im heißen Afrika seinen Tod und nach ihm noch so mancher andere Ordensbruder, den das Erbarmen mit seinen unglücklichen Mitmenschen Heimat und alles opfern ließ. Tausende armer Christensklaven verdankten den Mönchen aus dem Orden von der Erlösung der Gefangenen zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts ihre Befreiung und Rückkehr in die Heimat. Die Zahl der durch sie losgekauften Christensklaven hat nicht weniger als 1.500.000 betragen, gewiss auch ein Ruhmesblatt im Ehrenkranz jener, die von der sogenannten Welt gar oft verachtet und verfolgt werden.
________________________________________________________________________

Der Großpönitentiar - Gemälde von Edward von Steinle
28. Kaplan Marielux und Ramo Rodil
Die militärische Macht der Spanier in Südamerika war durch die Schlacht von Ayacucho gebrochen. Callas wurde von den Siegern stark belagert. Der Kommandant der Zitadelle, der Brigadier Ramo Rodil, verteidigte sie mit allen Kräften. Als aber im September 1825, nach neun Monaten, der Mangel an Lebensmitteln die Verzweiflung unter den Belagerten hervorrief, hörte man Gerüchte von einer Verschwörung.
Am 23. September empfing der Brigadier die Nachricht, dass er abends um 9 Uhr den Ausbruch einer Verschwörung zu erwarten habe, deren Haupt der Kommandant Montero, einer der einflussreichsten Offiziere Rodils sei. Männer, auf die er am meisten vertraut, waren dabei vertreten.
Ohne eine Minute zu verlieren, ließ Rodil sie festnehmen, aber was auch immer seine Anstrengungen und Drohungen waren, er konnte auch nicht die geringste Offenbarung von ihnen erpressen; sie leugneten hartnäckig das Dasein einer Verschwörung. Der Brigadier beschloss dann, um sich außer Gefahr zu setzen, alle, sowohl Schuldige als Unschuldige, um 9 Uhr abends erschießen zu lassen, gerade zur selben Stunde, in der die Empörer ihn entweder fesseln oder töten wollten.
"Herr Kaplan", sprach Rodil zum Pater Marielux, dem Seelsorger der Armen, "es ist 6 Uhr. Noch haben Sie 3 Stunden, um diesen Aufrührern die Beichte zu hören." Nachdem er dies gesagt hatte, verließ er die Kasematten. Um 9 Uhr erschienen die dreizehn Verurteilten vor ihrem ewigen Richter.
Doch ungeachtet der Strenge dieser Züchtigung glaubte sich Rodil doch nicht sicher. "Wer weiß", sagte er zu sich selber, "ob ich nicht noch Mitverschworene am Leben gelassen habe, und vielleicht gibt es noch mehr Empörer als die, denen Gerechtigkeit widerfahren ist. Nein, ich kann ruhig sein - der Beichtvater muss sicherlich alles wissen, auch bis ins Kleinste. - Holla, man rufe den Kaplan!"
Nachdem der Kaplan erschienen war, schloss sich Rodil mit ihm in ein Zimmer ein und fragte dann: "Pater, diese Unwürdigen haben Euch ohne Zweifel in ihrer Beichte alle ihre Pläne und Stützen, auf die sie ihre Hoffnung bauen, mitgeteilt. Es ist notwendig, dass Ihr mich über dieses alles aufklärt, und im Namen des Königs fordere ich Euch auf, dass Ihr mir alles erzählt, ohne auch nur einen einzigen Namen oder den kleinsten Umstand auszulassen."
"Herr General", antwortete Pater Marielux, "Sie fordern von mir Unmögliches, denn ich werde nie das Heil meiner Seele opfern, um das Geheimnis eines Beichtkindes zu offenbaren, und wäre der König selbst hier anwesend, um es mir zu befehlen, Gott würde mich bewahren, einem solchen Befehl Gehorsam zu leisten."
Bei diesen Worten stieg dem Kommandanten das Blut ins Gesicht, er stand auf und rüttelte den Pater, indem er schrie:
"Mönch, erzähle mir alles, oder ich lasse dich erschießen!"
Pater Marielux antwortete mit einer wahrhaft himmlischen Ruhe:
"Wenn Gott mein Martyrium will, so geschehe sein heiliger Wille. Ein Diener des Altars darf niemand das Beichtgeheimnis offenbaren."
"Du wirst also nichts sagen?" erwiderte Rodil. "O Mönch, du Verräter an deinem König, an deiner Fahne und deinem Obern!"
"Ich bin meinem König und meiner Fahne treu", antwortete der Priester, "aber niemand hat das Recht, von mir zu fordern, dass ich Verräter an meinem Gott werde. . . . . Es ist mir verboten, Ihnen zu gehorchen."
Ohne länger zu warten, öffnete Rodil die Tür und schrie: "Holla! Kapitän Iturraldo, bringe sogleich vier Mann mit geladenem Gewehr hierher."
Der Befehl wurde ausgeführt.
"Auf die Knie, Mönch!" brüllte nun der zornentbrannte Kommandant der Festung und der Priester gehorchte.
"Schlagt an!" kommandierte Rodil, dann sich zu seinem Opfer hinwendend, sprach er mit gebieterischer Stimme:
"Zum letzten Mal befehle ich Ihnen im Namen des Königs, mir Offenbarungen zu machen."
"Im Namen Gottes weigere ich mich, es zu tun", antwortete mit schwacher, aber doch ruhevoller Stimme der Priester.
"Feuer!" schrie nun Rodil und Petrus Marielux, der mutige Martyrer für Religion und Pflicht, fiel, die Brust von Kugeln durchbohrt.
________________________________________________________________________
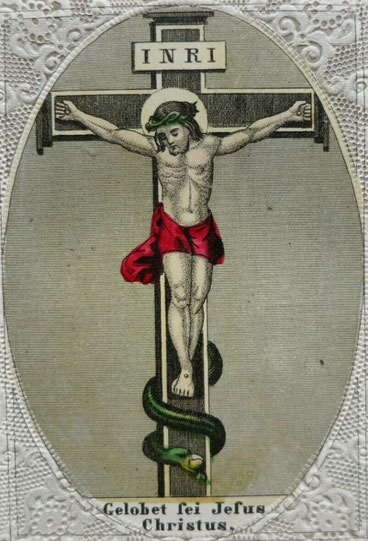
29. Ehrlich währt am längsten
Ein unfreundlicher, regnerischer Novemberabend war es. Draußen heulte der Sturm und peitschte dicke Regentropfen gegen die Fensterscheiben des kleinen Häuschens, das am äußersten Ende des Städtchens stand. Drinnen in dem niedrigen, aber sauberen Stübchen saßen beim trüben Schein einer Lampe zwei Personen in düsterem Schweigen beisammen: eine ältere Frau mit bleichen, kummervollen Gesichtszügen und ein junger Mann von etwa fünfundzwanzig Jahren. Die Bewohner dieser ärmlichen Behausung waren die Witwe Gerber und ihr Sohn Franz.
Aus den Augen der bleichen Frau fiel Träne um Träne auf die Blätter der in ihrem Schoß liegenden "Handpostille", während der Sohn auf einer Bank neben dem Ofen Platz genommen und den Kopf in beide Hände gestützt, gedankenvoll vor sich hin stierte.
Mit einer ungestümen Bewegung sprang der junge Mann endlich von seinem Sitz empor, riss den Hut vom Nagel und wandte sich nach der Tür.
"Du willst doch nicht mehr ausgehen, Franz?" fragte die Mutter. "Bei diesem ungesunden Wetter wirst du dir eine neue Krankheit zuziehen."
"Lass mich nur gehen, liebe Mutter. Ich will heute Abend nochmal einen Versuch machen, vielleicht erhalte ich irgendwo Beschäftigung. Es leidet mich auch nicht mehr in dem Zimmer, die Wände scheinen mich erdrücken zu wollen", bemerkte er in bitterem Ton. "Wenn ich all das Elend hier sehe - du bist krank und gebrechlich, dabei kaum das Notwendige im Haus." Ein tiefer Seufzer entrang sich seiner Brust, vor innerer Bewegung vermochte er seine Gedanken nicht zum Ausdruck zu bringen.
"O, sprich nicht so!" bat die alte Frau, indem sie sich mühsam erhob und ihren Sohn ins Zimmer zurückzog. "Bleibe hier und lass uns den Rosenkranz beten; ein inbrünstiges und vertrauensvolles Gebet verleiht Trost und Hilfe in allen Trübsalen."
"Warum mussten wir auch in solche Armut geraten?" fragte der junge Mann mit schmerzlich bewegter Stimme. "So arm, dass ich dir kein Glas Wein, nicht ein Stückchen Fleisch verschaffen kann!"
"Ja, der liebe Gott hat uns schwer heimgesucht", erwiderte seufzend die Witwe. "Seit dem Tod deines guten Vaters ist alles Unglück über uns hereingebrochen. Meine langjährige Krankheit hat unsere Ersparnisse aufgezehrt, und durch deinen Krankheitsfall und deine Arbeitslosigkeit ist unser Elend aufs höchste gestiegen. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren; der alte Gott lebt noch, er hat noch keinen zugrunde gehen lassen, die auf ihn ihr Vertrauen setzen."
"Möge deine Hoffnung in Erfüllung gehen, liebe Mutter", erwiderte Franz. "Ich muss hinaus, um meinem Herzen Luft zu machen." Bei diesen Worten öffnete er die Tür und war im Dunkel der Nacht verschwunden.
Mit betrübten Blicken schaute die Witwe ihrem Sohn nach. "O Gott, mach ihn doch zufrieden!" entströmte es wie ein heißes Gebet ihren bleichen Lippen. "Allgütiger Vater, du weißt ja, was uns mangelt; aber ich weiß auch, dass du uns Hilfe senden kannst. Wie oft hat es sich schon erfüllt: "Wenn die Not am größten, ist Gottes Hilfe am nächsten!"
Hierauf öffnete sie eine alte Truhe, um noch irgend einen Gegenstand zu entdecken, der veräußert werden könnte. Aber alle eben nur entbehrlichen Stücke waren schon zu Geld gemacht, um etwas für den Lebensunterhalt zu gewinnen.
Betrübt nahm die alte Frau wieder in dem Sessel Platz und gedachte der vergangenen Zeiten. Wie glücklich waren die ersten Jahre ihrer Ehe gewesen! Ihr Mann war Bildhauer, verdiente ein schönes Geld und brauchte für sich gar wenig. Da sie auch sparsam und haushälterisch wirtschaftete, konnten sie ein hübsches Sümmchen ersparen und ein Eigentum erwerben. Stellten sich auch im Laufe der Jahre allerhand Leiden und Widerwärtigkeiten ein, so waren sie doch wenigstens vor Not und Entbehrung geschützt. Die Eltern hatten die Freude, dass ihr Sohn Franz, der von fünf Kindern allein am Leben geblieben war, zu einem ordentlichen, brauchbaren Menschen heranwuchs.
Da brach plötzlich das Unglück über sie herein. Infolge einer Erkältung zog ihr Mann sich eine Lungenentzündung zu und nach zwei Jahren Siechtums raffte ihn der Tod hinweg. Was Fleiß und Sparsamkeit angesammelt, verschlang diese Krankheit; die Gläubiger vertrieben sie aus ihrem Eigentum und sie musste mit ihrem Sohn diese elende Hütte beziehen.
Franz war ein braver Sohn und suchte seiner Mutter das Leben angenehm zu machen und ihre Sorgen zu mildern. Er besaß eine einträgliche Stellung und von seinem Gehalt konnten sie sorgenfrei und glücklich leben. Da blieb auch diese Einnahme aus, als er mehrere Monate krank und stellenlos wurde, und in der kleinen Hütte war jetzt die Not aufs höchste gestiegen.
Den größten Kummer aber bereitete es der armen Frau, dass mit ihrem Sohn eine plötzliche Veränderung vorgegangen war. Statt wie bisher hoffnungsfroh in die Zukunft zu schauen, verfiel er in Grübeln und in Sinnen. Er machte seinem Unmut Luft, indem er über die Reichen und Hartherzigen schimpfte, die nur die armen Leute aussaugten. Mit neidischen Blicken betrachtete er die Wohlhabenden und behauptete, der Reichtum sei zu ungleich verteilt in der Welt.
Mit tiefer Betrübnis gewahrte die Mutter die Veränderung in dem Wesen ihres Sohnes und sie klagte dem Pfarrer ihr Leid.
"Ihr Sohn ist angesteckt von dem Geist der Empörung gegen die bestehende Weltordnung", sagte der erfahrene Seelenhirt. "Beten Sie für ihn, denn Worte und alle guten Ermahnungen werden nichts fruchten, aber das Gebet einer Mutter vermag viel."
Diese trostreichen Worte hallten jetzt wieder in dem Herzen der unglücklichen Mutter. Sie fiel vor dem Bild des gekreuzigten Heilandes nieder auf die Knie, und Schwäche, Mattigkeit, Kummer und Herzeleid wurden zurückgedrängt bei dem vertrauensvollen Aufblick zu dem, der gesprochen hat, : "Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet, so wird er es euch geben."
* * *
Franz war in die dunkle Nacht hinausgestürmt. Kaum von der Krankheit genesen, schlotterten ihm die Beine bei dem schnellen Gehen; die Zähne schlugen ihm aufeinander, sein ganzer Körper schauerte zusammen. Aber in seiner fieberhaften Aufregung achtete er dessen nicht. Die Fabriken und Geschäfte waren schon alle geschlossen und er konnte sein Gesuch um Beschäftigung nirgends mehr anbringen. Ziel- und planlos eilte er durch die Straßen, und ohne es zu wollen, war er am Bahnhof angelangt. Erschöpft lehnte er sich an die Mauer unter einen Dachvorsprung, um sich gegen den strömenden Regen zu schützen.
Was wollte er eigentlich hier? - Mit mechanischen Blicken betrachtete er das Gewühl der Reisenden, die an- und abfahrenden Wagen, die trübe flackernden Gaslaternen. Da erregte ein elegantes Gefährt, das dicht vor ihm halten blieb, seine Aufmerksamkeit. Der Kutscher stieg ab und öffnete den Schlag, worauf ein vornehm aussehender Herr mit freundlichen Zügen ausstieg und dem Rosslenker etwas in die Hand drückte.
Franz durchbebte es. Sollte er nicht diesem Fremden, auf dessen Antlitz Milde und Wohlwollen zu lesen waren, seine Not klagen? Eine heiße Blutwelle stieg ihm in das Gesicht. "Nein, nein!" schrie es in ihm auf, "lieber hungern, als jemand um eine Gabe anflehen!"
Der Wagen sauste davon und der Fremde begab sich in den Wartesaal. Da - hatte er nicht etwas verloren? Franz bückte sich schnell und hielt ein kleines, verschnürtes Paketchen in der Hand. Im Begriff, dem Fremden nachzueilen, hielt er wie gebannt inne; eine innere Stimme flüsterte ihm zu: "Behalte den Fund! Vielleicht ist es eine Brieftasche gefüllt mit Banknoten, und du bist aller Sorgen ledig!" - "Aber ist es nicht Diebstahl?" flüsterte eine andere Stimme. Hatten seine frommen Eltern ihn nicht stets zur Ehrlichkeit angehalten? -
Der böse Geist behielt die Oberhand. Einen scheuen Blick um sich werfend, schlug er eiligen Schrittes den Weg nach Hause ein.
Die Witwe hatte ihren Sohn mit großer Sorge erwartet. "Du fieberst, Franz", sagte sie in besorgtem Ton, als sie seine erregten Züge bemerkte. "Und wie nass du bist, du musst dich sogleich ins Bett legen."
"Sieh hier, Mutter, was ich gefunden habe", stieß der junge Mann statt aller Antwort hastig hervor, während er die Umhüllung löste. Mutter und Sohn waren sprachlos vor Überraschung beim Anblick der kostbaren Schmucksachen, die das Paket enthielt. Goldene Uhr, Ketten, Ringe mit wertvollen Steinen und Brillanten besetzt.
Franz betrachtete den Fund mit habgierigen Blicken. "O Mutter, welch ein Glück!" rief er freudig erregt aus. "Nun sind wir von aller Not befreit."
Die alte Frau warf ihrem Sohn einen vorwurfsvollen Blick zu. "Ich kenne dich gar nicht wieder, Franz", bemerkte sie in ernstem Ton. "Der Geist der Versuchung hält dich umfangen; bisher bist du brav und ehrlich gewesen - und jetzt willst du auf einmal zum Dieb werden?"
"Diebstahl kann man es wohl auf keinen Fall nennen", meinte er verlegen, vor dem strengen Blick der Mutter die Augen zu Boden schlagend. "Wer weiß, ob nicht ein anderer Finder die Sachen als sein Eigentum betrachtet hätte."
"Es ist Pflicht eines jeden ehrlichen Menschen, Gefundenes zurückzugeben."
Franz erwiderte nichts, sondern betrachtete mit wohlgefälligen Blicken die kostbaren Schmuckgegenstände und ließ die Steine im Licht funkeln. "Ist es nicht eine Schande, dass die Reichen ein solches Vermögen am Leib tragen, nur um damit zu prunken?" fragte er in bitterem Ton. "Wenn man sieht, wie hier Not und Elend herrscht, auf der anderen Seite dagegen Prunksucht und Wohlleben, dann muss auch selbst der zufriedenste Mensch in Missmut geraten."
In diesem Ton ging es weiter. Die alte Frau seufzte tief auf; sie sah mit Schrecken, wie das Gift, das seine Genossen durch Wort und Schriften in sein empfängliches Gemüt eingepflanzt hatten, schon böse Früchte brachte.
"Ich bitte dich, mein Sohn, sprich nicht mehr solche Worte", bat sie unter Tränen. "Du stürzt uns beide ins Unglück, wenn du den Fund nicht ablieferst; oder willst du durch deine Unredlichkeit das Andenken deines braven Vaters schänden?" fügte sie mit großem Nachdruck hinzu.
Diese Worte schienen auf den jungen Mann eine gute Wirkung auszuüben. In seinen Zügen spiegelte sich ein schwerer Kampf ab, der in seinem Innern vorging.
"Nun denn, es sei, wie du wünschst, liebe Mutter!" sagte er nach einer Weile mit fester Entschlossenheit. "Morgen früh liefere ich den Fund an die Polizeibehörde ab und werde mit Mut und Gottvertrauen den Kampf mit dem Leben weiterführen."
"Gott segne dich für diesen Entschluss, mein guter Sohn!" sagte die alte Frau bewegt und legte die Hände auf sein Haupt. Franz verschloss das Paket sorgfältig und begab sich mit einem freundlichen "Gute Nacht, liebe Mutter", in seine Kammer. Auch die Witwe suchte ihr armseliges Lager auf, nachdem sie vor dem Bild des Gekreuzigten noch eine Weile in inbrünstigem Gebet verharrt hatte.
Am anderen Morgen begab sich Franz mit dem Fund zur Polizei. "Der Eigentümer hat bereits den Verlust angemeldet", bemerkte der Beamte. "Ich gratuliere zu der hohen Belohnung, die Sie erhalten, dem ehrlichen Finder sind fünfhundert Mark versprochen."
Beflügelten Schrittes eilte Franz nach Hause, um seiner Mutter diese frohe Botschaft zu überbringen. Am Nachmittag desselben Tages hielt vor der ärmlichen Hütte ein elegantes Gefährt, dem ein Herr entstieg und in das niedrige Zimmer trat. Franz erkannte sofort den Herrn, dem am Bahnhof das Paket entfallen war.
Der Fremde stellte sich vor als der Juwelier K. aus der nahen Großstadt und war gekommen, um dem ehrlichen Finder die versprochene Belohnung persönlich zu überbringen. Mutter und Sohn vermochten vor Glück und Freude kein Wort hervorzubringen. "Ich freue mich außerordentlich, dass Sie -"
"Ich habe dem Drängen meiner Mutter nachgegeben", unterbrach Franz errötend den Juwelier, dessen freundliches Wesen ihm Vertrauen einflößte. Offen und freimütig legte er das Geständnis ab, dass er in Versuchung gewesen war, den Fund zu behalten, um ihrer augenblicklichen Not zu entgegenzusteuern.
Der Juwelier drückte der alten Frau und ihrem Sohn bewegt die Hand. "Ihr seid mir als rechtschaffene und brave Personen geschildert worden, auch habe ich von eurer misslichen Lage Kenntnis erhalten", bemerkte er, wobei seine Blicke durch das ärmlich ausgestattete Zimmer schweiften. "Womit kann ich Ihnen meine Dankbarkeit bezeugen?"
Die Witwe schilderte nun dem Fremden ihre Lage, wie sie durch den Tod ihres Mannes in Armut geraten ist, und ihre Krankheit sowie die ihres Sohnes beigetragen habe zur großen Not, in der sie sich augenblicklich befänden.
Mit sichtbarer Rührung hatte Herr K. zugehört. "In meinem Geschäft ist eine Stelle als Buchhalter zu besetzen", wandte er sich an den jungen Mann. "Wollen Sie diesen Posten antreten?"
"Mit tausend Freuden bin ich dazu bereit", erklärte er glückstrahlend und ergriff dankerfüllt die Hand des Juweliers. "Sie sind unser Retter."
Herr K. wehrte sanft ab. "Ich kann Ihre Rechtschaffenheit nicht hoch genug belohnen", sagte er mit wohlwollenden Blicken. "Für mein Geschäft brauche ich ehrliche Personen. Eine gesunde und hübsche Wohnung mit Garten steht Ihnen frei zur Verfügung und für die Umzugskosten nehmen Sie einstweilen dieses."
Bei diesen Worten drückte er der Witwe einige Banknoten in die Hand und empfahl sich mit einem freundlichen: "Auf Wiedersehen!"
In den Augen der alten Frau glänzten Tränen der Rührung und Freude. "Siehst du, mein Sohn", sagte sie mit einem dankerfüllten Blick auf das Bild des Gekreuzigten, "Gott verlässt die Seinen nicht."
"Ja, liebe Mutter", erwiderte der junge Mann bewegt, "deine Worte haben mich wieder auf den rechten Weg geführt, sie sollen fortan der Leitstern meines Lebens sein."
________________________________________________________________________

30. Das alte Lied - das alte Leid!
Da vom stillen Kirchlein im wildbachdurchrauschten Talgrund das Angelusläuten erklungen war, legte Berta, des Hammbauern jüngste Tochter, ihr Nähzeug beiseite und lauschte mit lächelnder Miene nach dem blütenduftenden Gärtchen hinaus, dessen kleines Lattentörchen soeben geknarrt hatte. Ein leichtfüßiger Schritt ließ sich auf den blanken Kieswegen vernehmen, und es dauerte nicht lange, da steckte ein junges, lebensfrisches Mädchen den blonden Kopf zum Zimmer hinein und bat Berta mit sprudelnder Lebhaftigkeit, sie auf einem Gang ins Nachbardorf zu begleiten.
"Um neun Uhr können wir wieder daheim sein; komm mit, liebste Freundin. Die Abendluft wird dich nach des Tages Hitze angenehm erfrischen."
Berta wusste genau, was es mit dieser Einladung für eine Bewandtnis habe, aber der Schalk saß ihr hinter den Ohren. Neckend ließ sie das junge Mädchen einen Augenblick über ihre Absichten im Ungewissen, bis sich ihre Augen trafen und beiden ein fröhliches Lachen entlockte.
"Gelt, du gehst mit?" - "Nun ja, du Schmeichelkatze, ich werde nur eben noch den Vater benachrichtigen."
Einige Minuten später gingen sie Arm in Arm durch den grünen Klee und den hochgeschlossenen Weizen, und mit dem fröhlichen Frühlingskonzert der bunten Waldvöglein klangen ihre frischen, glockenhellen Stimmen in den milden, heiteren Sommerabend. Es waren zwei muntere Geschöpfe, diese beiden Mädchen. Sie schienen es auch gar nicht so eilig zu haben, denn bald ließen sie sich am blumengeschmückten Wiesenrain nieder, pflückten Sträuße und Emilie verfertigte mit geschickter Hand ein Kränzlein aus Kornblumen und Tausendschön, das sie der Gefährtin in das weiche, volle Haar drückte.
"Bald werden wir ein anderes Kränzlein tragen, liebste Freundin."
"In drei Wochen, am Samstag vor Johanni", antwortete Berta glückstrahlend.
Und dann begann ein geheimnisvolles Kichern, Schmunzeln und Tuscheln - dass der Fing erstaunt im Singen einhielt und von einer hellleuchtenden Birke herüberschlug, um die glücklichen Menschenkinder neugierig zu betrachten.
Berta war ein Jahr älter als Emilie, und einem aufmerksamen Beobachter würde es nicht entgangen sein, in ihr Ruhe und Ernst zu finden, was man von dem anderen Mädchen nicht behaupten konnte.
"Vielleicht ist unser heutiger Spaziergang für lange Zeit der letzte, liebe Berta", hub Emilie nach einer Pause nachdenklich an. "Nächsten Sonntag wird mein Bräutigam kommen, dann werden wir die Vorbereitungen zur Hochzeit treffen."
"Willst du mich neidisch machen, das ist nicht schön von dir, aber warte nur, mein Bräutigam bleibt auch nicht aus."
"Wir sind immer treu zusammen gewesen, Berta. In der Schule saßen wir nebeneinander, bildeten bei der ersten heiligen Kommunion ein Paar, wurden Schulter an Schulter gefirmt, und nun heiraten wir auch noch am gleichen Tag - wie nett!"
"Ich wünschte nur sehnlichst, du gingest keine Mischehe ein", erwiderte Berta mit leichtem Tadel.
Emilie hob den Kopf und ein unwilliger Schatten huschte über ihre leicht erregbaren Züge: "Oho, fängt das alte Lied jetzt wieder an? Der Herr Pastor hat mich erst gestern noch tüchtig abgekanzelt und eine Hölle voll Unglück prophezeit. Der hat, gerade wie du, keine Ahnung, wie gut und lieb und brav mein Georg ist."
"Deine Mutter trägt auch bitter an deinem Vorhaben. Deine Mutter weiß gut, wie es im Leben geht - lass dich nicht vom äußeren Schein betören, Emilie, bist du einmal verheiratet, bist du es fürs ganze Leben, und die Reue käme zu spät. Es ist so viel falsches Gold in der Welt. Drum sieh dich vor - -."
"Ach, höre nur auf - jeder will mich ärgern. Ich nehme nun einmal den Georg und keinen andern. Was wollt ihr denn eigentlich? Hat er nicht großmütig alles zugestanden, was der Herr Pfarrer im Namen der Kirche von ihm verlangte und schriftlich erklärt, die Kinder, die uns Gott schenken würde, katholisch zu erziehen? Spare deine unnützen Worte."
Berta wusste, dass sie unnütz wären und schwieg, und der so fröhlich begonnene Spaziergang endete mit einer schrillen Dissonanz.
* * *
Seitdem sind zehn Jahre verflossen. An Berta sind sie nicht spurlos vorübergegangen. Die ehemals glatte Stirn haben Sorgen und Arbeit gefurcht, doch blickt das Auge heiter und klar von stiller, innerer Glückseligkeit. Der Herr hat die Familie und ihr Tun gesegnet, denn Berta und ihr Mann haben in Eintracht und Frömmigkeit ein christliches Leben geführt. Vom Morgen bis zum Abendläuten war ihr Wirken ein Gebet. Das Häuschen glänzte vor Sauberkeit. Links von der Tür fiel der Blick in die Wohnstube, wo schneeweiße Gardinen die Fenster zierten und grüne Läden sie vor Wind und Wetter schützten. Drei pausbackige kleine Rangen erfreuten mit ihren munteren Spielen die Herzen der Eltern. Der Mann war soeben nach Hause gekommen. Berta begrüßte ihn in der Küche und sah ihn erwartungsvoll an.
"Es hat gutgegangen, Frau! Die Kartoffeln, das Getreide ist verkauft - ich habe 85 Mark mehr gelöst, wie wir gerechnet haben."
"Die legen wir für die Armen zurück, und was sonst noch übrig ist, kommt in die Sparkasse."
Der Mann nickte: "Recht so, Frau."
Nun nahmen ihn die Kinder in Beschlag, ihn und seinen Rock, bis sie ihre kleinen Geschenke entdeckt hatten; da kannte ihre Fröhlichkeit keine Grenze.
Nach dem Abendessen kniete die Familie vor dem Kreuzbild zum Rosenkranz. Hinter den Knaben knieten die Eltern, und die Mutter hielt dem Kleinsten die Händchen gefaltet. So geschah es jeden Tag, und hatte eins dem andern vielleicht ein Wort zu viel gesagt, so pflegten sie sich nach dem Beten die Hand zu reichen, und alles war vergessen.
Was Wunder, dass in diesem Haus die Engel Gottes ein und aus flogen.
Während des heutigen Rosenkranzes nun ereignete sich ein kleiner Zwischenfall. Jemand hatte die angelehnte Tür ein wenig geöffnet und war leise eingetreten. Es war eine arme, abgehärmte, mit Lumpen bedeckte Frau, die mit heißem Blick das friedliche Bild vor sich verschlang. Ein krampfhaftes Zucken lief durch die abgelebte Gestalt. Niemand hatte sie bemerkt.
Der Rosenkranz war beendet. Der Hausherr erhob sich und blickte etwas verwundert auf die fremde Gestalt im Zimmer. "Was wollen Sie?" fragte er neugierig.
Die Frau antwortete nichts heftiges Schluchzen verschlang ihre Stimme.
Mittlerweile trat Berta näher, während die Kinder sich furchtsam hinter den Vater duckten.
Auf einmal bewegte sie ein heftiger Schrecken: "Mein Gott, ist es möglich - Ihr seid - du bist Emilie?" rief sie zurückweichend.
"Berta!"
"Arme, unglückliche Freundin! Wie kommst du hierher? Wo sind deine Kinder; wo ist dein Gatte?"
"Fort - fort -!"
"Tot?"
Statt der Antwort begann Emilie wieder herzbrechend zu schluchzen.
Berta führte die Ärmste zu einem Stuhl und sagte sanft: "Weine dich ruhig aus, liebe Freundin. Du musst furchtbar gelitten haben und die Tränen werden dich erleichtern. Müssen wir uns so wiedersehen? Ich bringe die Kinder schnell zu Bett und dann, wenn du etwas gegessen hast, erzählst du uns alles."
Eine traurige Geschichte war es in der Tat, die da herauskam. Emilie sprach: "Die erste Zeit unserer Ehe war eine sehr glückliche. Georg, mein Gatte, war ein fleißiger Arbeiter. Jeden Samstag brachte er mir den vollen Lohn und kam immer regelmäßig nach Hause. Wir verlebten friedliche Stunden. Aber ach, es sollte bald anders werden. Unser Glück erreichte den Höhepunkt, als uns der Himmel nach Jahr und Tag ein reizendes Töchterchen bescherte. Es war wirklich der Höhepunkt gewesen. Unserer Abmachung gemäß sollte es katholisch getauft werden, ungefähr acht Tage nach seiner Geburt. Ehe es aber dazu kam, erhielt mein Mann unaufgefordert des Besuch seines protestantischen Predigers. Zuerst kam er nur flüchtig auf einige Augenblicke, wiederholte dann aber seine Visiten an den folgenden Tagen und blieb zuletzt über zwei Stunden mit Georg allein.
Ich ahnte wohl, was der Herr wünschte, hielt meinen Mann aber nicht für fähig, sein gegebenes Versprechen zu brechen, und wiegte mich in vertrauensseliger Sicherheit - - bis mir Georg zu meinem grenzenlosen Schrecken am Tag der Taufe kühl erklärte: sein Prediger würde sie vollziehen.
Ich schrie laut auf, nannte ihn Lügner und Betrüger und verlangte für mein Kind die katholische Religion. Allein Georg meinte lachend: Taufe sei Taufe.
So musste ich es denn mit bitterstem Schmerz sehen, wie der protestantische Prediger das Haus betrat - und unser Glück zerriss; denn mein Vertrauen an Georgs Ehrgefühl war dahin, und von nun an war auch der häusliche Friede zerstört. Was mein Mann vorher nie getan, tat er jetzt. Er verhöhnte meinen Glauben, schimpfte in den unwürdigsten Ausdrücken über meine Kirche und schnitt Grimassen, wenn ich mich segnete.
Liebe Berta! Wie schrecklich gingen mir da in dieser Hölle die Augen auf. O wie habe ich für die Tränen meiner guten Mutter und für deine und für die in den Wind geschlagenen Warnungen meines Jugendseelsorgers büßen müssen. Doch ich wollte es ja besser wissen.
Was blieb mir anders übrig, als Geduld zu üben? Also duldete ich zur Sühne für mein leichtsinniges Vertrauen und nahm meine Zuflucht zum Gebet. Aber von Jahr zu Jahr wurde mein Kreuz schwerer; ohne die Kraft, die ich im stillen reumütigen Gebet fand, hätte ich es nicht ertragen. Unser zweites Kind wurde geboren und ebenfalls meinem Glauben entrissen. Ja, es war schon einfach selbstverständlich so. Ich wurde überhaupt nicht mehr gefragt.
Meine Lage gestaltete sich immer unerträglicher und alles Bitten und Flehen war umsonst. Georg war nämlich in einem Verein, der ihm mehr am Herzen lag, als seine Frau, wo man ihn systematisch gegen mich aufhetzte. Einmal antwortete er mir auf meine Vorhaltungen, ich solle protestantisch werden; da sei so lustig leben, und er würde mich auf den Händen tragen.
So hielt der Mann sein Versprechen, mir freie Religionsübung zu gewähren. Auch am Anhören der hl. Messe suchte er mich zu hindern: weil er sich schämen müsse, dass seine Frau solchem Aberglauben huldige.
Noch war mein Kelch nicht voll.
Im sechsten Jahr kam mein Mann unregelmäßig nach Hause, war dann gewöhnlich außerordentlich mürrisch und gab mir weniger Geld - um so mehr verletzende Worte.
Zuweilen wurde es so schlimm, dass sich die Nachbarn ins Mittel legten - und ihre geschwätzigen Zungen sorgten auch dafür, mir die schreckliche Wahrheit über das rätselhafte Benehmen Georgs schonungslos zu enthüllen." -
"Emilie, arme, teure Emilie", flüsterte Berta teilnehmend und zog die hartgeprüfte Frau zitternd an sich.
Emilie fuhr unter heißen Tränen fort: "Das Maß war übergelaufen. Ich verließ das Haus. Unser Jüngster war bereits ein Engel im Himmel; das Älteste nahm ich mit. Am anderen Morgen suchte mich mein Mann auf und suchte mich mit der unschuldigsten Miene zu bewegen, umzukehren. Da hielt ich ihm seine verbrecherische Untreue vor und Georg erkannte, dass ich nun seinen Verkehr wusste. Da ließ er die heuchlerische Maske fallen und kehrte die schamloseste Bosheit seines innersten Wesens hervor. Er veränderte sein Gesicht und schleuderte mir hohnlachend die grässlichen Worte zu, die mir noch heute wie die Trompete des jüngsten Gerichts in den Ohren klingen: "So bleib denn hier und amüsiere dich mit deinem lieben Rosenkranz. Ich mag nichts mehr von dir wissen. Gott Dank, dass ich dich endlich los bin - adieu für immer, ohne dich habe ich mehr Pläsier. Mathilde will ich dir schenken, die kannst du zum Ersatz für mich katholisch machen."
Ich starrte den Treulosen fassungslos an und fiel in Ohnmacht, und als ich erwachte, kam ich mir wie tot vor. Wäre ich nur gleich gestorben, wie mein Töchterchen, das noch im selben Winter die Diphtheritis wegraffte! In S. litt es mich nicht mehr. Ich ging nach St., wo ich so lange durch Waschen mein Brot verdiente, als die Kräfte reichten. - Und nun bin ich zu dir gekommen, Berta - -"
Berta ergriff Emiliens abgemagerte Rechte und drückte sie mitleidsvoll: "Arme, arme Freundin, mein Gatte und ich heißen dich herzlich willkommen. Wie bedauere ich dich und fühle deinen Schmerz."
Welch himmelweiter Unterschied zwischen diesen beiden Ehen! Bei Emiliens Leiden war Berta das eigene köstliche Glück erst so recht zur Besinnung gekommen. Stumm umschlang sie die Verstoßene. Auch der Bauer war aufgestanden: "Emilie", sagte er einfach aber mit vielsagender Wärme - "Emilie, hier bist du zu Hause. Bleibe nur ruhig bei uns. Niemand kennt dich hier und niemand außer dem Herrn Pfarrer wird etwas erfahren."
Emilie blieb und half mit bei den ländlichen Arbeiten. Nichts war von dem einst so munteren und fröhlichen Mädchen geblieben. Schweigend verrichtete sie ihre Arbeit, und nur langsam, langsam schwand unter dem heilenden Einfluss der überaus liebevollen und zarten Pflege, die ihr von den Bauersleuten zuteil wurde, der herbste Gram.
Aber am meisten trugen noch die Kleinen dazu bei, die die stille "Tante" gar zu lieb gewonnen hatten.
"Bauer", sprach der welterfahrene alte Pfarrer, als Bertas Mann auf den Pfarrhof kam, um eine Bestellung zu machen, "Emiliens Geschick hat mich tief ergriffen. Es ist leider nicht selten. In den großen Städten kommt Ähnliches alle Tage vor, und wer da weiß, wie viele Kinder aus Mischehen protestantisch "gemacht" werden, wundert sich über Emiliens böse Erfahrungen nicht - - und dennoch sind die jungen Mädchen blind und bleiben blind - bis das Unglück da ist. Es ist ein wahrer Jammer - - !"
 Marianisches
Marianisches






















