Inhalt:
1. Toleranz
2. Taufkerze
3. Tod
4. Taufe
5. Teufel
6. Tempelweihe
7. Totengedenken
8. Tischgebet
9. Taube
10. Trappisten
11. Totenbretter
12. Templerorden
13. Todeszeitpunkt der Gottesmutter
14. Apostel Thomas
15. Tiere und Kirche
________________________________________________________________________

1. Toleranz
„Die Katholiken sind unduldsam und rücksichtslos gegen die Überzeugung der Andersgläubigen!“ das ist einer der Vorwürfe, die wir am öftesten zu hören bekommen. Und in der Tat, ganz Unrecht haben die Gegner mit ihrer Behauptung nicht. Wir Katholiken sind wirklich intolerant d.h. unduldsam gegen den Irrtum, das ist wahr. Aber wir sind andererseits sehr tolerant und liebevoll gegen die Irrenden, wenn diese ehrlich und aufrichtig Frieden mit uns zu halten bereit sind. Freilich, wenn sie uns angreifen und unsere heiligsten Rechte verletzen, dann werden wir unduldsam, setzen uns zur Wehr und weisen den Feind in die Schranken zurück.
1. Intoleranz gegen den Irrtum.
Wir Katholiken wissen mit Sicherheit, dass unsere Kirche, welche so viele Siegel und Merkmale göttlichen Ursprungs an sich trägt, die wahre Kirche Christi ist. Wir sind daher gewiss, dass auch ihre Lehre in allen Punkten wahr, dass somit jede entgegengesetzte Ansicht falsch und verwerflich ist. Wenn wir darum auch gerne zugeben und anerkennen, dass viele Andersgläubige, z.B. Protestanten, ehrenhafte und gute Menschen sind, so können wir doch nie und nimmer zugeben, dass der Protestantismus eine gute Religion ist; den Personen können wir aufrichtige Hochschätzung entgegenbringen, aber jene Lehrmeinungen der Protestanten, worin sie von uns abweichen, können wir unmöglich achten und respektieren, sondern müssen sie notwendig geringschätzen und verwerfen. Ein Irrtum hat nun einmal nichts Ehrwürdiges und Achtbares an sich, auch wenn derjenige ein guter Mensch ist, der ihn festhält und verteidigt. Du liebst deinen Vater gewiss mit der aufrichtigen Liebe; aber wenn er dir einzureden sucht, der Mond sei größer als die Sonne und Asien kleiner als Europa, so wirst du seiner Behauptung sicher nicht beistimmen. Du wirst vielleicht schweigen und nicht offen widersprechen, um ihm nicht weh zu tun; aber seine Meinung achten und billigen, das kannst du nicht, weil sie ganz offenbar falsch ist.
In der nämlichen Lage befinden wir Katholiken uns den Andersgläubigen gegenüber. Wir erzeigen den getrennten Schwestern und Brüdern herzliche Achtung und Liebe, solange es sich um ihre Person handelt. Aber wenn sie von uns fordern, wir sollten auch von ihrer Religion einen gewaltigen Respekt haben und ihre Anschauungen als gleichberechtigt mit der katholischen Lehre anerkennen, dann erwidern wir ebenso bestimmt als höflich: „Freunde, ihr verlangt zu viel. Es ist nicht erlaubt, Licht und Finsternis, Wahrheit und Irrtum auf gleiche Stufe zu stellen. Die Wahrheit aber ist bei uns und nicht bei euch: denn unsere Kirche reicht hinauf bis in die Zeiten Christi, die eure ist erst ein paar Jahrhunderte alt. Unsere Kirche steht auf dem Felsen Petri, die eurige nicht. In unserer Kirche herrscht trotz ihrer allgemeinen Verbreitung die großartigste Einheit, die eure ist in zahllose Sekten zerklüftet. In unserer Kirche werden vielfach die evangelischen Räte beobachtet und erstehen immer neue Heilige, die eure ist unfruchtbar geblieben bis auf den heutigen Tag!“
So lautet die Antwort, die wir den von uns getrennten Schwestern und Brüdern geben. Klingt sie etwas hart, so ist das nicht unsere Schuld. Es ist eben die Sprache der selbstbewussten Wahrheit, die von Natur aus intolerant ist und keinen Irrtum als gleichberechtigt neben sich duldet.
2. Toleranz gegen die Irrenden.
Die falschen Lehren der Andersgläubigen haben keinen Anspruch auf unsere Hochschätzung; aber den Irrenden selbst sind wir, wie gesagt, im Allgemeinen aufrichtige Achtung und Teilnahme schuldig. Denken wir uns nur in ihre Lage hinein! Viele von ihnen, in manchen Gegenden fast alle, befinden sich in einem unverschuldeten Irrtum. Sie sind in der falschen Religion geboren und aufgewachsen; sie können nichts dafür, dass sie lutherische oder kalvinische Eltern und Voreltern, Erzieher und Lehrer gehabt haben. Man darf auch nicht glauben, dass es für solche Menschen gar so leicht sei, die Wahrheit der katholischen Religion klar zu erkennen; man hat ihnen ja von Jugend auf nur ein Zerrbild derselben gezeigt und alle erdenklichen Vorurteile beigebracht. Dazu kommen die Schwierigkeiten, an denen leider wir selber schuld sind. Ja, wenn wir Katholiken lauter Heilige wären, wenn bei uns allen das Leben mit dem Glauben im Einklang stünde, dann müssten es die Andersgläubigen gleichsam mit Händen greifen, dass unsere Religion die wahre ist. So aber können sie, vielfach mit Recht, behaupten, die Katholiken seien um wenig oder nichts besser als sie. Kurz gesagt: wir haben für gewöhnlich kein Recht dazu, den getrennten Schwestern und Brüdern ihren Glaubensirrtum zum Verbrechen anzurechnen und sie zu verurteilen; wir haben vielmehr allen Grund, aufrichtiges Mitleid und innige Nächstenliebe gegen sie im Herzen zu tragen.
Dieser inneren Gesinnung entspricht unser ganzes Benehmen im Verkehr mit Andersgläubigen. In Gegenden mit gemischter Bevölkerung, wo Protestanten und Katholiken zusammenleben, kommen wir den ersteren auch äußerlich mit aller Achtung und Freundlichkeit entgegen. Wir stören sie nicht in der freien Ausübung ihrer Religion. Wir reizen sie nicht durch Vorwürfe, Verleumdungen und üble Nachrede. Wir suchen nutzlose Streitereien über religiöse Dinge nach Tunlichkeit zu vermeiden. Wir erkennen neidlos die guten Eigenschaften, Leistungen und Erfolge der andern an. Wir wirken einträchtig mit ihnen zur öffentlichen Wohlfahrt zusammen als Glieder desselben Staates oder der nämlichen Gemeinde. Wir sind gern bereit, nach dem Beispiel des barmherzigen Samaritans auch die Andersgläubigen in zeitlicher Not zu unterstützen, wie denn auch allenthalben die katholischen Krankenschwestern ebenso gut Protestanten wie Katholiken in ihren Spitälern und Lazaretten verpflegen. Kurz, wenn auch die religiöse Überzeugung uns trennt, so verknüpft uns doch die christliche Liebe, die uns in allen Menschen Kinder des einen himmlischen Vaters zeigt, der ja auch seine Sonne aufgehen lässt über Katholiken und Protestanten, Juden und Heiden.
So üben wir also im bürgerlichen Verkehr die weiteste Toleranz gegen unsere getrennten Schwestern und Brüder, natürlich mit dem berechtigten Wunsch, es möchten diese ihrerseits auch uns mit aufrichtiger Hochachtung und Liebe begegnen. Leider ist dies nicht immer der Fall.
3. Das Recht der Notwehr.
Die wahre Toleranz besteht keineswegs darin, dass man sich nicht rührt, wenn einem die heiligsten Rechte vorenthalten, verkürzt oder geraubt werden. In dieser Lage aber befinden sich vielfach die Kinder der wahren Kirche Jesu Christi. Fürs erste gibt es auch heute noch einzelne Staaten, in welchen die Katholiken nicht als gleichberechtigt mit den Gliedern der übrigen christlichen Bekenntnisse angesehen werden, sondern allerlei ungerechten Ausnahmegesetzen unterstehen. In anderen Ländern ist zwar den Katholiken durch die Verfassung gleiches Recht mit den Protestanten zugesichert; aber in der Praxis werden doch die letzteren überall bevorzugt und fast mit allen wichtigeren Ämtern betraut, während ein Katholik nur äußerst schwer zu einer höheren Stelle Zutritt findet. Ja, selbst in Staaten mit überwiegend katholischer Bevölkerung sind die katholische Religion und ihre Bekenner häufig den unwürdigsten Angriffen und Kränkungen ausgesetzt. Wir brauchen gar nicht nach Frankreich zu schauen, wo ein förmlicher Vernichtungskampf gegen die Kirche begonnen hat! Auch in Ländern deutscher Zunge lästert man in Wort und Schrift ungescheut die Glaubenssätze und Gebräuche unserer heiligen Religion, verleumdet ihre Priester, schließt die katholischen Studentenverbindungen an den Universitäten von den öffentlichen Versammlungen aus; ja, man verschmäht kein Mittel der Lüge, Heuchelei und Bestechung, um die Gläubigen von Rom, dem Mittelpunkt der Einheit, loszureißen und sie dem Protestantismus, oder richtiger gesagt, dem Unglauben in die Arme zu treiben. Denn das ist eine offenkundige Tatsache, dass die wütendsten Anfeindungen der katholischen Kirche heutzutage nicht so sehr von den Andersgläubigen, als von den Ungläubigen ausgehen, mögen es nun Juden, Protestanten oder Katholiken sein. Diese Menschen also, die weder an die heiligste Dreifaltigkeit noch an die Gottheit Christi, ja, oft nicht einmal an das Dasein eines persönlichen Weltschöpfers und an die Unsterblichkeit der Seele glauben: sie haben sich untereinander verbrüdert und verschworen, die Kirche Christi zu knebeln, ihrer Rechte zu berauben und sie schließlich, wenn es geschehen könnte, vom Erdboden zu vertilgen. Ihre Angriffe sind nicht gegen die einzelnen Katholiken, sondern gegen die Kirche und schließlich gegen Gott den Herrn selbst gerichtet.
Und da sollten wir untätig zuschauen und schweigen und dulden, bis nichts mehr zu retten ist? Das wäre nicht Toleranz, sondern Stumpfsinn und Feigheit. Nein, wir haben das Recht und die Pflicht und auch den Willen, unsere heiligsten Güter gegen freche Räuber zu behaupten und die Sache Gottes gegen frevelhafte Eingriffe zu verteidigen – nicht mit den Waffen der Gegner d.h. durch Verleumdung und Lüge, Bedrückung und rohe Gewalt, sondern in der Rüstung der Wahrheit und durch kraftvolle Anwendung aller gesetzlich zulässigen Mittel. Wir wünschen aufrichtig den Frieden, aber einen ehrenhaften Frieden, der auf beiden Seiten gehalten wird. Verweigert man ihn, dann nehmen wir mutvoll den Kampf auf im Vertrauen auf Gott, der zwar keine Wunder wirkt zugunsten der Trägen und Säumigen, wohl aber gern denjenigen beisteht, die ihrerseits alles tun, was sie können.
________________________________________________________________________

2. Taufkerze
Ein neugeweihter Priester freute sich wirklich sehr, zum ersten Mal das Sakrament der Taufe zu spenden; er überreichte dem getauften Kind das weiße Kleid, das Sinnbild der Unschuld, und die Kerze, deren Licht den Glauben und die guten Werke bedeutet. Tiefbewegt sprach er beim Überreichen der Kerze:
„Nimm hin die brennende Leuchte, bewahre tadellos deine Taufgnade, halte Gottes Gebote, damit du dem Herrn, sobald Er zur Hochzeit kommt, entgegeneilen kannst zugleich mit allen Heiligen im Himmelssaal!“
Diese Kerze bewahrte der Priester selbst auf als Andenken an sein erstes Spenden der heiligen Taufe.
Das getaufte Kind, ein Mädchen, wuchs heran. Als Schulkind war es wirklich noch bedacht, lieb und fleißig, doch später kam der Leichtsinn, ja sogar höchste Gefahr, die Unschuld ganz zu verlieren. Mit tiefem Schmerz und Kummer bemerkte der Priester, der noch in der gleichen Pfarrei wirkte, die drohende Gefahr und dachte:
„Soll das erste Kind, das ich taufen konnte, verloren gehen? O Gott erleuchte mich, das rechte Mittel zu seiner Rettung zu finden!“
Da kam ihm lebhaft der Gedanke, die Taufkerze wieder hervorzuholen. Er ließ das Mädchen rufen und sprach als guter Hirt recht wohlmeinend von der großen Gnade der heiligen Taufe, vom Gelöbnis, dem bösen Feind zu widersagen und dem dreieinigen Gott gläubig zu folgen; er hielt schließlich dem Mädchen die Taufkerze vor Augen und erklärte:
„Schau, diese Kerze habe ich dir als einem neuen Kind Gottes überreicht, dieses Sinnbild des Glaubens und der guten Werke. Willst du nun wirklich das Himmelslicht erlöschen lassen in deiner Seele?“
Beim Anblick der Taufkerze fing das Mädchen an zu weinen, indem sein Herz auftaute vom Gnadenstrahl getroffen; es waren Tränen des Reueschmerzes über den bisherigen Leichtsinn. Ernstlich versprach es, die Gefahr entschieden zu meiden, und es hielt auch wirklich Wort, hielt fortan getreulich fest am guten Vorsatz:
Von der Taufe bis zum Tod
Will ich folgen Dir, o Gott!
________________________________________________________________________
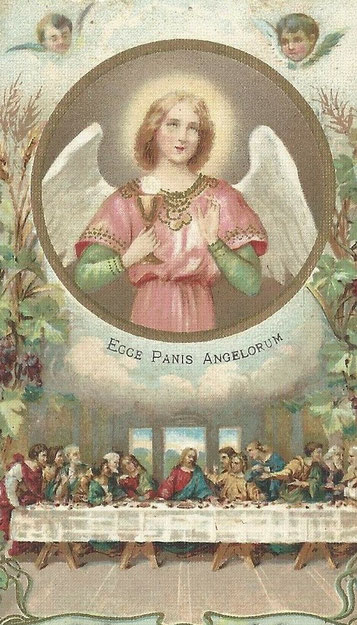
3. Tod
Der Gruß zur Ewigkeit
Wie stellst du dir den Altmeister Tod vor, der schon Jahrtausende um die Erde wandert und von jedem Menschen einmal gegrüßt sein will? Ist er wie ein eisgrauer Alter mit blutlosem Gesicht und erloschenen Augen, der dir stumm zuwinkt, in seinen grauen Kahn zu steigen und in ein düsteres Nebelmeer zu fahren? So haben ihn die alten Heiden Griechenlands sich vorgestellt.
Ist er ein bleiches, knorriges Gerippe, mit Leintuch und geschwungener Sense, wie ein Schnitter, der an der blühenden Wiese steht? Hui, wie die Sense saust, wie Gras und Blumen in langen Schwaden hinsinken! Und das Gerippe grinst; denn was es hinmäht, sind nicht Gras noch Blumen, sondern glückverlangende, lichtsuchende Menschen. O was für ein Schnitt ins Innerste der Seele! So steht der Tod, in Stein gehauen, lebensgroß auf einem Grabmal, auf dem Kirchhof.
Nicht weit davon steht auf demselben Kirchhof der Tod als Frau in Stein gehauen; man möchte das Bild „Die Auflösung“ nennen. Da lehnt eine Frauengestalt, halb stehend, halb liegend, in ohnmachtähnlichem Schlaf gegen eine Rückwand. O welch ein trauriges Auseinanderstieben alles dessen, was man in mühevoller Lebensarbeit gesammelt hat!
Oder ist es eine edle Engelsgestalt, die am Rand der Lebensstraße sitzt und müde Wanderer mit ihrer Tageslast vorbeikeuchen und nach der fernen Heimat „Friede“ ausschauen sieht? Da fasst der Engel einen sanft bei der Hand und küsst ihn auf die heiße Stirn und spricht: „Komm mit, du bist am Ziel, hier ist der Friede!“
Gib einmal acht, wie merkwürdig das ist: Aus der Art, wie du dir den Tod vorstellst, kann ich dir sagen, wie du dir das Leben vorstellst.
Du meinst, das ginge nicht? Das geht ebenso gut, wie wenn du aus einem Blatt Papier eine Figur herausschnittest, und mir dann das Blatt mit dem Loch gäbst, das durch dein Schneiden entstanden ist. Aus der Lücke im Papier kann ich doch ganz genau sehen, was du da ausgeschnitten hast. So ist auch der Tod eine Lücke des Lebens, zeigt also die umgekehrten Züge.
Darum ist es so interessant, die Symbole zu studieren, unter denen der Tod von den Menschen dargestellt wird: Als trauernder Jüngling mit umgekehrter erlöschender Fackel, als geborstene oder gestürzte Säule, als steinerne Aschenurne, als grinsender Schädel mit gekreuzten Knochen, als schwarzer Reiter, als erlöschende Kerze und auf andere Weise, deren wir einige schon im Anfang angesehen haben.
Was für ein Symbol passt wohl auf den Tod eines Heiden, der nicht an ein Jenseits glaubt? Doch wohl gut der Jüngling mit umgekehrter Fackel. Das Licht ist erloschen, das Dunkel beginnt.
Oder, wenn der Glaube an das Jenseits noch nicht ganz erloschen ist: der unheimliche Fährmann im düsteren Kahn.
Und welches Symbol passt auf den Tod eines Lebemenschen? Wohl der unbarmherzige Schnitter mit der Sense. Oder das Bild, das einem ihrer Dichter beim herannahenden Tod vorschwebte:
Das ist der böse Thanatos,
Er kommt auf einem schwarzen Ross;
Ich hör den Hufschlag, hör den Trab,
Der dunkle Reiter holt mich ab.
(Thanatos=Tod)
Wie würde man aber den Tod malen, wenn man ihn sichtbar an das Sterbebett Mariä, der lieben Gottesmutter, treten ließe, deren Hinscheiden wir feiern?
Sicher als einen verklärten Engel, oder als eine Schar solcher seligen Geister, die mit Ehrfurcht und sehnlicher Erwartung in das Gemach der Fürstin Himmels und der Erde treten, um sie zum Triumphzug in ihr Reich, zur Hochzeit des königlichen Bräutigams zu holen.
Hier hat der Sensenmann nicht Platz, denn es wird keine Blume weggemäht; sie wird nur in ein schöneres Paradies verpflanzt. Hier passt kein düsterer Fährmann hin, der ins graue Schattenreich fährt, sondern ein königliches Geleite in die seligen Räume des Lichtes. Hier kann kein Jüngling mit umgekehrter Fackel stehen, denn das Licht ihres Lebens strahlt im Himmel weiter gleich einer Sonne, vor der selbst die Engel wie Sterne verbleichen. Hier ist der Tod keine abschreckende Gestalt, denn er wurde mit Sehnsucht herbeigewünscht, als Pforte zum himmlischen Brautgemach. Hier kann man keine abgebrochene Säule auf das Grab setzen, denn das Zepter ihrer Macht wurde ihr nicht entrissen, sondern in neuem Glanz ihr anvertraut samt der königlichen Krone.
Welch ein helles Licht warf dieser Tod auf das vorhergehende Leben! Wie süße Heimatlaute umschmeichelte es das Ohr und ließ die Klänge der ewigen Musik schon aus den Himmelsräumen herüberrauschen. Es war, wie wenn ein einsamer Wanderer beim Morgengrauen am Meer steht und Wolken und Fluten sich schon rosig färben und purpurn heranrauschen und immer neue Lichtgarben am Horizont dem Ozean entsteigen, bis endlich die Sonne heraufzieht in glühender Pracht und der Mensch hingerissen die Arme ausbreitet und freudig ausruft: Sei gegrüßt, du leuchtendes, ewiges Licht!
________________________________________________________________________

4. Taufe
Über die Taufe
Wer nicht glaubt und getauft ist, kann nicht selig werden. In seinem Zwiegespräch mit Nikodemus sprach Jesus, der Sohn Gottes: „Wenn jemand nicht wiedergeboren ist aus dem Wasser und dem Heiligen Geist, kann er nicht eingehen in das Reich Gottes.“ Es ist das heilige Sakrament der Taufe demnach die erste und notwendigste Vorbedingung zur Seligkeit. Deshalb hat die Kirche von jeher darauf gedrungen, dass die Taufe dem neugeborenen Kind möglichst in den ersten Tagen erteilt werde.
1. In den frühesten Zeiten ging der Taufe der Erwachsenen eine längere und sorgfältige Vorbereitung voraus. Dann wurden die Vorbereiteten unter den Einsetzungsworten dreimal völlig untergetaucht und mit dem Katechumenenöl und Chrisam gesalbt, wie es heute noch üblich ist. Die Täuflinge trugen das weiße Taufkleid acht Tage lang. Die weiße Wachskerze, die dem Täufling gereicht wurde, sollte das angezündete Glaubenslicht, die brennende Liebe und den Glanz der guten Werke anzeigen. Der Tauftag war bei den alten Christen so wichtig, dass sie ihn alljährlich auf eine festliche Weise feierten, Ihre Taufgelübde erneuerten und dadurch, besonders in den Zeiten der Verfolgungen, ihren Glauben stärkten und anfeuerten. Daher rührt bei den Katholiken die alte Gewohnheit, nicht den Tag ihrer leiblichen Geburt, sondern den Tag ihrer geistigen Wiedergeburt zu feiern, wo sie den Namen eines Heiligen empfingen, der ihnen auf der gefahrvollen Wanderung durch das Erdenleben ein leuchtendes Vorbild, ein sicherer Hort und getreuer Geleiter zum Himmel sein sollte. Mit dem unsichtbaren Patron erhält der Täufling in dem Paten einen sichtbaren Beschützer, der besonders die religiöse Erziehung des Getauften überwachen soll. – Da die Taufe zur ewigen Seligkeit unbedingt notwendig ist, so kann im Notfall jeder Mensch taufen, er muss aber den Willen haben, wirklich zu taufen und beobachten, was die Kirche vorgeschrieben hat, nämlich dreimal Wasser über das Haupt des Kindes ausgießen, indem er spricht: „Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Jede andere Form, z.B. „ich taufe dich im Namen der heiligsten Dreifaltigkeit“, ist ungültig.
2. Die heiligen Väter werden nicht müde, die segensreichen Wirkungen der heiligen Taufe zu preisen. So schreibt der heilige Cyrillus: „Die Taufe ist etwas Großes, sie ist der Preis für die Freiheit jener, die in der Sklaverei waren; sie wäscht die Makeln der Sünde ab, und gibt der Seele ein neues Dasein, sie ist ein Lichtkleid und ein unauslöschliches Siegel der Berufung zur Heiligkeit. Sie ist die Einverleibung in die Herde Christi, und die Weihe durch den Heiligen Geist.“ Der heilige Gregor von Nazianz sagt: „Die Taufe ist die Auffahrt zu Gott, die Pilgerschaft mit Christus, das Licht unseres Glaubens, die Wegspülung der Sünde, die Zersprengung der Sklavenketten, der wahre Himmelsschlüssel.“ Bei der Taufe Jesu im Jordan öffnete sich der Himmel, der Heilige Geist kam über den Heiland herab, und der Vater erklärte ihn als seinen innigstgeliebten Sohn. Ähnlich öffnet auch jetzt bei der Taufe jedem Kind sich der Himmel, der Heilige Geist kommt herab, und weiht das Herz des Täuflings zu seinem Tempel ein, und der Vater ruft über dem Neugetauften: „Dieses ist mein vielgeliebtes Kind, an dem ich mein Wohlgefallen habe.“ – König Ludwig der Heilige von Frankreich hielt sich nirgends lieber auf, als zu Poissy, weil er in dieser Stadt getauft und sein Name in das Buch des Lebens eingetragen worden war. Er erklärte öfters, dass ihm nirgends in seinem ganzen Reich so viel Ehre widerfahren sei, als zu Poissy, dem Ort seiner Taufe. – Jego, Herzog von Kärnten, hatte unter seinen Edelleuten noch viele, die dem Götzendienst nicht entsagen wollten. Im Jahr 791 ließ er nun ein großes Gastmahl bereiten und lud dazu die noch heidnischen Edelleute, aber auch eine Schar armer, hoch christlicher Arbeiter ein. Den Großen wurde ihre Tafel im Hofraum bereitet und mit einfachem Brot, schlechtem Fleisch und sehr billigem Wein in irdenen Gefäßen gedeckt. Die armen Christen hingegen zog der Herzog an seine Tafel, stellte ihnen den köstlichsten Wein in goldenen Pokalen vor, ließ die delikatesten Speisen auftragen und bewirtete sie fürstlich. Die Magnaten erzürnten heftig über ihre Zurücksetzung und fragten mit flammenden Augen nach der Ursache. Der Fürst erwiderte ganz gelassen: „Wundert euch nur nicht über mein Verfahren! Diese hier, zwar arm an zeitlichen Gütern, sind reich an göttlichen Gnaden durch die heilige Taufe geworden, sie sind Kinder und Erben des Allerhöchsten, ich erkenne sie alle als meine rüder in Christus an. Ihr aber, zwar reich an zeitlichen Gütern, seid bettelarm an geistigen Schätzen; eure Seele ist beschmutzt mit vielen Makeln, ihr seid noch Sklaven der Finsternis. Darum ist eure Gesellschaft entehrend für mich.“ Die ernste Ansprache hatte zur Folge, dass die meisten Großen sich unterrichten und taufen ließen. – Sind auch wir von Herzen dankbar für die unaussprechliche Gnade der Taufe und zeigen wir uns dieser Ehre wert. Amen.
________________________________________________________________________

5. Teufel
Von den Teufeln
Heutzutage wird von vielen Ungläubigen und sogar von manchen Christen das Dasein und Wirken der Teufel geleugnet, und doch ist kaum eine andere Lehre des Christentums durch die Heilige Schrift und Überlieferung, sowie durch unleugbare Tatsachen so verbürgt, wie die Lehre von den gefallenen Engeln, die Teufel genannt werden.
1. Es gibt Teufel und sie besitzen große Macht,
2. aber sie können uns nicht besiegen, außer durch unsere Schuld.
1. Der heilige Evangelist Johannes erzählt uns in der Geheimen Offenbarung den Kampf der guten Engel unter Anführung des Erzengels Michael gegen den aufrührerischen Luzifer und seinen Anhang, und wie sie besiegt und in den Abgrund der Hölle hinabgestürzt wurden. Und der heilige Petrus schreibt: „Gott hat der Engel, die sich versündigten, nicht geschont, sondern sie mit Ketten der Hölle in den Abgrund gezogen und der Pein übergeben, um sie zum Gericht aufzubewahren.“ Am Tag der allgemeinen Abrechnung wird der Allgerechte zu denen sprechen, die dem Teufel und seinen Einflüsterungen folgten: „Weicht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinem Anhang bereitet ist!“ – Manche wollen noch wohl das Dasein der Teufel glauben, meinen aber, der Teufel könne ihnen nicht schaden. Allerdings hat Christus durch seinen Opfertod am Kreuz die Macht Satans gebrochen. Desungeachtet „geht er noch umher, wie ein brüllender Löwe, suchend, wen er verschlinge“, wie der heilige Petrus versichert. Und der heilige Paulus schreibt: „Wir haben nicht bloß zu kämpfen gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, gegen die bösen Geister unter dem Himmel.“ Der Teufel hat in Gestalt einer Schlange die Eltern im Paradies verführt und ins Elend gestürzt, er hat den ersten Brudermord veranlasst, den David zum Hochmut verleitet, den weisen Salomo in einer Toren gewandelt, den Judas zum Verrat und zur Verzweiflung gebracht, den Ananias zur Lüge bewogen. Selbst an den Heiland wagte er sich heran und versuchte die Apostel wie Weizen zu sieben. Noch immer geht die Arglist und Bosheit des Teufels darauf aus, Unglauben und Unsitte unter den Menschen zu verbreiten. Wir haben allen Grund zu zittern, doch dürfen wir nicht verzagen, denn wir können unseren ärgsten Feind besiegen, wenn wir nur wollen.
2. Wir stehen unserem Erzfeind nicht wehrlos gegenüber, denn Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz die Macht der Hölle gebrochen. Wenn uns Gott noch vom Teufel versucht werden lässt, so geschieht das zu unserer Prüfung und Läuterung, wie wir es im Leben vieler Heiligen sehen. „Selig der Mensch“, schreibt der Apostel Jakobus (1,12), „der die Anfechtung aushält, denn wenn er bewährt worden ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieben“. Der Teufel kann uns mit bösen Gedanken und Vorstellungen versuchen, aber zum Bösen zwingen kann er uns nicht. Wen der Teufel nicht versucht, ist gewöhnlich schon in seiner Gewalt. Gott will uns aber nicht über unsere Kräfte versuchen. Wir brauchen nicht zu fürchten, sondern können mit dem Psalmisten sprechen: „Wenn auch ein Heerlager gegen mich aufstände, so soll sich mein Herz nicht fürchten; wenn sich ein Streit gegen mich erhebt, will ich hoffen.“ (Ps 26) „Ist Gott mit uns, wer kann gegen uns sein?“ Er wird mit uns sein, wenn wir seine Aufforderung beachten: „Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt!“ Wachen wir, beten wir, kämpfen wir, rufen wir unsere Schutzengel an und folgen wir ihrer guten Führung, dann kann uns keine Macht der Hölle schaden, denn der Geist des Herrn versichert: „Deinetwegen hat Gott seinen Engeln Befehl gegeben, dich zu schützen auf deinen Wegen. Auf deinen Händen werden sie dich tragen, dass dein Fuß nicht an einen Stein stoße. Du wirst hinweggehen über Schlangen und Basilisken, und zertreten Löwen und Drachen.“ Amen.
________________________________________________________________________
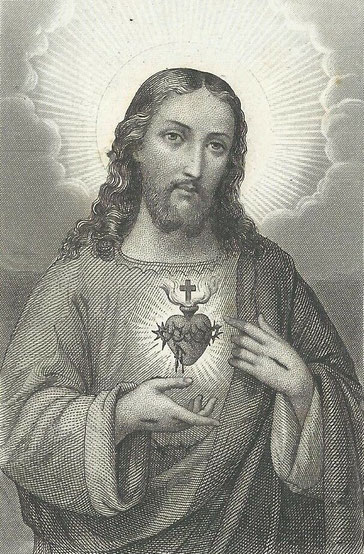
6. Tempelweihe
Wie beim auserwählten Volk Israel der prachtvolle Tempel Salomos nach seiner Vollendung unter großen Feierlichkeiten eingeweiht wurde, so war es seit den ältesten christlichen Zeiten üblich, die Gebäude, die zum Dienst Gottes errichtet waren, unter bedeutungsvollen Zeremonien einzuweihen. Zu welchem Zweck geschieht die Tempelweihe?
1. Der Tempel ist ein Haus Gottes. Die ganze Schöpfung ist ein erhabener Tempel Gottes, aber in der Kirche hat er seine besondere Wohnung aufgeschlagen. Von dem sagt der göttliche Heiland: „Mein Haus ist ein Bethaus.“ Wenn nun schon der Tempel zu Jerusalem von Christus als Wohnung Gottes bezeichnet wird, so trifft dies bei unseren katholischen Kirchen in noch weit höherem Grad zu, denn in ihnen verweilt der eingeborene Sohn Gottes mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, mit Fleisch und Blut im allerheiligsten Altarsakrament. Von unseren Tempeln gilt mehr, als vom Tempel Salomos, die Versicherung Gottes: „Meine Augen sollen offen sein und meine Ohren aufmerksam auf das Gebet desjenigen, der da betet an diesem Ort, denn ich habe diesen Ort erwählt und geheiligt, dass mein Name dort sei ewig, und meine Augen und mein Herz sollen dort bleiben alle Tage.“ (2 Chron 7,12ff) Sollten diese Worte nicht noch mehr gelten von den Tempeln des Neuen Bundes, in denen der menschgewordene Gottessohn seinen Tempel aufgeschlagen hat?
2. Der Tempel wird geweiht zum Haus des Gebetes. Alles, was du in der Kirche wahrnimmst, muss dich auf den Flügeln der Andacht zum Himmel erheben. Der feierliche Gottesdienst, die sinnvollen Zeremonien, der erhebende Gesang, die ergreifenden Töne der Orgel, der Anblick der vielen Andächtigen stimmen wunderbar zur Andacht. Durchschauert dich nicht heilige Ehrfurcht, wenn das Allerheiligste zur Anbetung ausgesetzt wird? Heben nicht die aufsteigenden Weihrauchwolken deine Seele zu Gott empor? Muss das Lob-, Dank- und Versöhnungsopfer auf dem Altar dich nicht zum vertrauensvollen Gebet ermuntern? Muss nicht alles, was du in der Kirche wahrnimmst, deine Seele in eine fromme Stimmung versetzen? Der Hochaltar, der Tabernakel, das Ewige Licht erinnert dich an den unter Brotsgestalt verborgenen Heiland. Das Kruzifix erzählt dir von der unendlichen Liebe Jesu und fordert dich zur Gegenliebe auf. Der Taufstein ruft die unaussprechlichen Gnaden wach, die du gleich nach deiner Geburt im heiligen Sakrament der Taufe erhieltest. Der Beichtstuhl mahnt dich zur Reue über deine Sünden. Die Bilder der Heiligen erzählen von ihren schönen Tugenden und beschämen unsere Lauheit im Ringen nach himmlischen Gütern. Die heilige Stille ringsumher erfüllt uns mit inniger Ehrfurcht vor der unsichtbaren Nähe Gottes und ruft uns ein Sursum corda zu. Welcher andere Ort hebt so mächtig die Gedanken zu Gott empor? Könnte man zu Hause so andächtig beten, wie im Tempel, dann würden alle Völker aller Länder und Zeiten nicht besondere Gebäude zum Dienst des Allerhöchsten errichtet haben.
3. Der Tempel wird eingeweiht zum gemeinsamen Dienst Gottes. Der göttliche Heiland versicherte: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Um wie viel kräftiger und wirksamer wird ein Gebet sein, das aus den Herzen einer ganzen im Gotteshaus versammelten Gemeinde zum Thron Gottes hinaufsteigt. Wenn ein ganzes Volk seinem Regierenden eine Bitte vorträgt, wird er sie nicht besser erhören, als wenn ein einzelner ihm dieselbe Bitte vorträgt? „Vereinte Kraft macht stark“, sagt das Sprichwort. Deshalb vereinigen sich zur Zeit der Not die Christgläubigen, und scharen sich zu Bittgängen und öffentlichen Prozessionen zusammen, um mit vereinten Gebeten den Himmel zu bestürmen, dass er die Drangsale abwende und Glück und Frieden spende. Zu solchen traurigen Zeiten finden sich gewöhnlich auch solche Menschen in der Kirche ein, die in besseren Tagen sagen, sie könnten zu Hause oder im Freien ebenso andächtig beten, wie im Tempel.
Besuche recht oft das Gotteshaus und wohne mit gesammelter Andacht dem hochheiligen Opfer und den übrigen Gottesdiensten bei. Betritt die Schwelle des Gotteshauses mit heiligem Schauer, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Der Tempel ist geweiht zum Dienst des Allerhöchsten, missbrauche und entheilige ihn nicht zu weltlichen Gedanken, zum Unterhalten und Umherschauen, sondern klopfe mit dem demütigen Zöllner an deine Brust und sprich: „Gott sei mir armen Sünder gnädig.“ So wirst du mit Segen das Haus Gottes wieder verlassen und himmlische Güter heimtragen. Amen.
________________________________________________________________________

7. Totengedenken
Totengedenken: Prof. Dr. Johannes Maria Verweyen
Ich gedenke eines lieben Toten
Von Kaplan Stanislaw Kadziolka
Aus VVN-Nachrichten,
Pressedienst der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes,
Düsseldorf, 5. Juli 1947
Vergangenes wachzurufen und Erinnerungen über Erlebnisse im deutschen Konzentrationslager zu schreiben, scheint mir in gewissem Sinn etwas Unmoralisches zu sein. Kann man denn ohne Schmerz an jene furchtbaren Erlebnisse zurückdenken und jene Dante-Szenen wiedergeben, die sich dort abgespielt haben? Um in seinem Gedächtnis diese teuflische Vergangenheit völlig auszulöschen und seine Seelenruhe wiedererlangen zu können, würde ich jedem, der im Konzentrationslager war, raten, sich in Zukunft von dieser Art Erinnerungen freizumachen.
Und dennoch . . . dennoch möchte ich ganz kurz die deutschen Konzentrationslager Oranienburg-Sachsenhausen und Bergen-Belsen ins Gedächtnis zurückrufen, und zwar deshalb, weil ich eines Menschen mit edlem Charakter, eines großen Gelehrten, eines deutschen Häftlings, des Professors Dr. Johannes Verweyen, gedenken will.
In vorgerücktem Alter, mit grauem Haar, gutem Körperbau und stets lächelndem Gesichtsausdruck fiel Professor Johannes Verweyen unter den übrigen Häftlingen nur durch eine am linken Arm getragene einfache Armbinde mit der Aufschrift „Sprachlehrer“ auf. Diese Aufschrift war zugleich die Bezeichnung seines Arbeitskommandos; den Professor Johannes Verweyen wurde durch das Lagerkommando der SS in Oranienburg „befördert“, indem ihm die Aufgabe gestellt wurde, den der deutschen Sprache nicht mächtigen Häftlingen die Grundsätze dieser Sprache beizubringen. Zu den Grundkenntnissen gehörten: Name des Arbeitskommandos, die anstelle des Namens zugewiesene Nummer, die Nummer jenes Blocks, dem der Häftling angehörte usw. Durch diese Art Beschäftigung war der Professor zum Besuch jener Blocks berechtigt, in denen sich die Häftlinge aufhielten (für gewöhnlich Kranke und Krüppel; denn nur solche durften in den Blocks im Lager selbst beschäftigt werden). Professor Johannes Verweyen lehrte also sein Fach, indem er das ganze Lager und die sich darin befindlichen Häftlinge besuchte. Für gewöhnlich schweifte der Professor von dem ihm durch die SS vorgeschriebenen Schulungsprogramm ab. In Augenblicken, in denen niemand von der SS-Mannschaft anwesend war, machte er seinen Leidensgenossen gegenüber Mitteilungen über die neusten und wahrheitsgetreuen Nachrichten von der Front, machte dabei seine eigenen, kritischen Bemerkungen über die politische Lage, tröstete die Verzweifelten und flößte Mut in die Herzen der Traurigen ein.
Alle liebten den Professor; denn er verstand es, eine Unterhaltung in Schwung zu bringen und die Gedanken, wenn auch nur für Augenblicke, von der traurigen Wirklichkeit abzuleiten. Nur die rückständigen jungen Leute verstanden den Professor nicht, wenn er von der Sonne sprach. Sobald die Sonne stärker durch die Wolken schien, leitete er das Gespräch auf die Sonnenstrahlen über. Während er Sprachunterricht erteilte, ließ er als Beispiel aus dem Russischen ins Deutsche „herrlich strahlt die Sonne“ oder „morgen wird die Sonne scheinen“ übersetzen. Die Intelligenteren wussten, dass der Professor auf diese Weise tröstete und ihnen den näher rückenden Tag der Befreiung zum Bewusstsein brachte.
Ich entsinne mich, wie ich im Mai 1943 mit Professor Johannes Verweyen im Lager Oranienburg im Block 15 zusammentraf. Das war ein Block ganz besonderer und, wie es im Lager hieß, ein in gewissem Sinn bevorzugter Block. Ich möchte an dieser Stelle die Zusammensetzung einer der Stuben dieses Blocks nach Beruf und Nation anführen: jugoslawische Diplomaten, polnische, französische, belgische, holländische, ukrainische Geistliche, ein belgischer Minister des Innern, ein holländischer Rechtsanwalt und Ingenieur, ein deutscher Akrobat, ein polnischer Schneider, ein russischer Tischler, ein polnischer Offizier, ein tschechischer Friseur, ein österreichischer Bankangestellter usw. Als der Professor den Neuankömmling erblickte, kam er, wie gewöhnlich mit einem Stoß Notizbücher und Notizen in der Hand und einem Buch unter dem Arm, an mich heran und fragte mich in polnischer Sprache, wie ich heiße, woher ich stamme, und ob ich an seinen Vorträgen teilnehmen wolle. Die letzte Frage setzte mich in Erstaunen, denn ich wusste nicht, dass der Professor in diesem Block für eine gewisse Gruppe in offizielle Vorträge hielt. Bald wurde ich jedoch von den Kameraden belehrt, worum es hier ging, und nahm am Tisch Platz, d.h. ich setzte mich zur Arbeit (ich hatte nämlich wie die anderen in dem Block Kabelkommando). Mit der einen Hand wickelte ich dünne Drähte auf, während ich mit der anderen Eintragungen über den Vortrag des Professors machte und aufmerksam seinen Worten folgte. Dies war damals sein erster Vortrag aus der Vortragsreihe: „Aristoteles, Thomas von Aquin und Kant“. Nach Beendigung des Vortrags folgte für gewöhnlich eine längere Diskussion, wobei auch die Lagerereignisse, Pressenachrichten usw. berührt wurden. Da diese Vorträge eine Art Verschwörung waren, wurden sie in französischer Sprache abgehalten. Der Professor kam täglich zu uns, und nichts konnte ihn davon abhalten. Oft passierte es, dass er erkältet und mit verbundenem Hals zum Vortrag kam; trotzdem gab er sich Mühe, seine Pflicht zu erfüllen. Er war ein Mann von vielseitigen Interessen, sprach klug und überlegt und baute seine Gedanken immer auf philosophischen Grundsätzen auf. Es geschah gar nicht so selten, dass er nur einen einzigen Hörer hatte; dennoch sprach er wie vor einem vollen Saal, oft nahm seine Stimme an Stärke zu. Er gestikulierte, stand von der Bank auf und setzte sich wieder wie früher hinter den Katheder. Ich bemerkte, dass der Professor auch ein erstklassiger Theologe war. Nicht wenige Geistliche haben es ihm zu verdanken, dass sie die auf der Universität erworbenen theologischen Kenntnisse mit ihm auffrischen konnten. Ich entsinne mich, dass ich einmal nach einem Vortrag über das Thema: „Gebet“ zwei Wochen lang mit dem Professor diskutiert habe. Die von Professor aufgestellte These lautete: „Kann und soll man für die Verdammten beten?“ Als Beispiel eines Verdammten wurde der historische Rasputin angeführt, über welchen der Professor zufällig ein Buch bei sich hatte, wobei er seine Bemerkungen im Kommentar nach dem Vortrag machte.
Mein Gott, wieviel Themen berührten wir während unserer Vorträge! Skizzenweise gingen wir die ganze Philosophie und Theologie durch, sprachen über Kunst und Politik (unter sehr kritischer Berücksichtigung des nationalsozialistischen und faschistischen Programms), mit einem Wort – wir sprachen über alles.
Wegen seiner ungewöhnlichen Vorzüge wurde Professor Verweyen im Lager Oranienburg von allen sehr verehrt und geschätzt. Tatsache ist, dass es verboten war, sich gegenseitig irgendwie zu titulieren, sogar die allgemein gebrauchte Anredeform „Herr“ war verboten. Ohne Rücksicht auf den Altersunterschied wurden wir alle mit „du“ angeredet. Es passierte aber niemals, dass jemand den Professor so angeredet hätte. Nur er allein wurde mit „Herr Professor“ oder zum mindesten mit „Professor“ tituliert. Diese Achtung vor dem Professor hatten Häftlinge aller Nationen, sogar diejenigen, die neben ihrer Nummer ein grünes Dreieck trugen und dafür berühmt waren, keine Kinderstube, dafür aber eine Reihe krimineller Vergehen auf dem Kerbholz zu haben.
Auch außerhalb der Vorträge sah ich Professor Johannes Verweyen im Lager Oranienburg sehr oft. Ich traf ihn im Baderaum, vor dem Lautsprecher, wo er sich aufmerksam die Kriegsberichte anhörte. Ich traf ihn nach dem Abendappell, wenn er einsam seinen Spaziergang machte, oder in den Blocks und zwischen den Blocks in Gesellschaft anderer. Wenn er auch lächelte, so war er doch immer ernst und bescheiden. Jeder sah es dem Professor sofort an, dass er kein Durchschnittsmensch war. Am 4. Februar 1945 wurde eine ungefähr 3000 Mann starke Häftlingsgruppe aus dem Lager Oranienburg nach einem (wie die SS verlauten ließ) „Erholungslager“, und zwar nach dem Lager Bergen-Belsen, gebracht. (Wenn Oranienburg-Sachsenhausen die Hölle war, so war Bergen-Belsen eine Hölle in der Hölle).
In dieser Gruppe befand sich auch Professor Johannes Verweyen und mit ihm eine Handvoll seiner früheren Hörer. Die Fahrt war für alle sehr beschwerlich. Während der Fahrt sah ich den Professor nicht, aber ich konnte mir vorstellen, was für eine Qual diese für einen betagten Mann wie Professor Verweyen war. Professor Verweyen erblickte ich erst auf der Bahnstation in Bergen-Belsen, als er den Zug verließ. Er lächelte wie immer, aber es war nicht schwer zu erkennen, wie hart ihm die Fahrt geworden war. Ich glaubte, dass wir wieder zusammen sein würden, dass wir weiterhin mit ihm zusammenleben und an seinen Vorträgen wieder teilnehmen würden. Leider wurden wir getrennt. Zwei Wochen lang sah ich den Professor nicht. Die in dem Lager herrschenden Verhältnisse waren für alle schrecklich. Der Professor hatte unter besonders schweren Verhältnissen zu leiden. Er tat uns allen sehr leid. In dem neuen Lager wurde ihm nicht mehr die Stellung eingeräumt, die er vorher in Oranienburg innegehabt hatte. Er wurde wie die anderen geschlagen und gestoßen, musste tagelang appellstehen, und nicht immer erhielt er täglich seine Schüssel warmes Wasser mit einigen Stückchen Steckrüben darin. Durch ein geschicktes Manöver gelang es uns, ihn in unseren Block zu bringen. Bequemlichkeiten gab es nicht, aber wir waren wieder zusammen. An Vorträge war nicht zu denken. Jeder suchte einen Winkel zwischen den Pritschen, um die Aufmerksamkeit der Henker nicht unnötig auf sich zu lenken. Dasselbe tat der Professor. In jener Zeit sah ich ihn oft in Gedanken versunken und schweigsam. Ich diskutierte nicht mehr mit ihm, denn ich selbst war auch sehr niedergedrückt. Mein Landsmann Pfarrer Szweinoch aus Kattowitz dagegen verbrachte ganze Stunden, plaudernd und lange Gespräche führend, mit ihm zusammen. Er war von der Persönlichkeit des Professors von Tag zu Tag mehr beeindruckt. Ich bemerkte, dass Pfarrer Stefan Szweinoch und der Professor enge Freundschaft miteinander geschlossen hatten.
Eines Tages standen wir lange beim Appell. Ich fühlte, dass jemand hinter mir meine Mütze und Kragen berührte. Als ich mich umdrehte, erblickte ich den Professor, der sich leise entschuldigte. Immer von Nächstenliebe, nicht nur in Worten, sondern auch in Werken, erfüllt, nahm er mir damals die Läuse ab, die in großer Zahl auf meinem Anzug umherspazierten.
Der Professor war wie von der göttlichen Vorsehung bestimmt, er prägte immer das Wort „Liebe“, die Idee der Liebe! Abends hörte man oft den Ausruf: „Wo ist hier Gerechtigkeit?“ Viele Lagerinsassen freuten sich auf den Tag der Befreiung und vor allem auf die Stunde, da sie sich rächen konnten. Dann hörte man wieder die Stimme des Professors, der von der Liebe sprach – der Liebe der Menschen zueinander. Er wollte das Schlechte, das Böse mit Gutem, mit der Liebe vergelten! Die Menschen sollten vergessen können und trotz der Leiden wieder Liebe säen. Innerlich forderte auch der Professor Gerechtigkeit, aber er litt für die anderen mit – daher Liebe! Ich habe mich mit Herrn Kaplan Bobrowski oft darüber unterhalten, und wir konnten den Professor bis ins kleinste verstehen. Wenn heute viele Insassen des Lagers kein Rachegefühl hegen und die unwürdige Behandlung vergessen konnten, so sind das die Früchte dessen, was der Professor gesät hat.
Im Lager Bergen-Belsen hatten wir schwer unter Hunger zu leiden. Ein Löffel der sogenannten „Suppe“ hatte großen Wert für den menschlichen Organismus. So oft ich mich an den Professor wandte und ihm das anbot, was ich in Form von „Suppe“ organisiert hatte, lehnte er bescheiden mit der Entschuldigung ab, dass es noch andere gäbe, die es nötiger hätten als er.
Während des Appells war es einmal erbärmlich kalt. Alle klagten über Kälte, besonders ich litt unter diesem bösen Klima. Der Professor nahm diese Gelegenheit wahr, um eine schöne Betrachtung über Askese anzuschließen und dadurch das seelische Gleichgewicht der vom Schicksal Betroffenen wiederherzustellen.
Anfang März verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Professors zusehends. Er litt an einer Magenkrankheit, zu der sich eine andere furchtbare Krankheit, der Flecktyphus, gesellte. Er wurde immer weniger, ohne jemals ein Wort über seine Krankheit fallen zu lassen.
Mehr als die Hälfte der früheren Hörer des Professors ist im Lager umgekommen, darunter auch sein Freund, Pfarrer Stefan Szweinoch. Einige Tage später entschlief auch der Professor. In meinem Gedächtnis sehe ich, wie man den toten Leib des Professors vor den Block 5 hinauswarf. Aus dem Fenster des gegenüberliegenden Blocks habe ich für den toten Professor gebetet. Ich weinte lange, und lange konnte ich mich nicht beruhigen.
Was mich anbetrifft, so muss ich zugeben, dass ich Professor Johannes Verweyen nicht nur verehrt, sondern auch geliebt habe.
* * *
„Ich würde mich über die Maßen freuen, wenn das Gottesreich auf Erden in Gestalt der Kirche als des „fortlebenden Christus“ von immer mehr Menschen erkannt und wenn seine Ordnungssprüche zur Richtschnur des Lebens gewählt würden, wenn die Spaltungen im Glauben an Jesus Christus und sein Reich immer mehr verschwinden würden, wenn die Weissagung von dem einen Hirten und der einen Herde bald in Erfüllung ginge, wenn sich insbesondere die Ostkirche mit dem vielfachen Reichtum ihrer Überlieferung bald wieder mit der Mutterkirche vereinigen würde, von der sie sich vor bald tausend Jahren, wohl mehr aus politischen als religiösen Gründen, trennte, wenn die „herrliche Freiheit der Kinder Gottes“ sich auf dem Angesicht möglichst vieler kirchentreuer Christen spiegeln und zu einem anziehenden Vorbild für Andersgläubige und Andersdenkende würden.“
Prof. Dr. Johannes Maria Verweyen,
geboren am 11. Mai 1838 in Till bei Kleve,
gestorben im März 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen
________________________________________________________________________

8. Tischgebet
Etwas über das Tischgebet
Du sitzt vor dem Brot und hast gesehen, wie vieles sich ineinander geflochten hat: Feuer und Wasser, Luft und Sonnenschein, der Stand und Hantierung des Menschen, Gottes Segen und Vorsehung, die über allem gewebt und gewaltet hat, bis es dahin gekommen ist, dass du jetzt das Stück Brot vor dir liegen hast als eine Gabe der reinen Güte Gottes. – Und wer bist denn du? Du bist ein Sünder, welcher angefangen hat zu sündigen, sobald die ersten Kinderjahre zurückgelegt waren; du sündigst noch und wirst sündigen bis an dein Ende. Selbst das Gute, was du etwa getan hast, ist unrein, weil du es nicht bloß wegen Gott getan hast und weil dein Gutes gewöhnlich ohne ernste Umsicht und Sorgfalt, wie der Dienst eines großen Herrn es verlangt, ausgeführt worden ist. Du hast Gott unaufhörlich beleidigt, und er hat dir unaufhörlich Gutes getan. Und auch jetzt liegt eine Guttat Gottes vor dir, ein Stück Brot. – Willst du gedankenlos zugreifen wie ein Tier, dem man etwas zu Fressen hinwirft? Du sollst nicht nur danken dafür, was Gott durch seine Vorsehung dir vorgelegt hat, sondern du solltest gleichsam dich schämen und kaum getrauen zuzugreifen, indem du dir selber sagst: ich verdiene Strafe und keine Wohltat. Wenn der Mensch recht wüsste, was er selber ist und was ihm gebührt, so müsste er nur mit Beschämung, Scheu, reuevollem Dank und Bewunderung der Großtat und Menschenfreundlichkeit Gottes seine Hand nach dem Brot ausstrecken.
Alban Stolz
________________________________________________________________________

9. Taube
Das Symbol der Taube - Wo bleibt diesmal die Friedenstaube?
Von D. Goodby
Zusammenfassung „aus Sower“
Alton, Stoke-on-Trent, England
Wegen ihrer Gewohnheiten, ihres Auftretens oder ihrer Verbindung mit einem geschichtlichen Ereignis oder einer Legende sind bestimmte Vögel zum Symbol hervorragender Personen oder großer Ereignisse geworden und werden in der Kunst als Beiwerk verwendet. In den meisten Fällen geht dieser symbolische Gebrauch sehr weit zurück. Dies gilt ganz besonders von der bereits in der prähistorischen Zeit gezähmten blauen Felsentaube, unserer heutigen Haustaube.
Die Geschichte dieses Vogels, der in den Augen der Christen das Symbol des Heiligen Geistes ist, kann bis zum dunklen Beginn der Zivilisation und der Religion in Mesopotamien zurückgeführt werden, von woher die Naturverehrung stammte, die auf dem Prinzip des Gegensatzes zweier Welten, Himmel und Erde, männlich und weiblich, beruhte. Die Göttin Ischtar oder Ischeroth war die Personifizierung des Bodens, der durch Sonne und Regen fruchtbar gemacht wird. Dieser Göttin war die verliebte und fruchtbare Taube als Abbild des ehelichen Segens und der Vermehrung heilig. In ihrem Tempel in Babylon kaufte man weiße Tauben, um sie als Opfergabe darzubieten.
Nach und nach verbreitete sich der Kult der Ischtar durch die babylonischen Eroberungen auf Kleinasien und die ägäische Küste. Die Phrygier verehrten sie unter dem Namen Cybele, die Syrer als Darketo, die Phönizier als Atagartis und die jonischen Griechen als Astarte. In Hieropolis gab es einen großen Tempel, der der Atagartis geweiht war. Er enthielt eine hochverehrte Statue der Göttin mit einem Szepter in der Hand, worüber eine Taube schwebte. Die Verbindung der Taube mit der Göttin der Liebe ist das natürliche Ergebnis der Beobachtung der Tauben, die einander den Hof machen und sehr zärtlich miteinander sind.
Wenn wir den Ehrenplatz betrachten, den die Taube im Denken und in der Kunst der ersten Christen als ein Symbol des Heiligen Geistes einnahm, ist es auch interessant, zu hören, dass das Orakel, das Alexander der Große in der Oase Ammon befragte, seine Antworten durch bestimmte Zeichen, vor allem aber durch den Flug der Tauben, gab. Solche Legenden lassen uns etwas ahnen von der volkstümlichen Einstellung zu diesem Vogel in der Zeit, als das Christentum sich in Italien verbreitete. Nach und nach trat der christliche Symbolismus an die Stelle des früheren heidnischen Sinnbildes der Taube, und das Ergebnis davon war die alte Schlussfolgerung, dass der Teufel niemals die Gestalt dieses himmlischen Boten annehmen könne.
Es wird uns aus alter Zeit verschiedentlich berichtet, dass die dritte Person der allerheiligsten Dreifaltigkeit die sichtbare Gestalt einer Taube annahm. Nach Eusebius wurde Papst Fabian im dritten Jahrhundert auf diese Art von Gott ernannt. Der Vorfall bei der Weihe Chlodwigs in Reims am Weihnachtsfest 496 ist ein weiteres Beispiel. Die Bekehrung dieses Frankenfürsten fand nach seiner Heirat mit Chlodhilde, einer Nichte des Königs von Burgund, statt. Nach langem Überlegen versprach Chlodwig, den christlichen Glauben anzunehmen, wenn er die Schlacht von Tobliac gewinnen würde. Als seine Truppen bereits dem Wanken nahe waren, flehte er den Gott Chlodhildes um Hilfe an und gewann die Schlacht. Der heilige Remigius taufte ihn. Nach der Legende, die der berühmte Hinkmar, der Erzbischof von Reims, aufgezeichnet hat, fanden Chlodwig und der Bischof, als sie zur Taufkapelle kamen, so viele Menschen vor, dass der Priester mit dem heiligen Tauföl nicht zum Taufbecken gelangen konnte. Da sah man eine Taube erscheinen, die vom Himmel herab ein Fläschchen Tauföl brachte.
Ein anderes Beispiel der Erscheinung dieses Vogels als Sinnbild des Heiligen Geistes finden wir in dem Bericht der ersten Reise des spanischen Abenteurers Hernando Cortez nach Amerika. Nahrung und Wasser wurden knapp, und eine Meuterei stand bevor, als am Karfreitag bei Sonnenuntergang „eine Taube zum Schiff geflogen kam und sich auf den höchsten Mast des Schiffes setzte, worauf alle getröstet wurden und es als Wunder und gutes Vorzeichen betrachteten. Sie dankten Gott aus ganzem Herzen und lenkten ihre Fahrt nun in die Richtung, in die die Taube flog.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Mohammed etwas von diesen Quellen der göttlichen Eingebung gehört hat; dennoch berichtet Priteaux in seinem Leben des Propheten, Mohammed habe eine Taube angelernt, ihm Futter aus seinem Ohr zu picken, womit er andeuten wollte, dass der Heilige Geist in dieser Form zu ihm gekommen sei und ihm die Beschlüsse Gottes mitgeteilt habe. Dieser Vorfall ist vielleicht der Grund für Shakespeares Wort in seinem Heinrich V.: „Empfing Mohammed eine Eingabe durch eine Taube?“ Der Islam aber bewahrt noch heute seine alte Verehrung für diesen Vogel, und große Scharen von Tauben flattern um die Moscheen.
Schon im 5. Jahrhundert findet man eine Taube, die sich bei der Verkündigung auf die heilige Jungfrau herablässt, und seitdem erscheint die Taube auf den Bildern der Muttergottes mit dem Kind, aber auch auf den Bildern von der Erschaffung der Welt, wo „der Geist Gottes über den Wassern schwebte“. Flammen gehen von der Taube aus, wenn sie bei der Verleihung der Sprachgabe dargestellt wird. Ein Glasgemälde im Lincoln-College stellt diese volkstümliche Auffassung in einzigartiger Weise dar. Auf dem Fenster erscheint der Prophet Elisäus mit einer zweiköpfigen Taube auf der Schulter, offenbar eine Anspielung auf seine Bitte an Elias (4. Könige 11,9): „Ich bitte dich darum, dass in mir ein doppelter Geist sei.“ Die Taube ist auch das besondere Sinnbild des heiligen Gregor; auf seiner herrlichen Statue in Rom ruht eine Taube auf seiner Schulter.
Den unmittelbaren Anlass dafür, dass die Taube als Symbol nicht nur des Heiligen Geistes, sondern auch der Taufe verwendet wird, bildet der Bericht des Evangeliums von der Taufe Christi. Auf frühen Darstellungen der Kirchenkunst sehen wir den Vogel, wie er Ströme lebenden Wassers zu einem Kreuz werden lässt. Das berühmte Bild im Lateran enthält die gleiche Darstellung. Bei Prudentius erfahren wir, dass die Taube ein Symbol unseres Herrn war, und Tertullian bezeichnet die Kirche als den „göttlichen Taubenschlag“. Eine goldene Taube diente früher zur Aufbewahrung des Allerheiligsten Sakramentes und schwebte an einer Kette über dem Altar. Auf dem Konzil von Nizäa wurde ein Häretiker angeklagt, Tauben aus kostbarem Metall über den Altären und Taufbecken gestohlen zu haben. In der Kirche St. Nazarius in Mailand ist noch eine solche Taube erhalten.
Dass die Tauben auch ein Symbol der Reinheit waren, ergibt sich aus der Tatsache, dass sie von der allerheiligsten Jungfrau bei der Reinigung im Tempel geopfert wurden. So groß war der Handel mit Tauben geworden, dass Christus die „Taubenverkäufer“ aus dem Innern des Tempels vertrieb.
Die Taube erscheint auch auf Grabmälern als ein Symbol der christlichen Auffassung des Todes. Noch heute werden Tauben auf Grabsteinen dargestellt. N den katalanischen Dörfern der Ostpyrenäen wird alljährlich ein Mysterienspiel vom Leben und Martertod der heiligen Eulalie aus Barcelona aufgeführt, bei dem die Seele des gemarterten Mädchens in Form einer Taube zum Himmel aufschwebt.
Allgemein wird auch der Friede durch eine Taube dargestellt, die einen Ölzweig im Schnabel hält. Der Ölzweig selbst ist allerdings rein zufällig gewählt, denn in alten Zeiten diente ein Zweig irgendeines Baumes als „weiße Fahne“ zwischen kämpfenden Parteien oder bezeichnete freundliche Absichten, wo immer sich fremde trafen. Der Bericht von der Sintflut allerdings gab den Anlass zur Annahme, dass der Ölzweig der richtige Zweig für diesen Gebrauch sei. So ist die Taube zum „Friedensvogel“ geworden. Vom Standpunkt der Vogelkunde aus ist das allerdings kaum eine glückliche Wahl, da bekanntermaßen wenige Vögel so viel streiten wie die Tauben.
Ein merkwürdiger Zufall ereignete sich im Jahr 1921 in Brownsville in Texas, wo am Morgen des 11. November eine schneeweiße Taube in die Herz-Jesu-Kirche flog, sich auf ein Glasfenster mit einem Erinnerungsgemälde niederließ und dort während des ganzen Waffenstillstandsgottesdienstes verblieb. Dies wurde allgemein als ein Zeichen des Friedens angesehen. Es ist bezeichnend, dass stets die weiße Taube die symbolische Taube ist, nicht die graue Ringeltaube.
________________________________________________________________________

Armand Jean le Bouthillier de Rancé,
erster Abt der Trappisten

Begräbnis des sel. Reformators Abbé de Rancé

Die Trappistenabtei Oelenberg

Abtei-Ordenstracht
10. Trappisten
Abt Rancé und seine Bedeutung zu den reformierten Zisterziensern, welche bekannt sind unter dem Namen „Trappisten“
Eine Erinnerung an den zweihundertsten Todestag des Abtes Armand Jean Le Bouthillier de Rancé
Von P. Gabriel Meier, O.S.B.
Aus „Benziger’s Marien-Kalender“, 1900
Verlagsanstalt Benziger & Co. A.G. in Einsiedeln, Schweiz, Waldshut, Baden, und Köln am Rhein
Wer weiß, wo La Trappe liegt? In der Normandie, in der Diöcese Seez, nördlich und in der Nähe von Mortagne liegt ein einsames Tal, das von Gebüsch umgeben und von mehreren Bächen durchrieselt wird. Dieses Tal gehörte im 12. Jahrhundert dem Grafen von Rotrou, der sich in Palästina an der Seite Gottfrieds von Bouillon als tapferer Krieger ausgezeichnet hatte. Auf der Heimkehr befiel ihn in den Gewässern des Kanals La Manche ein schrecklicher Sturm und er war nahe daran, unterzugehen. In dieser gefährlichen Stunde versprach er durch ein Gelübde, wofern er mit dem Leben davon komme, eine Kirche zu Ehren der hl. Jungfrau Maria zu bauen. Er entkam glücklich und säumte nicht, sein Versprechen zu lösen. In der Nähe seiner Herrschaft wählte er das Tal von La Trappe, wo er zuerst die Kirche baute, dann das Kloster, welches den Namen zu Unserer Lieben Frau von La Trappe erhielt, den es noch heute trägt. Die ersten Mönche kamen dorthin aus dem Benediktiner-Kloster Savigny im Jahr 1140. Schon im Jahr 1148 führte Abt Serlon, ein Freund des heiligen Bernhard von Clairvaux, die Gebräuche der Cisterzienser ein und von da an bis heute hat La Trappe ohne Unterbrechung dem Orden von Cisterz angehört. Es war lange Zeit wegen der Frömmigkeit seiner Äbte und Mönche berühmt.
Freilich kamen herbe Schicksale über das Gotteshaus. Der stärkste Schlag traf es wohl im Jahr 1516, als durch das Konkordat zwischen Papst Leo X. und König Franz I. von Frankreich die Könige das Recht erhielten, sämtliche Äbte und Äbtissinnen der französischen Klöster zu ernennen, mit einziger Ausnahme von vier Klöstern. Das sind die Kommendatar-Äbte, Weltgeistliche oder selbst Laien, Beamte oder Militärs, die die Einkünfte des Klosters bezogen, sonst aber sich darum nicht kümmerten, vielleicht es gar nie zu Gesicht bekamen. So zerfiel nicht nur die Ordenszucht, auch die Gebäude, und es ist nur zu verwundern, dass die Klöster nicht ganz zu Grunde gingen.
Um das Jahr 1660 herrschten in La Trappe traurige Zustände. Die Tore des Klosters standen Tag und Nacht offen, so dass Frauen wie Männern freier Zutritt gewährt war. Wenn es regnete, drang das Wasser durch das beschädigte Dach in alle Gemächer ein. Die Sprechzimmer wurden als Ställe benutzt; der Speisesaal diente als Spiel- und Unterhaltungsplatz für Mönche wie Weltleute. Der Schlafsaal war Regen und Schnee, Wind und Wetter ausgesetzt. Die Kirche war mit Spinnengewebe und Schmutz angefüllt. Auf dem Hochaltar boten zwei Statuen des hl. Bernhard und der Mutter Gottes einen abstoßenden Anblick. Die Mauern und der Turm drohten einzustürzen. Der Verwalter des Kommendatarabtes hatte mit Frau und Kind die besten Zimmer des Klosters besetzt.
Der sittliche Zustand des Klosters entsprach dem materiellen nur zu sehr. Der Prior, der die Leitung führen sollte, besaß nicht das Ansehen und oft auch nicht den Willen, um ein geordnetes Klosterleben durchzuführen. So lebten die wenigen Mönche in Zuchtlosigkeit dahin, gingen aus, wann sie wollten, aßen und tranken, wann, was und wieviel sie wollten. Sie begaben sich statt zum Chorgebet auf die Jagd. Kurz, sie hatten vom Mönch nur den Namen, nicht einmal immer das Kleid.
Ungeheuerlich sind solche Zustände, aber nicht unerhört. Als der heilige Benedikt als Ordensstifter auftrat, wollten ihn seine verkommenen Mitbrüder vergiften. Als der hl. Robert aus seinem Kloster mit 21 gleichgesinnten Mönchen auszog, um in der Einöde von Cisterz die Regel des hl. Benedikt auf ihre ursprüngliche Strenge zurückzuführen, mochten in dem verlassenen Kloster wohl ebenso arge Missbräuche geherrscht haben. In die Fußstapfen eben dieser Männer tritt nun Abt Rancé mit seiner Reform.
Armand Johann le Bouthillier de Rancé war geboren zu Paris den 9. Januar 1626 als der jüngere Sohn des Staatsrats Dionysius le Bouthillier de Rancé, Freiherrn von Veret, Sekretär der Königin Maria von Medici, Gemahlin Heinrichs IV. Armand Johann wurde sorgfältig erzogen und zum Malteserritter bestimmt. Als aber sein älterer geistlicher Bruder starb, suchte der Vater dem jüngeren die bedeutenden geistlichen Pfründen des älteren zu sichern und so musste dieser ebenfalls Geistlicher werden, obschon er erst 11 Jahre alt war. Er wurde denn auch sofort Chorherr der Kirche von Paris, und Abt von vier Klöstern, das heißt, er bezog die Einkünfte, über 15000 Livres, dieser Würden, tat aber gar nichts dafür. Eine solche Anhäufung von Ämtern, zudem auf einem Kind, war stets dem Geist und auch dem Gesetz der Kirche zuwider; sie musste aber den Zeitumständen nachgeben und sich ins Unvermeidliche schicken.
Von der Natur mit glücklichen Anlagen ausgestattet, machte Rancé in den Wissenschaften erstaunliche Fortschritte. Mit 12 Jahren besorgte er eine neue Ausgabe der griechischen Gedichte Anakreons, übersetzte sie ins Französische und widmete sie mit einer schmeichelhaften Vorrede seinem Taufpaten, dem mächtigen Kardinal und Minister Richelieu. Später verlegte er sich mit Eifer auf das Studium der Theologie, wurde 1651 Priester und bald darauf Doktor der Theologie. Er hatte Aussicht als Weihbischof seinem Onkel dem Erzbischof von Tours zur Seite zu treten, und später nachzufolgen. Sein Leben entsprach aber einem solchen Stand keineswegs. Er liebte die Welt und wurde von ihr wieder geliebt. Alles was sie Reizendes bietet, nahm sein Herz wechselweise ein. Er umgab sich mit lockeren Freunden und hatte auch Zutritt zum leichtfertigen königlichen Hof. Tanzen, Reiten, Fechten trieb er mit Vorliebe und war ein unüberwindlicher Jäger, der selbst die kräftigsten Pferde bändigte. Es gab keine Torheit, die ihm nicht in den Sinn kam.
Gott aber bediente sich ganz besonderer Mittel, um diese Seele zu retten. Es starb nämlich sein Oheim, auf den er seine ehrgeizigen Hoffnungen gesetzt hatte. Dann wurde er wie durch ein Wunder aus einer Lebensgefahr gerettet, so dass er in die Worte ausbrach: „Ach, wo wäre ich jetzt, wenn sich Gott meiner nicht erbarmt hätte.“ Doch dauerte dieser heilsame Eindruck nicht lange. Nachhaltiger erschütterte ihn der Tod der Herzogin von Montbazon, die als die erste Schönheit in Paris galt und sich in Vergnügungen und Zerstreuungen erschöpfte. Ihr Haus war der Sammelplatz aller Schöngeister von Paris, wo man die glänzendsten Unterhaltungen, die leichtfertigsten Spiele trieb und stets auf neue Vergnügungen sann. Abbé de Rancé nahm an allem frohen Anteil, wenn er auch die Schranken des Anstandes nicht überschritt. Diese Dame wurde plötzlich von einem bösartigen Fieber ergriffen. Abbé de Rancé berief den Pfarrer, der ihr die hl. Sterbesakramente reichte, worauf sie nach einer Stunde verschied. Der Gedanke an diesen so plötzlichen und erschütternden Tod, der die Herzogin aus ihrem leichtfertigen Leben hinweggerafft hatte, durchschnitt Rancés Seele, wenn er auch damit noch nicht bekehrt war. Sieben Jahre geistiger Kämpfe und Leiden brauchte es, bis er zu dem Entschluss kam, in das Kloster La Trappe einzutreten.
Auf das Anraten mehrerer Bischöfe verzichtete Rancé auf seine Pfründen und verkaufte seine großen Besitztümer. Er fand sich mit seinen Geschwistern ab und schenkte vieles den Armen und den Spitälern. Nur eine mäßige Summe behielt er, um die zerfallenen Gebäude von La Trappe herzustellen. Schwieriger war es, in das zerfallene Kloster Ordnung zu bringen. Die Mönche widersetzten sich einer strengeren Zucht und überhäuften den Abt mit den gröbsten Beschimpfungen und sogar mit Drohungen. Er jedoch blieb unbeugsam und erklärte mit allem Nachdruck, dass er ihr ärgerliches Leben nicht länger dulden wolle und falls sie länger darin verharrten, würde er sie beim König verklagen. Diese Drohung wirkte mehr als der Hinweis auf das Strafgericht Gottes. Sie schlossen ein Übereinkommen, dass ihnen eine jährliche Pension von 400 Franken zusicherte und die Erlaubnis, im Kloster zu bleiben oder anderwärts ihren Aufenthalt zu suchen. Dieser Vergleich wurde vom französischen Parlament 1663 genehmigt.
La Trappe wurde nun Zisterziensern der strengen Observanz überwiesen, sechs Priestern aus der Abtei Perseigne. Am Fest des hl. Ordensstifters Bernhard wurde wieder feierlicher Gottesdienst und das gemeinsame Chorgebet um Mitternacht abgehalten, was seit 200 Jahren nicht mehr geschehen war. Rancé selbst wohnte zur Tag- und Nachtzeit dem Chorgebet bei, beteiligte sich an der harten Arbeit der Mönche und Beobachtete auch die Enthaltung von Fleischspeisen. Er gedachte als Kommendatar-Abt im Kloster zu wohnen und ließ die Wohnung des Abtes für sich herrichten. Als er aber davon Einsicht nehmen wollte, stürzte die Decke des morschen Zimmers ein und hätte ihn beinahe erschlagen. Er sah darin einen Wink der Vorsehung, dass sein Ort nicht hier sondern in der Zelle eines Mönches sei. Er ging deshalb als Novize in die Abtei Perseigne, wo er 37jährig am 13. Juni zugleich mit seinem Kammerdiener das Ordenskleid erhielt. Am 26. Juni 1664 legte er die Ordensgelübde ab und am 13. Juli erhielt er die Abtsweihe. Am nächsten Tag begab er sich nach La Trappe, dessen wirklicher Abt er jetzt geworden war.
Sein Ziel war von jetzt an, die Regel des hl. Benedikt, die die Grundlage für den Zisterzienser-Orden bildet, in ihrer ursprünglichen Strenge durchzuführen, was er aber nur nach und nach und im Einverständnis mit seinen Untergebenen durchsetzte. Er selbst leuchtete ihnen als lebendige Regel vor. Bei den allergeringsten und strengsten Handarbeiten beobachtete er strenges Fasten. Er war beim Gebet und im Gottesdienst stets der erste und zog sich vom Verkehr mit Weltleuten möglichst zurück. Er verlangte, dass alle seine Mönche sich mit Handarbeiten beschäftigen und keine Gelehrte sein sollten, um keine Versuchung zur Hoffart zu geben. Es entspann sich darüber ein Federkrieg mit den gelehrten Benediktinern von der Kongregation der Mauriner, als deren Hauptvertreter der berühmte Mabillon mit Begeisterung für die Pflege der Wissenschaft in den Klöstern in die Schranken trat. Der Abt Rancé mag insofern wegen dieses seines Vorgehens in etwa zu entschuldigen sein, weil er die Regel des hl. Benedikt in ihrer ganzen Strenge durchgeführt wissen wollte, der hl. Benedikt aber in seiner heiligen Regel als Hauptaufgabe der Mönche Chorgebet und Handarbeit hinstellt. In gegenwärtiger Zeit werden auf ausdrücklichen Wunsch des heiligen Vaters auch bei den Trappisten die Studien eifrig betrieben. Besonders begabte Mönche werden nach Rom an die gregorianische Universität geschickt, um dort höheren theologischen Studien obzuliegen.
Eine andere Anklage richtete sich gegen die übertrieben strenge Lebensweise in La Trappe. Man tadelte heftig, wie dies noch heute von gewisser Seite geschieht, das strenge Fasten, das beständige Stillschweigen und andere Abtötungen. Da in kurzer Zeit mehrere Todesfälle vorgekommen waren, schimpfte man La Trappe das Grab und Rancé den Scharfrichter der Mönche. Er selbst wurde von einem bösartigen Fieber ergriffen und da er seinen Tod befürchtete, wandte er sich an Papst Innocenz XI., der durch ein huldvolles Breve vom 23. Mai 1678 ihn seines Schutzes versicherte und die von ihm entworfenen Konstitutionen genehmigte. Ein besonderer Gönner Rancés war auch König Jakob von England, der von seinem Thron vertrieben als Verbannter in Frankreich lebte. Er kam öfter nach La Trappe, nahm an den frommen Übungen der Mönche teil, empfahl sich ihren frommen Gebeten und bat kniend um den Segen des Abtes.
Bis ans Ende hielt Rancé mit nie erkaltendem Eifer fest an der strengsten Beobachtung der bestehenden Ordnung, ohne sich durch eine Einrede darin beirren zu lassen. Eine drückende Last war ihm die Leitung des Klosters, so dass er sagte: „Ich möchte lieber der Küchenjunge als der Abt von La Trappe sein.“ Körperliche Gebrechen nötigten ihn zuletzt im Jahr 1696 zur Niederlegung seines Amtes. Er lebte noch vier weitere Jahre. Als er sein Ende herannahen fühlte, ließ er sich Asche auf sein Strohlager streuen, um als Büßer zu sterben, wie er gelebt hatte. Er starb am 27. Oktober 1700 im Alter von 75 Jahren, von denen er 37 in fast übermenschlicher Bußstrenge im Kloster zugebracht hatte. Vom Kloster „La Trappe“ ging kein neuer Orden aus; es ist der reformierte Zisterzienserorden, aufgebaut auf die Regel des hl. Benediktus. Das Vorbild von La Trappe regte die Nacheiferung an; andere Klöster befolgten das gegebene Beispiel und der Volksmund nannte sie Trappisten, - sie sind aber wahre Zisterzienser. Auch Klöster für Trappistinnen entstanden noch zu Lebzeiten Rancés.
Die Ordenstracht besteht aus einem weißwollenen Habit, darüber ein langes schwarzes Skapulier mit einer großen Kapuze; beides wird durch einen Ledergürtel zusammengehalten. Dies bildet besonders die Kleidung für die Arbeit, wobei man auch Holzschuhe gebraucht. Außer der Arbeitszeit tragen die Mönche noch über dem Habit ein langes, weites weißwollenes Kleid mit weiten Ärmeln und Kapuze, Kulle genannt, in der sie immer im Chor erscheinen.
Der Abt trägt außerdem ein Brustkreuz von Holz, den Abtsring und bedient sich bei festlichen Gelegenheiten der Pontifikalien (Stab, Mitra etc.). Die Kleidung der Laienbrüder ist von brauner Farbe, anstatt der Kulle tragen sie einen weiten Mantel mit großer Kapuze; ihnen liegt es ob, insbesondere die Arbeiten in den Werkstätten und auf dem Feld zu besorgen. – Die Nahrung ist höchst einfach: Hülsenfrüchte, Reis, Gemüse, Kartoffeln, Obst, Käse, Milch und Bier. Für die Zubereitung darf etwas Öl oder Butter verwendet werden. Die Abstinenz von Fleisch-, Fisch- und Eierspeisen wird, mit Ausnahme der Krankenkost, aufs strengste beobachtet.
Die französische Revolution störte auch die Trappisten in ihrer stillen Tätigkeit und trieb sie im Jahr 1790 in die Welt hinaus. Ruhelos mussten sie von Land zu Land wandern. 1815 kehrten die Trappisten mit Erlaubnis Napoleons nach Frankreich zurück und erwarben wieder La Trappe. Aus den Ruinen erhob sich neues Leben. Der Sturm der Verfolgung hatte nur dazu gedient, den Samen der Reform überallhin zu tragen.
Es entstanden Trappistenklöster in Ländern, wo man früher nie ihren Namen gehört hatte.
So in Deutschland, wozu jetzt das Kloster Oelenberg im Elsass, zwei Stunden westlich von Mühlhausen gehört. Es wurde im Jahr 1825 von Darfeld (Westfalen) aus unter großen Schwierigkeiten gegründet und zählt jetzt über 160 Ordensleute. Von hier aus wurde auch das Frauenkloster Maria von Altbronn bei Ergersheim (Elsass) gestiftet, ebenso das Kloster Maria-Wald in der Eifel und Maria-Veen in Westfalen. Die Mönche dieses Klosters sind zugleich betraut mit der Leitung der gleichnamigen Arbeiter-Kolonie. Von Maria-Wald ging die Gründung des so segensreich wirkenden Klosters Maria-Stern in Bosnien aus.
Heute sind die Schüler des Abtes de Rancé über die ganze Welt verbreitet. Ein besonders fruchtbares Arbeitsfeld tat sich ihnen in Afrika auf. Dort lehren sie die Einwohnerschaft beten und arbeiten; Ordensschwestern unterrichten die einheimischen Mädchen.
Immer aber und überall bleiben die reformierten Zisterzienser ihrer alten strengen Regel treu. In Folge der Zerstreuung am Ende des neunzehnten Jahrhunderts hatten sich drei verschiedene Kongregationen gebildet, jede mit einem eigenen Obern an der Spitze. Papst Leo XIII. berief im Jahr 1892 Abgeordnete sämtlicher Klöster zu einem Generalkapitel nach Rom, wo sie sich am 11. Oktober wieder vereinigten. Als gemeinsamen Obern wählten sie auf Lebenszeit den P. Sebastian Wyart, Doktor der Theologie und ehemaliger Offizier in der päpstlichen Armee. Gelegentlich dieses Generalkapitels zu Rom bestimmte der hl. Vater selbst den Namen des Ordens also: „Orden der reformierten Zisterzienser Unserer Lieben Frau von La Trappe“: Den Zusatz von „La Trappe“ wollte der hl. Vater ausdrücklich beibehalten wissen, damit das Bewusstsein der Abtötung und Bußstrenge, das der Name verkörpert, bei der Menschheit wachgehalten werde. Das Generalkapitel, in dessen Hand die höchste Gewalt des Ordens liegt, versammelte sich alljährlich abwechselnd in den verschiedenen Klöstern; alle 5 Jahre wird es in Rom abgehalten.
Heute (1900) zählt dieser Orden in 58 Niederlassungen 3472 Mönche; dazu kommen 17 Frauenklöster mit 1246 Trappistinnen.
________________________________________________________________________

11. Totenbretter
Von P. Gehrlein und P. Dittrich SVD,
aus „Wochenpost“, Missionsdruckerei Steyl,
6. Jahrgang, Nr. 5
Der Brauch der Totenbretter gehört zu den eigenartigsten und seltsamsten aller deutschen Volksbräuche. Er findet sich heute nur beim Volksstamm der eigentlichen Bayern, und auch hier nur noch an vereinzelten Stellen. Die moderne Zeit drängt ihn immer mehr in die abgelegeneren Teile Ober- und Niederbayerns sowie der Oberpfalz zurück. So lebt er heute eigentlich nur noch bei den „Wäldlern“, d.h. bei den Bewohnern des Bayerischen Waldes und des Böhmerwaldes, wo die einfachste und darum wohl auch ursprünglichere Art in der nördlichen Oberpfalz in Brauch ist. Hier trifft der Wanderer häufig an Dorfrändern und bei einsamen Höfen, an Wegkreuzungen und „Marterln“ ein bis zwei Meter lange und ungefähr dreißig Zentimeter breite Bretter, allein oder in größerer Anzahl, die ähnlich wie Friedhofskreuze Namen und Lebensdaten eines Verstorbenen tragen. Das sind Totenbretter, hier auch „Leichbretter“ genannt. Ihr Name erklärt sich aus ihrer Herkunft und Verwendung.
Der Todesengel ist in ein Haus gekommen. Er nahm ein warmes Leben mit und ließ den kalten Leichnam zurück. Da geht jemand von den Anverwandten alsbald zum Schreiner und besorgt ein Brett, das ungefähr der Körpergröße des Verstorbenen entspricht. Dann wird der Tote aus dem Bett gehoben und auf diesem Brett zwischen zwei Stühlen aufgebahrt, bis der bestellte Sarg eintrifft. Mancherorts legt man auch das Totenbrett – auch mehrere Bretter – über die beiden Bettenden, so dass die Leiche hoch über dem Bett ruht. Anderswo herrscht die Sitte, das Brett ins Bett unter den Toten zu legen. Ist der Sarg angekommen und der Tote umgebettet, hebt man das Bett bis nach der Beerdigung auf. Dann wird es vom Schreiner gehobelt, mit der genannten Beschriftung versehen (oft mit Sprüchen, Bemalung, drei Kreuzen u.a.) und an den meist durch die Gewohnheit bestimmten Platz für Totenbretter gebracht.
Sinn und Zweck der Totenbretter lässt sich aus ihrer Aufschrift leicht herauslesen. Sie sollen ein schlichtes Denkmal für den Verstorbenen sein. Das sagen Formeln wie: „Zur frommen Erinnerung …“ oder „Wer hier vor meinem Denkmal steht …“ Zugleich aber bilden sie ein Mahnmal für die Lebenden, für die Arme Seele zu beten, aber auch des eigenen Seelenheils und Todes eingedenk zu sein. Dieser Doppelzweck kommt in den volkstümlichen Totenbrettsprüchen zum Ausdruck, wie z. B.
„Wie ist das Scheiden doch so schwer,
Wie wird das Haus so öd und leer,
Wie weint sich Herz und Mund so wund
Bei einer Mutter Sterbestund.“
Oder:
„Du liebes Sohn- und Bruderherz
hast aufgehört zu schlagen,
Ach, leider allzu früh hat man
dich schon begraben.
Ein Trost nur bleibt in Schmerz und Wehn:
Dort oben gibt’s ein Wiedersehn.“
Damit die Totenbretter ihren Zweck, Denkmal und Mahnmal zu sein, erfüllen können, werden sie an Stellen angebracht, die augenfällig, häufig begangen und doch wieder abgesondert und stimmungsvoll sind.
So finden wir sie am Wegrand stiller Kirchgangpfade, im Schatten gewaltiger Linden, an Kapellenwänden, unterm Schutz alter „Marterln“, beim Feldkreuz neben dem Vogelbeerbaum, am Ufer des Baches und am Waldrand. Bald hängen sie senkrecht an Baumstämmen oder stehen aufrecht als Fuß von Bildstöcken, bald sind sie quer an Wänden und Zäunen festgemacht oder ruhen waagerecht einfach auf vier Pflöcken am Boden. Immer mahnen sie den Wanderer, des Toten und des Todes zu gedenken, und bilden so Stätten stiller Gedanken und religiöser Stimmung. Damit soll aber nicht verschwiegen sein, dass sie manchmal zum Lieblingsmotiv von Geistergeschichten und Totenmärchen, besonders für die Kinder, aber in sogenannten unheimlichen Zeiten selbst für die Erwachsenen zu Orten des Gruselns und des Grauens werden.
Die geschichtliche Frage nach der Herkunft des Brauches ist wohl noch nicht ganz geklärt. Tatsache ist, dass die Totenbretter schon im ältesten Gesetzbuch der Bayern (7. und 8. Jahrhundert) erwähnt werden. In jener Zeit wurde, da es noch keine Särge gab, dem Toten das Brett, auf dem er geruht hatte, mit ins Grab gegeben. Man legte es über den Toten, bevor das Grab zugeschaufelt wurde. Eine andere Gewohnheit war lange Zeit folgende: Die Leiche wurde auf dem Totenbrett zum Gottesacker getragen. Dort band man sie vom Brett los und ließ sie darauf – die Füße voran – langsam ins Grab hinuntergleiten. Als dann der Sarg zur Einführung kam, war das Totenbrett für diesen Zweck nicht mehr nötig. So erhielt es seine neue Bestimmung. Zeit und Ort der ersten Verwendung in dieser Weise lassen sich wohl kaum ermitteln. Der Brauch soll übrigens früher auch in Salzburg, Tirol, Ostfranken, Schwaben (Schwarzwald), ja sogar in höher gelegenen Teilen Frankreichs in Übung gewesen sein.
Auf jeden Fall bildet das Toten- oder Leichenbrett einen altehrwürdigen, wertvollen Volksbrauch. Es gibt eindringlich Zeugnis vom christlichen Jenseitsglauben und predigt nachdrücklich die Überzeugung von der Wirkkraft des frommen Bittgebetes für die Armen Seelen. Es ist ein Denkmal für die Toten und ein Mahnmal für die Lebenden.
„O Wanderer, steh still und lese!
Was du jetzt bist, bin ich gewesen,
Was ich jetzt bin, wirst du einst werden:
Wir alle sind nur Staub auf Erden,
Benütze reichlich deine Zeit,
Wirk Gutes für die Ewigkeit!“
________________________________________________________________________

12. Templerorden
Der Untergang des Templerordens
Siebenhundert Jahre sind verflossen, seit in Frankreich Ereignisse sich zutrugen, die als schwarzer Fleck auf der Geschichte dieses Landes haften. Es ist die unter unsäglichen Gräueln durchgeführte Vernichtung des Templerordens. Der Orden gehörte zu jenen geistlichen Rittergesellschaften, die ihre Entstehung den Kreuzzügen verdankten. Gestiftet in Jerusalem zu Anfang des Jahres 1120, diente der Orden der Templer dem Schutz der Pilger, die zum heiligen Grab gingen. Wer in den Orden eintrat, hatte die Mönchsgelübde abzulegen. Die erste Wohnung der Ritter war ein Palast, der sogenannte Salomonische Tempel, danach führte der Orden seinen Namen. Gekleidet gingen die Templer in weiße Gewänder mit rotem Kreuz. Die Oberleitung hatte ein Großmeister, neben dem eine Reihe von Großwürdenträgern waltete. Zu den Templern gehörten sehr viele vornehme Ritter aus allen Landen, die auf ihre erlauchten Familien und auf die von dem Orden ausgeübten Heldentaten ungemein stolz waren. Leider führte diese Vernachlässigung der ihnen geziemenden Demut bald zu Unzuträglichkeiten, Zwistigkeiten entbrannten, vor allem mit den Johannitern. Als trotz aller unter so endlosen Opfern gemachten Bemühungen das Heilige Land den Christen verloren ging, suchte der Templerorden sich von neuem eine Stellung zu schaffen, und zwar auf der Insel Zypern.
Das hohe Ansehen des Templerordens hatte alsbald seit seiner Gründung dazu geführt, ihm außerordentliche Reichtümer zu verschaffen. Das jährliche Einkommen des Ordens belief sich gegen Ende des 13. Jahrhunderts auf über 50 Millionen Francs. Im Ganzen gehörten ihm 9000 Ordenshäuser, von denen sich in Frankreich allein über 1000 befanden. Daselbst war auch eines der großen Schatzdepots des Ordens. Es befand sich in dem sogenannten Temple zu Paris und diente dazu, den Templern die Stellung von Bankiers der französischen Könige zu sichern.
Der Reichtum sollte dem Orden zum Verderben werden. Zu jenen, die bei ihm am tiefsten in Schulden steckten, gehörte der französische König Philipp der Schöne, der 1325 als 17jähriger Jüngling zum Thron gekommen war und wegen seines Streites mit Papst Bonifatius VIII. besonders bekannt geworden ist. Philipp, der sich immer in Geldverlegenheit befand, hatte schon durch Ausplünderung der Juden und durch ausgiebigste Falschmünzerei bewiesen, dass ihm zur Befriedigung seiner Habgier jegliches Mittel recht sei. Im Jahr 1304 war er wieder einmal so weit, dass er bei den Templern Geld borgen musste. Er tat es, indem er ihnen reichliche neue Privilegien verlieh, wobei er gleichzeitig ihre Frömmigkeit, Mildtätigkeit samt allen möglichen anderen Tugenden nicht laut genug zu rühmen wusste. In seinem Innern aber sah es anders aus. Er hatte beschlossen, sich in den Besitz der sämtlichen Schätze des Ordens zu setzen, den er bitterlich beneidete, und dessen Freiheit und Unabhängigkeit ihm unerträglich war. Noch dazu hasste er ihn nach Art kleinlicher Tyrannen, weil dem Orden einmal seine Schwäche kundgeworden war. Das war damals gewesen, als er bei einem Aufruhr in Paris bei den Ordensbrüdern vor der Wut des Volkes hatte Schutz suchen müssen. Auch dass die Templer dem Papst Bonifaz gegen ihn beigestanden hatten, vermochte er nicht zu überwinden. Von solchen Gesinnungen erfüllt, trachtete er danach, den Templerorden überhaupt zu vernichten und suchte nach Vorwänden dazu.
Es war im Jahr 1305, als ein gewisser Squin de Florian, ein Bürger aus Beziers, auf den Tod angeklagt, im Gefängnis lag und daselbst mit einem unwürdigen Subjekt zusammenhauste, das ehemals dem Templerorden angehört hatte und wegen seiner Verbrechen von ihm ausgestoßen war. Dieser Mensch erging sich in seiner Rachsucht in den wildesten Reden über den Orden, den er der unglaublichsten Verbrechen bezichtigte. Squin beschloss nun sein Leben dadurch zu retten, dass er dem König, dessen Gesinnung gegen die Templer ihm bekannt war, die Anklagen des Zellengenossen hinterbrachte. Noch ein dritter, gleichfalls ein Ex-Templer, ein gewisser Roffodei aus Florenz, leistete Hilfe. Den lügenhaften Bericht des Squin nahm Philipp begierig und beifällig auf und hatte nun nichts Eiligeres zu tun, als sich an den Papst mit dem dringenden Verlangen zu wenden, dass sich die höchste Instanz der Sache alsbald annähme. Er erhielt auch die Zusicherung, dass eine Untersuchung angestellt werden solle. Darauf zu warten hatte aber der König keine Lust. Er beschloss, die Sache selber auf seine Weise in die Hand zu nehmen. In erster Linie musste er sich dazu der Person des Großmeisters versichern. Der aber war ein wackerer Ritter aus der Gegend von Besancon, des Namens Jakob von Molay. Ihm wurde mitgeteilt, dass König Philipp den innigen Wunsch habe, und den mit dem Papst Klemens V. teile, einen Kreuzzug zu unternehmen, zu dem Zweck sowohl Geld als eine persönliche Vereinbarung mit dem Haupt des militärisch so wichtigen Templerordens notwendig sei. Molay, nichts Böses ahnend, machte sich Anfang 1307 auf den Weg nach Paris, brachte auch seine Großoffiziere mit und gleichzeitig „150.000 Goldstücke und des Silbers so viel, als zehn Maultiere nur schleppen konnten“. Kaum war er eingetroffen und mit scheinbarer Freundlichkeit aufgenommen worden – wobei er alsbald um einen großen Teil des mitgebrachten Geldes erleichtert wurde – erneuerte Philipp sein Andrängen beim Papst wegen der Aufhebung des Ordens und der Untersuchung, die nicht den geringsten Aufschub mehr haben dürfe.
Völlig unerhört waren die Dinge, die dem Orden als Schuld zugeschoben wurden. Man behauptete, dass der geistliche Verband auf jede erdenkliche unrechte Art nach fortwährender Bereicherung strebe, dass seine Mitglieder gräulichsten unnatürlichsten Lastern ergeben seien, dass er Jesus, Maria und alle Heiligen verleugne, das Kreuz Christi beschimpfte usw. Als Molay merkte, dass Gefahr nahte, bat er selbst den Papst, die Untersuchung anzustellen, damit die unsinnigen Gerüchte zerstreut würden. Damit war aber dem König Philipp nicht gedient. Im September 1307 erließ er an sämtliche Statthalter der französischen Provinzen ein Schreiben, dem ein verschlossener Brief beigelegt war. Dieser durfte bei Todesstrafe nicht früher, noch später, als an einem bestimmten Tag im Oktober geöffnet werden. Er enthielt den Befehl, unmittelbar nach dem Lesen sämtliche Tempelritter zu verhaften. Das Schicksal traf natürlich auch Molay, der mit 140 Ordensrittern im Temple zu Paris eingesperrt wurde. 400 Jahre später sollte in demselben Kerker ein französischer König, Ludwig XVI., seiner Hinrichtung entgegensehen. Die Verhaftung der Templer erregte beim Volk das höchste Aufsehen, aber der König sorgte dafür, dass in allen Kirchen die furchtbaren Anklagen öffentlich verlesen wurden, und so fand man sich, wiewohl kopfschüttelnd, in dies unerhörte Ereignis. Jetzt bekamen alle Untersuchungsrichter Frankreichs zu tun. Unter den entsetzlichsten Foltern wurden den unglücklichen Gefangenen die Geständnisse abgepresst. Wer gestand, sollte ausgehen, wer es nicht tat, verfiel dem Feuertod als Ketzer. Sehr vielen blieb dies letzte erspart, weil sie schon unter den Händen der Folterknechte starben.
Dass das ganze Vorgehen widerrechtlich war, wusste Philipp sehr wohl, kümmerte sich aber nicht darum. Denn der Orden stand ja in Wirklichkeit keineswegs unter weltlicher, sondern unter geistlicher Gerichtsbarkeit, die in diesem Fall nur vom Papst selbst ausgeübt werden konnte. Klemens V. war ein weichmütiger Mann, aber die auf Befehl des Königs begangenen Gräuel brachten ihn trotzdem dazu, energischer einzuschreiten. Er legte Verwahrung gegen die Behandlung des Ordens ein und enthob den Großinquisitor Wilhelm von Paris seines Amtes, das er zugunsten des Königs missbraucht hatte. Philipp ließ sich dadurch nicht im mindesten beirren, wies des Papstes Einmischung in schroffster Weise ab und sammelte eifrigst weiter Belastungsmaterial gegen den verhassten Orden, das durch die schnöden Folterungen in Masse zusammengebracht wurde. Freilich, wo es Gerichte gab, die vom König unabhängig geblieben waren, wie in Metz, Toul und Verdun, da wurden auch keine Geständnisse erzielt. Ebenso wenig fand Philipp mit seinen Beschuldigungen in anderen Ländern den geringsten Glauben. Gewiss, dass nicht alles bei den Templern ohne Fehl und Tadel gewesen war, das wusste man, aber das betraf doch stets nur einzelne Fälle. Der Orden im Ganzen war rühmlich bekannt wegen seiner Tugend, Tapferkeit und Wohltätigkeit.
Vor dem Parlament zu Tours, im Mai 1308, führte Philipp das große Wort. Dort erklärte er, Moses habe seinerzeit auch nicht bei Aaron angefragt, ob er die Anbeter des goldenen Kalbes strafen dürfe, sondern habe sie auf eigene Hand töten lassen. Ebenso seien heutigen Tages die Templer des Todes schuldig. Einige Schwierigkeit machte dem König die um ihr Gutachten befragte Universität Paris. Sie erklärte, dass der Orden nicht unter weltlicher Gerichtsbarkeit stände, dass ein weltlicher Fürst überhaupt nicht in der Lage sei, über Ketzereien zu urteilen. Sein Recht gehe nur soweit, die Verdächtigen gefangen zu nehmen und sie dem Papst auszuliefern. Nun bestürmte Philipp den schwachen Klemens V. stärker denn je zuvor, berief sich auf die erdrückende Masse der vorliegenden Geständnisse und brachte trotz deren Wertlosigkeit Klemens wirklich die Überzeugung bei, dass sich alles so verhielte, wie er sprach. Der Großinquisitor wurde wiedereingesetzt. Das Urteil über den Großmeister und die obersten Würdenträger des Ordens wollte der Papst selbst sprechen, doch wusste Philipp das wohlweislich zu verhindern. Seine Angabe, dass die Angeklagten die Reise zum Papst nicht machen könnten, beruhte freilich auf trauriger Wahrheit, da jene durch die Foltern in den elendsten Zustand geraten waren. Hatte doch damals sogar Molay eine Zeit lang seine Standhaftigkeit verloren und bekannt, dass der Orden tatsächlich Christus verleugne.
Der Papst setzte hierauf eine Kommission ein, die am 7. August 1309 ihre erste Sitzung hielt. Für den 12. November lud sie alle diejenigen vor sich, die bereit wären, den Orden zu verteidigen. Dazu fanden aber nur wenige den Mut, und sie wurden auf des Königs Befehl alsbald verhaftet. Immerhin hatte eine Gegenbewegung eingesetzt. Im März 1310 fanden sich nicht weniger als 564 Personen, die den Orden verteidigen wollten. Aber da die Kommission in der Furcht vor dem König lebte, so erhielten jene Leute keine Anwälte. Mittlerweile wütete Philipp gegen den Orden weiter. Eine Gewalttat folgte der andern und der Hauptgehilfe des Königs war der von ihm selbst eingesetzte Erzbischof von Sens, ein Mann, dem Klemens V. nur infolge der Einschüchterungen durch Philipp seine Amtsbestätigung erteilt hatte. Eines der bekanntesten Ereignisse damals war das Verfahren gegen 54 Ritter, die mannhaft ihre ehemaligen Geständnisse als erzwungen widerriefen. Am 12. Mai wurden sie vor dem Tor Saint-Antoine zu Paris auf ihre Scheiterhaufen gestellt. Im Augenblick, ehe das Feuer entfacht wurde, verkündete ein Herold, dass sie alle frei sein sollten, wenn sie ihre letzte Aussage zurücknehmen würden. Weinend baten anwesende Verwandte die Ritter, dass sie die Rettung annehmen möchten. Sie aber blieben standhaft. Die päpstliche Kommission führte ihre erfolglose Tätigkeit noch eine ganze Zeit weiter, während der König mit seinen Kreaturen Provinzialkonzilien abhielt und die Brandurteile sich fortwährend mehrten. Am 1. Juni 1311 schloss die Kommission ihre letzte Sitzung. Im gleichen Jahr begann am 13. Oktober das allgemeine Konzil von Vienne, zu dessen wichtigsten Aufgaben außer der Besprechung anderer kirchlicher Fragen auch die des Prozesses gegen die Templer gehörte. Hier erklärten sich die anwesenden 300 Bischöfe bis auch 4 dafür, dass der Orden in öffentlichem und ordentlichem Gerichtsverfahren verhört werden müsse. Die Folge war, dass der König jede weitere Sitzung des Konzils bis in den April 1312 verhinderte. Er selbst erschien dort mit seinem ganzen Hofstaat und wiederholte von neuem das unbedingte Verlangen nach der Aufhebung des Ordens. Papst Klemens V. aber hoffte, dem Gräuel ein Ende dadurch bereiten zu können, dass er aus Friedensliebe dem König nachgab. In einem geheimen Konsistorium vom 22. März 1312 verfügte er, dass der Templerorden für immer aufgehoben sein solle. Die Güter des Ordens sollten an die Johanniter fallen. Der Großmeister und drei Ordenswürdenträger wurden zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt.
Als der Beschluss am 3. April 1312 veröffentlicht worden war, nahm Philipp unverzüglich die schon längst für ihn mit Beschlag belegten Schätze des Ordens weg. Die Güter musste er freilich den Johannitern geben, aber er rechnete ihnen dermaßen hohe Prozess- und Verwaltungskosten auf, dass sie darüber arm wurden.
Aber noch war Philipp nicht am Ziel seiner Wünsche, da der Großmeister und die drei Oberen lebten. An sie wurde das Verlangen gestellt, am 11. März 1313 des Königs Grausamkeiten öffentlich für gerecht und billig zu erklären. Vor einer ungeheuren Menschenmenge erschienen die vier Männer auf einem rot beschlagenen Gerüst, das bei der Notre Dame-Kirche aufgestellt war. Dort erklärte Molay unter ungeheurer Bewegung des Volkes, dass die sichere Aussicht auf seinen bevorstehenden Tod ihn nicht bewegen könne, noch einmal von der Wahrheit abzuweichen, da der Templerorden völlig unschuldig gelitten habe und vernichtet sei. Noch am gleichen Abend wurde Molay mit den anderen nach der Seine-Insel gebracht, wo sie in höchster Standhaftigkeit den Feuertod erlitten.
Damit endeten die letzten von den vielen tausend Mitgliedern des Templerordens, der 200 Jahre lang so ruhmreich geblüht hatte.
________________________________________________________________________

13. Todeszeitpunkt der Gottesmutter
Kann man den Zeitpunkt des Todes der Muttergottes ermitteln?
(Von: Abbé Jean Remois, "Ecclesia", Paris 1952)
Das Dogma der Aufnahme Mariens in den Himmel ist keine abstrakte Wahrheit, zu der man auf dem Weg des logischen Schlusses gekommen ist wie bei anderen dogmatischen Wahrheiten, z.B. der Unbefleckten Empfängnis. Sie ist vielmehr eine historische Tatsache, die sich feststellen lässt und auch wirklich festgestellt wurde.
Kann man sich nun vorstellen, dass die Muttergottes diese Erde verließ, ohne den hl. Johannes, ihren Adoptivsohn und dem Fleisch nach ihren Neffen, davon zu benachrichtigen? Ohne sich von ihrer Verwandtschaft in Jerusalem und den dortigen Christen zu verabschieden? Ohne die Apostel noch einmal zu sehen, deren geistige Mutter, Stütze und Förderin sie war? Nein, man kann sich einfach nicht vorstellen, dass sie plötzlich aus ihrer irdischen Wohnung verschwand, ohne etwas davon zu sagen, und einfach ihre Kleider auf ihrem Lager zurückließ.
Kann man, von dieser Voraussetzung ausgehend, den Tod und die Aufnahme der Muttergottes in den Himmel zeitlich festlegen? Diese Frage zu beantworten, scheint vermessen. Man weiß, dass uns weder die Heilige Schrift noch die Apostolische Überlieferung irgendein Datum hinterlassen haben. Um ihren Lebenslauf, ihre Geburt, ihren Tod und ihre leibliche Aufnahme in den Himmel in den Rahmen der Geschichte einzufügen, sind wir also auf Vermutungen angewiesen und können über einen Grad von Wahrscheinlichkeit nicht hinauskommen. Vielleicht aber kommen wir doch zu annähernden Daten, wenn wir gewisse Überlieferungen mit historischen Anhaltspunkten aus den Texten der Schrift oder weltlichen Schriften in Verbindung setzen.
Die zeitliche Festlegung des Lebens Mariens hängt begreiflicherweise mit der zeitlichen Festlegung des irdischen Lebens des Gottessohnes zusammen. Leider ist auch diese schwankend. Die Daten, die man für die Geburt und den Tod des Heilands annimmt, schwanken um drei oder vier Jahre. Jesus wurde zwischen den Jahren 747 und 750 nach der Gründung Roms geboren, und starb zwischen den Jahren 29 und 33 unserer Zeitrechnung. Die wahrscheinlichste und heute meist angenommene Meinung legt als Todestag Christi den 7. April des Jahres 30 als Jahr seiner Geburt das Jahr 748 oder 749 nach der Gründung Roms fest.
Die Muttergottes war wohl ungefähr 15 Jahre alt, als sie den Heiland gebar. Die Mädchen Israels wurden nach ihrem 12. oder 13. Lebensjahr verheiratet, mussten jedoch noch ein Jahr warten, bis sie zu ihren Männern zogen. Wenn dieser Brauch auch bei der Muttergottes eingehalten wurde, dann war sie beim Besuch des Engels ungefähr 13 1/2 Jahre alt und bei der Geburt Jesu ungefähr 14 Jahre und einige Monate. Diese fand im 7., 6. oder 5. Jahr vor der christlichen Zeitrechnung statt, so dass die Muttergottes selbst ungefähr im 21., 20. oder 19. Jahr vor unserer Zeitrechnung geboren sein muss.
Nun gibt die verbreitetste und auch von Suarez und dem hl. Petrus Canisius angenommene Überlieferung der Muttergottes ein Alter von 70 oder 72 Jahren. Danach kann man ihren Tod im Jahr 50 oder 54 unserer christlichen Zeitrechnung annehmen, oder vielleicht auch schon im Jahr 49, wenn man annimmt, dass Maria bei dem am weitesten zurückliegenden Geburtsdatum Christi, also dem Jahr 7 vor unserer Zeitrechnung, 15 Jahre alt war.
Es erscheint uns erklärlich, dass die Muttergottes den Wunsch hatte, vor ihrem Sterben die Apostel noch einmal zu sehen. Die unechten Heiligen Schriften, die sogenannten "Apokryphen", lassen sie noch einmal auf wunderbare Weise zu den Aposteln kommen. Man kann aber vielleicht besser annehmen, dass die Apostel damals gerade zu jener Zusammenkunft in Jerusalem vereinigt waren, die man das "Erste Konzil" nennt und nach ernstlichen Berechnungen aus der Chronologie des hl. Paulus in die Jahre zwischen 49 und 51 legt.
Wir weichen hier bewusst von der Überlieferung ab, nach der die Muttergottes in Ephesus gestorben sein soll. Es ist wahrscheinlich, dass der hl. Johannes Jerusalem vor dem Tod Mariens, die der Kalvarienberg so stark dort zurückhielt, verließ. Andererseits weiß man, dass die Kirche von Ephesus durch den heiligen Paulus gegründet wurde, der dorthin zum ersten Mal zu Beginn des Winters 54/55 kam.
Wir können auch der Annahme eines hervorragenden Assomptionisten nicht beistimmen, der meinte, die Muttergottes hätte beim Aufstand der Juden in den Jahren 66/68 Jerusalem verlassen und wäre den Christen gefolgt, die nach Transjordanien, insbesondere nach Tella, flüchteten. Im Jahr 66 wäre die Muttergottes mindestens 84 Jahre alt gewesen, während ihr die Überlieferung nur ein Alter von höchstens 72 Jahren zuschreibt. Andererseits hat auch keine örtliche Überlieferung eine Erinnerung an ihren Tod in Transjordanien aufbewahrt. Dagegen hat die gleiche Tradition ihre "Dormition" auf den Sionsberg und ihr Grab in das Tal von Gethsemani verlegt.
Nachdem wir so den Tod Mariens zwischen die Jahre 49 und 54 gelegt haben, fragt es sich, ob man nicht noch zu einer genaueren Fixierung des Datums gelangen kann. Die Parallele zwischen der Auferstehung der Muttergottes und der des Heilandes lässt daran denken, dass auch die Muttergottes an einem Freitag starb und an einem Sonntag auferstand. Die Festlegung des Festes der Himmelfahrt Mariens auf den 15. August ließ schon die Vermutung aufkommen, dass Maria am Freitag, den 13. August, starb, und am Sonntag, den 15. August, auferweckt wurde. Das nimmt auch die Seherin Maria d´Agreda, Verfasserin des berühmten Werkes "Die mystische Stadt", an. Nun kommt in der von uns oben als wahrscheinlich angenommenen Zeitspanne nur ein Freitag, 13. August, vor, und zwar im Jahr 51. Dabei taucht eine Frage auf, die man vielleicht als kühn und indiskret ansehen könnte: Warum wählte die Muttergottes gerade den 13. jeden Monats für ihre Erscheinung in Fatima?
Aber welches nun auch das genaue Datum der Himmelfahrt der Muttergottes sein mag, kann man doch sagen, dass die 1900-jährige Wiederkehr dieses Ereignisses nicht sehr weit von der feierlichen Verkündung des Dogmas entfernt war, die, wie man weiß, von einer sich vor den Augen des Papstes vollziehenden Wiederholung des Sonnenwunders vom 13. Oktober 1917 in Fatima begleitet war.
________________________________________________________________________

14. Der heilige Thomas in Indien
(Aus: Willi Hermann, „Der Volksbote“, Innsbruck, 1952)
Thomas, genannt der Zwilling, der vernunftgläubige Zweifler unter den Aposteln, der mit seinen Händen die Wundmale des Herrn berühren wollte, um an seine Auferstehung glauben zu können, gehörte zu den beliebtesten Heiligen der jungen abendländischen Christenheit. Auf zahlreichen, in Holz oder Stein gearbeiteten Bildwerken dieser Epoche trägt er das Richtscheit, das Zeichen der Maurer und Baumeister, in der Hand. Durchforscht man die Evangelien und die Apostelgeschichte nach irgendeinem Hinweis auf die bürgerliche Tätigkeit des Heiligen, so schweigen die Berichte. Woher aber nahmen die Künstler des Mittelalters die Anregung, ihm die Kunst des Bauens zuzuschreiben? Nun ist uns unter den sogenannten unechten oder apokryphen Texten des Neuen Testamentes eine Erzählung erhalten, die sich „Die Taten des heiligen Thomas“ nennt und auf frühchristliche Zeit zurückreicht. In ihr hat sich das echte gläubige Verlangen der orientalischen Christen verwirklicht, auch für die in der Apostelgeschichte zu kurz gekommenen Jünger, in diesem Fall über den heiligen Thomas, sein Leben und sein Sterben, Nachricht zu erhalten.
Schon aus den Eingangsworten erfahren wir, dass dem Apostel, als die Zwölf in Jerusalem versammelt waren, um die Länder der Erde unter sich zu verteilen, durch Los die Aufgabe zuteilwurde, die Lehre Christi in Indien zu verkünden. „Da traf es sich, dass ein Kaufmann, der von Indien gekommen war und im Dienst eines Königs Gundafor stand, einen
Zimmermann und Baumeister
für seinen Herrn kaufen wollte“. Wie nun berichtet wird, sah der Herr Jesus den Kaufmann sich auf dem Markt ergehen und sprach zu ihm: „Willst du einen Zimmermann kaufen? Ich habe einen Sklaven, der Zimmermann ist und will ihn verkaufen?“ Als aber der Kauf zustande gekommen war, nahm der Heiland Thomas und führte ihn zum Kaufmann Abban. Sie trafen ihn dabei, wie er sein Gepäck auf das Schiff trug. Als Abban und Thomas eingestiegen waren und sich gesetzt hatten, forschte der Kaufmann den Apostel aus, indem er sprach: „Was für eine Arbeit verstehst du?“ Der aber sprach: „Aus Holz Pflüge, Joche und Schiffe, aus Steinen aber große Grabsäulen und Tempel und königliche Paläste zu verfertigen“. Der Kaufmann Abban aber sprach zu ihm: „Es ist gut, denn einen solchen Künstler haben wir nötig.“
Wie aus dieser Textstelle hervorgeht, ist es die Thomaslegende, in der zuerst von einem bürgerlichen Beruf des Heiligen gesprochen wird. Durch zahlreiche Übersetzungen war das ursprünglich syrisch geschriebene Werk im Abendland verbreitet worden. Wie steht es aber überhaupt mit der Glaubwürdigkeit des apokryphen Berichtes? Ist ihm auch nur der geringste historische Wahrheitsgehalt zuzuerkennen, wo doch die Fabel von der abenteuerlichen Künstlerfahrt an den Hof eines indischen Königs allzu romantisch klingt und eher in die Nähe der Märchen aus Tausend – und – einer – Nacht gerückt gehört?
Vergegenwärtigen wir uns, dass das Römische Reich zu Christi Zeiten in voller Blüte stand und seine Herrschaft bis ans Rote Meer, nach Ägypten und Syrien ausgedehnt hatte. Der Weg
vom Roten Meer nach Indien
stand offen, und es verlangte nur den Mut des Seefahrers, über das Arabische Meer nach der vorderindischen Malabarküste zu segeln. Nun ist uns eine römische Handschrift erhalten, eine Art „Führer durch das Arabische Meer“, in dem ein griechischer Kaufmann nach eigener Anschauung alle wichtigen Mitteilungen über Indien und seine westlichen Häfen, über die günstige Hin- und Rückfahrt mit Hilfe des Passats und über die Art des Handels zusammengetragen hat. Der Verfasser war ein Zeitgenosse des heiligen Thomas und widmete sein Werk den zahlreichen Kaufleuten, die den regen Handel nach Indien vermittelten. Es steht somit fest, dass damals Reisen aus dem Römischen Reich nach Indien durchaus üblich waren, und wir haben zunächst auch keinen Grund, an einer Missionsreise des Apostels wegen ihrer Undurchführbarkeit zu zweifeln.
Wie die Thomaslegende weiter berichtet, war es ein König Gundafor, der den Apostel als Baumeister gekauft hatte. Durchforscht man die antiken Schriften über den Orient, so stößt man nirgends auf diesen Namen. Erst die archäologischen Ausgrabungen, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im Pandschab, der nordwestlichen Ecke Indiens, gemacht wurden, haben hier
eine überraschende Wendung
gebracht. Die Durchforschung altindischer Grabstätten förderte eine Unzahl von Münzen zutage, die auf einer Prägeseite griechische, auf der anderen indische Inschriften zeigen. Eine untergegangene Welt erstand vor den staunenden Augen der Forscher. Ein halbes Jahrtausend indischer Geschichte trat aus dem Dunkel der Vergangenheit hervor. Unter den zahlreichen Königsnamen, die uns wiedergeschenkt wurden, befand sich auch der eines Königs Gundaphar aus der Familie der parthischen Arsakiden. Ein Blick auf das Münzbild lässt in ihm den persischen Fürsten erkennen. Er trägt die Tiara der Arsakiden, sitzt zu Pferde, die Rechte wie zum Befehl erhoben. Es besteht kein Zweifel, dass es sich hier um den König handelt, der in der Legende Gundafor genannt wird. Denn durch seine Regierungszeit, die von den Forschern übereinstimmend mit den Jahren 20 bis 50 nach Christus angegeben wird, macht ihn zum Zeitgenossen des Apostels. Wir müssen abermals feststellen, dass die Legende historische Tatsachen getreulich wiedergibt.
Wie soll man sich aber erklären, dass der Apostel gerade mit einem König aus der Nordwestecke Indiens in Verbindung gebracht wird, wo es doch viel näher liegt, eine Fahrt des Heiligen nach dem leicht erreichbaren, von den römischen Kaufleuten gerne besuchten Südindien anzunehmen? Und doch gibt es zwei gewichtige Gründe, die eine Missionsreise nach Nordwestindien für durchaus möglich erweisen. Der erste ist der syrische Seidenhandel, der über das nordwestindische Partherreich abgewickelt wurde, der zweite das Zeugnis der römisch-indischen Kunst des Pandschab.
Schon um Christi Geburt bildeten die fast unerschwinglichen Gewänder aus chinesischer Seide das begehrteste
Luxusobjekt verwöhnter römischer Damen.
Die geschäftstüchtigen, aber auch wagemutigen Vermittler dieser Seidengewebe waren syrische Unternehmer, die sie wieder aus dem parthischen Nordwestindien bezogen. Denn dorthin führte eine aus Turkestan kommende chinesische Handelsstraße, und von hier holten die syrischen Kaufleute die Ware, um sie nach Rom zu bringen. Es ist daher durchaus denkbar, dass der Apostel als Begleiter der Kaufleute in das Reich und an den Hof König Gundaphars gekommen ist.
Was sollen wir aber von dem Bericht der Legenden halten, der Apostel sei dem König als Künstler verkauft worden? Handelt es sich hier um eine wohl literarisch gelungene, geschichtlich aber wertlose Erfindung des Schreibers? Wieder ist es die indische Archäologie, die uns Aufschluss und Antwort zu geben vermag. Schon im Jahr 1809 war es einem Engländer beim Besuch der Ruinen eines altindischen buddhistischen Heiligtums in Nordwestindien aufgefallen, dass die Baureste eher griechisch-römische als indische Stilformen aufwiesen. Die seither gemachten Ausgrabungen führten zur Entdeckung einer griechisch-römischen Kunstlandschaft, die nach ihrem Verbreitungsgebiet „Kunst von Gandhara genannt wird. Gandhara ist das Land rund um die Stadt Peschawar. Dieses Gebiet gehörte seit dem Zug Alexanders des Großen zum griechischen Einflussbereich. Wenn auch die griechische Herrschaft in den folgenden zwei Jahrhunderten sich auflöste, so blieb doch der westliche Kultureinfluss bestehen und äußerte sich vor allem in der Baukunst und der Verwendung griechischer Sprache und Schrift. Die um Christi Geburt einsetzende religiöse Hochblüte des Landes zeigt jedoch rein indische, und zwar buddhistische Züge. So kommt es, dass die Kunstform der ersten römischen Kaiserzeit und bodenständige indische Religiosität eine Verbindung eingehen, wie sie sonst nirgendwo in Indien anzutreffen ist. Hier erst überwindet das indische religiöse Gefühl die Scheu, Buddhas Gestalt bildlich darzustellen. In ein langes faltenreiches Gewand gehüllt, die Rechte würdevoll wie zum Segen oder zur Belehrung erhoben, tritt uns der Religionsstifter auf diesen Bildwerken entgegen. Gewandung und Haltung sind unindisch. Die
Römische Toga umschließt Buddhas Gestalt
und er gleicht eher einem Cäsaren als einem östlichen Heiligen.
Wie die Ausgrabungen erwiesen haben, stand die „Kunst von Gandhara“ unter König Gundaphar in voller Blüte. Auch haben nachweislich ausländische, vor allem griechische Künstler an seinem Hof gewirkt. Hat der Gedanke des Legendenschreibers, den Apostel als Künstler an den König Gundafor verkaufen zu lassen, nicht eine sehr natürliche Erklärung gefunden?
Wir werden mit den Mitteln der historischen Forschung niemals ergründen, ob der Apostel Thomas tatsächlich in Indien geweilt und ob er, nach der Tradition der altindischen orientalischen Kirche, auch dort den Martyrertod erlitten hat. Wir können nur erkennen, dass das Gerippe dieser Erzählung auf
verbürgten geschichtlichen Tatsachen
beruht und nichts der Annahme einer Missionsreise widerspricht. Wer aber geneigt ist, den Bericht der Legende und die gleichlautende Überlieferung der altindischen Kirche, der Thomaskirche, gläubig hinzunehmen, verehrt mit ihr in der Thomaskirche zu Malapur, einem Vorort von Madras, jene Stätte, auf der der erste Missionar Indiens seinen Tod erlitten hat. Doch hütet die Kirche ein leeres Grab. Es waren Brüder des Apostels, die seine Gebeine heimlich aus dem Grab nahmen und nach dem syrischen Edessa brachten. Nur sein Name ist der indischen Thomaskirche erhalten geblieben.
________________________________________________________________________

15. Liebt die Kirche die Tiere?
Wie oft kann man das leichtfertige Urteil hören "Die Kirche hat nichts für die Tiere übrig"! Doch ich glaube, um diese Frage richtig zu stellen und zu lösen, muss man eine Unterscheidung machen und genauer sagen: "Die Kirche liebt die Tiere, aber es gibt natürlich auch Geistliche, die weniger für sie übrig haben."
Dass die Kirche die Tiere liebt, steht nach meiner Meinung und nach Meinung aller unparteiischen Historiker außer Zweifel. Öffnen wir nur einmal die Bibel und beginnen beim Alten Testament! Man findet darin mehr als 200 Mal Tiere erwähnt, z.B. in den herrlichen, echt orientalischen Tierbeschreibungen im 39. Kapitel des Buches Ijob.
Wenn das jüdische Volk auch Tiere opferte, dann hatte es dabei doch vom Tier, so paradox dies klingen mag, eine hohe Meinung. Indem man das Tier an die Stelle des Menschen setzte, bekundete man, dass es sich nicht so sehr vom Menschen unterscheidet. Man betrachtete es als einen notwendigen Fürsprecher, und sein Blut galt als heilig. Sicherlich wäre es besser gewesen, dieses Blut nicht zu vergießen. Aber man muss die Einstellung der Menschen jener Zeit bedenken und ihr Gefühlsleben nicht nach unseren heutigen Empfindungen beurteilen.
Die Herabkunft Christi schaffte die Tieropfer ein für allemal ab, und das Tier erhielt seine ursprüngliche Rolle als Diener und Gefährte des Menschen zurück. Christus selbst wurde in einer Krippe, umgeben von Ochs und Esel, geboren und führte später gleichsam um sie zu belohnen, diese beiden Tiere in seinen Reden an: "Wer von euch", rief er den scheinheiligen Pharisäern zu, "dessen Esel oder Ochs in eine Grube fällt, wird ihn nicht herausziehen, selbst wenn es an einem Sabbat ist?" Und auf einem Esel zog der Friedensfürst am Palmsonntag, dem Tag seines so rasch vorübergehenden Triumphes, in Jerusalem ein, während die Menge Palmen- und Olivenzweige streute.
Alle Liebe in diesem praktisch veranlagten Volk galt den nützlichen Tieren. Daher ist im Evangelium wenig vom Hund die Rede. Die Katze ist überhaupt nicht erwähnt. Dagegen war das Schaf die Freude seines Besitzers. Wenn es sich verirrt, sagte Jesus, dann zieht er aus, es zu suchen, und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf die Schultern und bringt es voller Freude nach Hause zurück. Auch der Hahn wird erwähnt, der vor Tagesanbruch kräht - ein Signal, nach dem man sich richtet; denn die Uhren sind noch unbekannt. Und der Hahn ist es auch, der den heiligen Petrus an seinen Verrat erinnert. Von der Henne wird ein einziger, aber ergreifender Zug geschildert. Christus sieht sie inmitten ihrer Jungen: mit forschenden Augen, unruhig, Gefahren witternd und bereit, ihre Küchlein unter Einsatz ihres Lebens zu verteidigen. Und der Heiland, der es müde ist, immer wieder festzustellen, wie wenig Wirkung seine Predigt hat, ruft aus: "Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel, du aber hast nicht gewollt!"
Auch den Vögeln galt die Aufmerksamkeit des Heilandes. Er hat die gefräßigen und streitenden Sperlinge gesehen, wie sie sich keine Sorgen um das Morgen machen und hat sie seinen Zuhörern als Beispiel hingestellt für die Vertrauensvolle Hingabe an die göttliche Vorsehung. "Betrachtet die Vögel des Himmels! Sie säen nicht, sie ernten nicht, und doch ernährt sie der himmlische Vater!" Das bedeutet nicht, wie zuweilen behauptet wird, dass man sich der Trägheit hingeben darf. Es soll nur heißen, dass man, nachdem man alles Erforderliche getan hat, um seinen Lebensunterhalt durch gewissenhafte Arbeit zu sichern, im übrigen auf Gott vertrauen soll.
Der berühmte Naturforscher Fabre sagte, nachdem er sein Leben lang die Gebräuche der Insekten beobachtet hatte: "Gott? Ich glaube nicht nur an ihn; ich sehe ihn in der kleinen Welt der Natur." Die Schöpfung preist den grenzenlosen Reichtum des Schöpfers, und deshalb hat Christus überall im Evangelium so oft von den "Tieren der Erde" und den "Vögeln des Himmels" gesprochen. Seine Anhänger haben das verstanden, und viele von ihnen haben in enger Verbundenheit mit Tieren gelebt. Ich will hier nur den Raben des heiligen Benedikt, den Hirsch des heiligen Hubertus, den Hund des heiligen Rochus, den Esel des heiligen Martin von Tours, den Wolf des heiligen Franz von Assisi und die Katze des heiligen Philipp Neri erwähnen, die dieser auf den Armen in den Straßen Roms spazieren trug und ungeniert den Kardinälen auf die Knie setzte, wenn er zu müde war. Und in neuerer Zeit finden wir den Hund der heiligen Theresia von Lisieux, der sich eines Tages in die Klausur einschmuggelt, um seine junge Herrin wiederzusehen, die darüber vor Rührung weint, oder den berühmten Schäferhund Don Boscos, der sich auf jeden Angreifer stürzt. "Die Freundschaft des Grauen", schrieb Don Bosco, "war Jahre hindurch für mich eine wahre, schützende Hand der Vorsehung in den Gefahren, in denen ich mich befand."
Die Kirche hat auch Gebete verfasst, um die Tiere zu segnen. Hier ist eines aus dem liturgischen Rituale, das man mich oft gebeten hat, in den Bauernhöfen zu sprechen, wenn ich meine Ferien in der Bretagne oder in Savoyen verbrachte: "Allmächtiger Herr, der Du gewollt hast, dass Dein Sohn in einem Stall geboren wurde und zwischen Tieren ruhte, geruhe, diese Tiere zu segnen, die Du schufst. Wache über ihre Gesundheit, und gib, dass sie stets die würdigen Begleiter und Mitarbeiter des Menschen bleiben!"
Und wenn es noch nötig sein sollte, zu beweisen, dass die Kirche die Tiere liebt und schützt, können wir an die Anhänglichkeit erinnern, die manche Päpste ihren Hunden erwiesen, wie z.B. Paul V., Pius IX. und Leo XIII. Was den verstorbenen Papst Pius XII. anbelangt, so weiß man, dass er mindestens zwei Katzen und 5 Käfige mit Kanarienvögeln besaß, die er selbst fütterte und denen er jedem einen Namen gegeben hatte. "Altersspleen", werden blasierte Leute sagen. Spleen eines alten Mannes, vielleicht aber eines Mannes, der mit über 82 Jahren noch in der Lage war, Enzykliken zu verfassen, in harten Worten diejenigen zu geißeln, die sich grausam gegenüber den Tieren verhalten, und die Stierkämpfer Spaniens wissen zu lassen, dass ihm die Zusendung einer Ehrencapa und der Million Peseten, die sie beilegen wollten, nicht genehm sei.
Ja, die Kirche liebt die Tiere! Aber es gibt Geistliche, die sie nicht lieben, genau so, wie es in der Welt der Laien Menschen gibt, die Tiere gern haben, und andere, die sie nicht gern haben. Was lässt sich dagegen tun? Meiner Meinung nach kann man die Menschen in dieser Frage in drei Gruppen einteilen: solche, die Tiere gern haben; solche, die sie nicht gern haben, und solche, denen sie gleichgültig sind.
Ich glaube, es ist vergeblich, versuchen zu wollen, Menschen, die Tiere nicht mögen, dazu zu bringen, sie zu lieben; denn die Liebe zu den Tieren ist ein Instinkt. Man hat ihn, oder man hat ihn nicht. Wenn man solchen Leuten von Tieren redet, stößt man auf eine Wand des Unverständnisses. Ich muss bekennen, dass mich diese Leute, die übrigens zuweilen sehr fromm sind, geradezu aufregen.
Was meine geistlichen Mitbrüder anbelangt, die Tieren gegenüber gleichgültiger sind, so habe ich festgestellt, dass manche von ihnen eine so hohe Idee von der Menschenseele haben, die sie retten und heiligen wollen, dass sie glauben, sie würden ihre Zeit verschwenden oder sogar ihren apostolischen Aufgaben nicht gerecht werden, wenn sie sich mit Tieren beschäftigen.
Um all diese Vorurteile zu beseitigen, die oft unbewusst und schuldlos sind, schrieb ich mein Büchlein "Ein Priester und sein Hund", in dem ich die Geschichte eines Hundes erzählte, den ich sehr liebgewonnen hatte und dessen Tod mich heute noch schmerzt. Es verfolgte nicht nur die Absicht, bisher geschlossene Augen zu öffnen, sondern sollte auch zeigen, dass man das Tier achten muss, weil es ebenso wie wir - wenn auch in einem anderen weniger hohen Grad - ein Geschöpf Gottes ist.
Jean Gautier, "Ecclesia", Paris 1958
________________________________________________________________________
 Marianisches
Marianisches






















