Inhalt:
1. Allerheiligstes Sakrament des Altars
2. Altarschmuck
3. Almosen
4. Allmächtig und allwissend
5. Ablass
6. Auferstehung des Leibes
7. Arbeitsamkeit
8. Aberglaube
9. Antichrist
10. Abendland
11. Altarfelsen
12. Armee des Papstes
13. Antlitz Jesu Christi
14. Allerheiligen und Allerseelen
15. Andalusien
16. Antimodernisteneid
17. Amen
18. Auferstehung der katholischen Kirche in England
19. Ablass 2.0
20. Andacht zu den Bildern Marias
21. Ankleidegebet
22. Angst
23. Auktion
24. Allah
25. Äbtissin
________________________________________________________________________

1. Allerheiligstes Sakrament des Altars
Die Kindheit Jesu und das allerheiligste Sakrament des Altars
Einst stieg der König der Könige, Gottes eingeborener Sohn, von seinem himmlischen Thron herab. Den Glanz seiner göttlichen Majestät, seine Allmacht verbarg er unter menschlicher Gestalt. Der Herr Himmels und der Erde lag so hilflos wie ein schwaches Menschenkind im Stall zu Betlehem auf hartem Stroh. Seinen allerhöchsten Thron, den Kerubim und Seraphim anbetend und lobpreisend umstehen, hatte er vertauscht mit der ärmlichen Krippe. Unvernünftige Tiere standen da, wo Engel hätten stehen sollen, wo die Fürsten dieser Welt zu stehen nicht verdienten. Furchtlos schauten sie mit sanftem Blick auf die verschleierte Majestät des Ewigen. Sie erwärmten durch ihre Nähe und ihren Atem die kalten Glieder des göttlichen Kindes.
Ähnlich ist die Umgebung des Heilandes im heiligsten Sakrament, wenn er auf dem Altar liegt oder in der Monstranz thront. Lichter flimmern um ihn, zarte Blümchen spenden ihm ihren Wohlgeruch und welken vor ihm hin, Weihrauchwolken steigen furchtlos zu ihm auf und hüllen ihn in einen Schleier. Alles, was klein, einfach und unschuldig ist, wird aus der Schöpfung auserwählt und vor dem heiligsten Sakrament aufgestellt, um dem Heiland zu huldigen, wie es bei seiner Geburt der Fall war.
In der Krippe schlief das göttliche Kind; Maria und Josef sahen die geschlossenen Augen und hörten die sanften Atemzüge; sie beobachteten all die lieblichen Umstände seines kindlichen Schlafes. Das Kind schien in voller Sorglosigkeit zu schlafen; Kälte und Armut, die ganze Außenwelt schien vergessen zu sein. Und doch war das nur Schein! Unter dieser Brust, die sich so leicht hebt, wacht das Herz, wenngleich der Leib schläft, und unter diesen geschlossenen Augenlidern ist der Anblick des Kalvarienberges nicht minder klar, deutlich und schrecklich als in den Stunden des Wachens. Der Schlaf unterbricht keineswegs die Tätigkeit des Geistes, der unablässig bei jedem Pulsschlag die Akte des Gehorsams, des Opfers, der Genugtuung mehrte.
Gerade so ist es im Tabernakel. Hier schläft der Heiland in der Umarmung eines geheimnisvollen Todes. Er entsagt dem Gebrauch seiner Sinne: er sieht nicht mit seinen Augen, er hört nicht mit seinen Ohren, er streckt seine Hände nicht aus und bewegt nicht die Lippen zum Sprechen, nicht die Füße zum Gehen. Und dennoch ist er da unter den Gestalten des Brotes, Gottes eingeborener Sohn: vom Tabernakel aus regiert er die Welt, spendet er den Menschen seine Gnade. Er besitzt im Tabernakel ein vielseitiges Leben, welches unsere Worte nicht schildern können, unsere Liebe nicht würdig anzubeten vermag.
Verlassen wir Betlehem! Kaum sind einige Wochen verstrichen seit der Geburt des Kindes; eine frostige Morgenluft weht über die Sandflächen der Wüste, vom Tau der Nacht befeuchtet. In der Morgendämmerung erblicken wir einen Mann mit einer jungen Frau. In den Armen des Mannes ruht ein gar zartes Kind: es ist die heilige Familie; gar eilig ist ihr Schritt, denn Herodes strebt dem Kind nach dem Leben. Der von Gott Verheißene, von den Völkern seit Jahrtausenden Ersehnte ist endlich gekommen, - und schon ist er auf der Flucht vor seinen eigenen Geschöpfen. Getragen auf den Armen des heiligen Josef verlässt er das Land, das seit Jahrhunderten Zeuge vieler Wunder seiner göttlichen Liebe und Erbarmung war; er sucht Zuflucht in dem heidnischen Ägypten. – In den Augen der Welt scheint Josef ein Verbrecher zu sein. Er flieht bei Nacht und Nebel, um das Kind zu retten, welches durch den grausamen Befehl des Herodes dem Tod geweiht war. Mariä Herz ist bis zum Überfließen voll des Leids: ein Schmerzensschwert hat es durchbohrt. Sie kennt den unendlichen Wert dieses Kindes, wie kein Apostel, kein Kirchenlehrer ihn je erkannt hat, und die Welt stößt dieses Kind, ihren Heiland und Erlöser, von sich. Sanft ruht das Kind in den Armen des heiligen Josef. Bald macht der kalte Wind der Nacht seine zarten Glieder zittern, bald leidet es unter den sengenden Strahlen der südlichen Sonne. Gar selten erfreut das Rauschen einer labenden Quelle sein Ohr, gar selten erquickt der Schatten einer Palme den Schöpfer aller Dinge. Ein wunderbares Geheimnis!
Nun gehen wir nach Rom! Es waren ungefähr 250 Jahre verflossen; in Rom wütete eine Christenverfolgung. Zahlreiche Priester waren schon gemartert, nach ihnen fahndete man zuerst; bei Tag durften sie sich auf den Straßen nicht blicken lassen. Im Gefängnis schmachteten viele Christen; schon war der Tag bestimmt, wo sie den wilden Tieren vorgeworfen werden sollten. Am Tag vorher sehen wir viele Christen sich heimlich im Haus der heiligen Agnes versammeln. Dort las ein Priestergreis die heilige Messe. Eben ist sie beendet. Das Allerheiligste liegt auf dem Altar, für die gefangenen Christen bestimmt. Wer aber wird es wagen, das Allerheiligste ins Gefängnis zu bringen? Fragend wendet sich der Priestergreis an die Versammlung. Da kniet schon vor ihm der Junge Tarcisius.
Mit ausgestreckten Händen, mit einem Blick voll englischer Unschuld schien er um die Gunst zu bitten, den Christen im Gefängnis das Allerheiligste bringen zu dürfen. „Du bist zu jung, ein Kind“, sprach der Priester. „Meine Jugend, heiliger Vater, wird mein bester Schutz sein; o, verweigert mir diese große Ehre nicht“, lautete die Antwort des Jungen. Die Tränen standen ihm in den Augen, seine Wangen glühten vor heiliger Rührung. Seine Bitte wurde gewährt. Der Priester hüllte das Allerheiligste in innen und legte es in die Hände des Jungen mit den Worten: „Vergiss nicht, Tarcisius, welcher Schatz Deiner Sorgfalt anvertraut ist.“ Dieser antwortete: „Eher will ich sterben, als ihn verraten.“ Er verbarg das Allerheiligste vor seiner Brust und eilte durch die Straßen der Stadt.
Da erblickte ihn eine Schar spielender Jungen. „Tarcisius“, rief einer, „Du musst jetzt mit uns spielen, es fehlt uns gerade noch einer.“ „Jetzt nicht“, antwortete dieser, „ich habe ein wichtiges Geschäft.“ „Aber Du musst, ich dulde keinen Widerspruch“, versetzte einer der Jungen. Alles Bitten half nichts. „Was trägst Du denn so sorgfältig an Deiner Brust? Lass sehen!“ rief ein Junge, während ein anderer schon die Hand ausstreckte, um es genau zu fühlen. Krampfhaft drückte Tarcisius die Arme auf die Brust mit den Worten: „Nie, nie!“ Die heidnischen Jungen dringen auf ihn ein und werfen ihn zu Boden; es sammelt sich Volk um den Haufen; ein Heide, der sich schon wiederholt in die Versammlung der Christen eingeschlichen hatte und Tarcisius kannte, rief: „Er trägt die christlichen Geheimnisse.“ Das war das Zeichen zu einem erneuten Angriff auf den Jungen, der blutend am Boden lag.
Da fühlten sich die Angreifer plötzlich von einem starken Arm zurückgeschleudert; es war Quadratus, ein Offizier von außergewöhnlicher Größe und Stärke, vor dem die Menge auseinanderstob. Er war ein Christ und kannte den Jungen. Sanft hob er den blutenden Tarcisius auf und sprach: „Bist Du schwer verletzt?“ Tarcisius erwiderte mit leiser Stimme: „Sei nicht um mich besorgt, Quadratus, ich trage die heiligen Geheimnisse; für diese sorge!“ Voll tiefster Ehrfurcht nahm Quadratus den Jungen auf seine Arme und trug ihn fort. Alsbald hauchte der Junge seine Seele aus, und Quadratus trug den Leib eines Martyrers und den des Königs der Martyrer in seinen Armen.
Papst Damasus I. rühmte Tarcisius, er sei, als er die heilige Eucharistie zu Gläubigen trug, von heidnischem Pöbel überfallen und erschlagen worden und vergleicht ihn mit Stephanus.
________________________________________________________________________

2. Altarschmuck
Wenn es auf der ganzen Erde keinen Ort gibt, der an Heiligkeit und Würde sich auch nur im Entferntesten mit einer katholischen Kirche messen kann, so gibt es auch keine edlere Stätte in der Kirche als den Altar. Weil auf ihn Jesus täglich bei der heiligen Messe vom Himmel herniedersteigt, sein heiliger Leib im Dunkel des Tabernakel eingeschlossen ist und um Gnade und Barmherzigkeit für die sündige Welt fleht und alle Mühseligen und Beladenen voll Zuversicht einlädt, deshalb ist der Altar der Magnet, der die Gläubigen immer wieder anzieht. Bevor der Altar seiner erhabenen Bestimmung übergeben wird, wird er unter Gebet und Salbung des Bischofs eingeweiht, so dass der Segen auf ihm ruht und ihn ehrwürdig macht. Doch die heilige Stätte bleibt nicht nackt und ohne Zierde, sondern wird herrlich geziert, so dass auf sie die Worte des Propheten passen: „Du bist geziert mit Gold und Silber, gekleidet mit feiner Leinwand, mit gestickten und bunten Gewanden.“
Warum ist es richtig und gut, die Altäre nach Kräften auszuschmücken und wie soll das aussehen?
Es gibt in unserer materialistischen Zeit viele, die sich über den Luxus der Kirchen beklagen, weil viele Arme oft des Notwendigsten entbehren müssen. Es scheint, dass gerade diejenigen, die in ihren Wohnräumen, in Speise und Trank und in den schönsten und exotischsten Urlaubsreisen allen Arten des Luxus frönen, die Altäre deshalb ihres Schmuckes berauben möchten, damit sie der Verachtung preisgegeben werden, Gott die Ehre geraubt wird und die Kirchen möglichst verlassen dastehen. Die Leute sollen sich lieber an anderen Orten versammeln, die Frommen kritisieren, einander den Hof machen und lieber den Zeitgeist groß werden lassen. Aber diese Sprache ist nicht neu, hat doch schon Judas ähnlich gesprochen; als nämlich Maria Magdalena mit kostbarer Salbe die Füße Jesu salbte, meinte der Dieb, es wäre das Geld besser zum Vorteil der Armen verwendet worden. Judas klagte über Verschwendung und heuchelte Liebe zu den Armen, um seinen Geiz zu verdecken. Ähnlich sind manche karg im Geben, wo es gilt, eine Kirche zu erbauen oder zu erhalten oder zum Schmuck eines Altars beizutragen und schützen allerlei nichtige Gegengründe vor, weil auch sie von der Leidenschaft des Geizes beherrscht werden. Wiederum andere schimpfen über die Zierde der Kirchen, obwohl sie selbst sich teuer vergnügen und kleiden und für alles andere Geld haben, nur nicht für das Gotteshaus. Gott aber soll einen geschmückten Altar haben! Wenn er nämlich, die Schönheit und Herrlichkeit selbst, den Thron des Himmels verlässt und uns zu Liebe zu uns hinabsteigt, so ist es richtig und gut, dass ihm, als dem Herrn des ganzen Weltalls, das Schönste und Prachtvollste geboten wird, was immer nur die Erde aufzuweisen hat. Der Prophet weist darauf hin, dass in der neuen Zeit des Erlösers ein prachtvoller Gottesdienst eingerichtet werden soll: „Ich erschüttere alle Völker und es wird kommen der von allen Völkern Ersehnte und ich erfülle dieses Haus mit Herrlichkeit, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold. Größer soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses als des ersten sein.“ Schmucklose Altäre sind keine Zeichen der Herrlichkeit Gottes, die auf ihnen thront. Es ist unsere heiligste Pflicht, Gottes Ehre zu vermehren.
Einen geringen Tribut der Dankbarkeit und nur ein Geringes von den vielen Gütern, mit denen uns Gottes Güte beschenkt, geben wir Gott zurück, wenn wir zur Zierde der Altäre beitragen. Schon die Liebe zu Gott verpflichtet uns zur Ausschmückung der Altäre, indem die Liebe sich auch durch äußere Zeichen kund zugeben pflegt. Ein Kind, das seine Eltern liebt, denkt lange darüber nach, wie es ihnen bei einer sich bietenden Gelegenheit eine Freude bereiten kann. Obwohl es den Eltern eine kleine Gabe überreicht, die ihnen ohnehin schon gehört, nehmen die Eltern das Geschenk doch als Zeichen kindlicher Liebe mit Freude entgegen. Wie Gott uns gegenüber die Gesinnungen eines gut meinenden Vaters bewahrt, so sollen auch wir es an Beweisen kindlicher Liebe nicht fehlen lassen in Bezug auf alles, was sich direkt auf Gott bezieht. Was steht Gott nun näher als die katholische Kirche, in der er angebetet und geehrt wird, und als die Altäre, auf denen sein Sohn thront! Sage nie: „Die Kirche oder der Altar ist schön genug“, weil nur das Beste für Gott gut genug ist. Dass die Kirchen oft so ärmlich, während die Wohnungen der Menschen so kostspielig eingerichtet sind, dass man dem Haus Gottes oft so wenig Sorge zuwendet, während man auf den Schmuck und die Ausstattung des eigenen Hauses so sorgfältig bedacht ist: das ist eine Beleidigung Gottes und eine Schmach für jede christliche Gemeinde. Es ist unbegreiflich, dass reiche und wohlhabende Gemeinden Jahre lang mit ärmlichen Kirchen sich begnügen, ohne Abhilfe zu schaffen.
Wenn Gott in seiner Großzügigkeit dem Christen Reichtum gibt, um seine Wohnungen, in denen er doch nur kurze Zeit lebt, zu verschönern, so ist es doch gewiss möglich, dass der Christ auch einen kleinen Teil seiner Güter auf Kirchen und Altäre verwendet, die oft Jahrhunderte überdauern. Gott bedarf zwar nicht der äußeren Entfaltung von Pracht, weil wir seinem Glück nichts hinzufügen können; der Christ wird aber durch herrliche Kirchen und geschmückte Altäre erbaut, kann inniger beten, und die Andacht wird herzinniger; deshalb ist es geboten, zum Schmuck der Kirchen und Altäre nach Kräften mitzuwirken.
Weil die liebende Sorge um die Altäre tief im christlichen Geist begründet ist, deshalb begegnet sie uns schon in den ersten Zeiten der Kirche. Schon der heilige Augustinus und Hieronymus berichten, dass das Altarkreuz oft aus Gold gefertigt und mit kostbaren Edelsteinen besetzt war. Die Säulen des Altares waren meist aus edlen metallen angefertigt. In der Nähe des Altares brannten oft zierliche Ampeln, die mit dem feinsten Balsamöl gefüllt waren. An hohen Festtagen stellte man ausgesuchte Blumen und Stauden zum Zeichen der Freude zwischen die Altarleuchter. Die heilige Eulalia spendete mitten im Winter Blumen zum Schmuck der Altäre, wie der heilige Augustinus eine Frau lobt, die sich den Schmuck der Altäre angelegen sein ließ, und der heilige Gregor von Tours erzählt, dass ein Priester den Altar mit weißen Lilien geschmückt habe. Einen besonderen Schmuck der Altäre bildeten die gestickten Teppiche. Eine heilige Olympia schenkte ihre seidenen Kleider zur Verzierung der Altäre, wie auch die Wände der Kirchen vielfach mit wertvollen Tüchern und Vorhängen geschmückt wurden. Bildliche Darstellungen, in sinnreichen Stickereien ausgeführt, fesselten vielfach das Auge des Beschauers. Weil die Christen der ersten Jahrhunderte aus dem Glauben lebten und in ihrem Herzen die Liebe zu Gott mächtig brannte, deshalb waren sie begeistert für das Heiligtum, schmückten und besuchten es mit Freude.
Bis heute ist der Altar im Wesentlichen derselbe geblieben. Auf den Tabernakel, als den heiligsten Ort auf oder in der Nähe des Altars, verwendet die Kirche die größte Sorge und Aufmerksamkeit, indem er kirchlichen Bestimmungen gemäß im Innern mit weißer Seide oder mit Gold- oder Silberstoffen ausgelegt sein muss.
Inmitten des Altars prangt das Bild des Gekreuzigten; zu beiden Seiten brennen während des heiligen Opfers Kerzen, denn wo das Kreuz herrscht, muss die Finsternis weichen. Den Altar verschönert ein Bild aus Stein, Holz oder Farbe. Die Gemälde sind die Lehr- und Erbauungsbücher der christlichen Gemeinde. Während Worte verhallen und vergessen werden, bleibt ein zur Andacht stimmendes Bild und predigt jedem Beschauer. Die Heiligen, die wir oft auf den Altarbilder dargestellt finden, neigen sich zu unseren Bitten; einst entflammten auch sie am Altar vor Liebe zu Gott; hier holten sie den Geist des Gebetes und manch andere Gnaden. An beiden Seiten des Tabernakels sind oft Bilder von Engeln angebracht, indem sie zum Dienst und zur Anbetung Gottes berufen sind. Gewöhnlich sind die Engel so dargestellt, dass sie in heiligem Staunen, in tiefer Ehrfurcht und Anbetung Jesu versenkt, das hochwürdigste Gut kniend umgeben und uns zu gleicher Ehrfurcht und Andacht einladen. Möge auch jeder Christ wie ein anbetender Engel an die Kirche gefesselt sein, sein Betragen immer denen der Engel gleichen und sein Herz in heiliger Liebe, wie das der Cherubim, zum heiligsten Sakrament entbrennen! Nach Vorschrift der Kirche sollten früher über jedem Altar drei linnene Tücher ausgebreitet sein, wie auch bei der heiligen Kommunion unser Herz einer reinen Leinwand gleichen soll, damit Jesus eine schöne Wohnung vorfindet. An hohen Festtagen wurde der Altar mit Teppichen und gestickten Decken geschmückt. Blumen zierten ihn dazu; denn wo wäre ein Kirchlein so arm, das nicht einen, wenn auch noch so bescheidenen Schmuck besäße? Wo regen sich nicht fromme Hände, die das Heiligtum zur Ehre Gottes zierten? Wo schlügen nicht teilnehmende Herzen für den freiwillig armen Jesus, die für die Zierde seines Hauses ein Scherflein opferten? Ein edler Wetteifer lässt auch heute noch die Altäre im schönsten Schmuck glänzen. Vielfach betrachten christliche Frauen es als ihre heiligste Ehrensache, durch Stickereien und anderweitigen Schmuck zur Zierde der Kirchen und Altäre beizutragen, wie überhaupt die christliche Kunst und Kunstfertigkeit oft schon Großes für Gottes Ehre geleistet hat. Es sollten deshalb die christlichen Männer, die auf die Entfaltung des kirchlichen Lebens in der Gemeinde Einfluss haben, für die Zierde der Gotteshäuser eintreten, damit wieder mehr neuere und schönere Kirchen und Altäre erstehen. Die christlichen Frauen sollten sich ebenfalls für die Schönheit und Pracht der Kirchen und Altäre begeistern. „Wie schön sind deine Zelte, o Jakob; deine Wohnungen, o Israel!“ (Num 24,12) „Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen!“ (Ps 83,3) Unsere Kirchen sollten durch den Fleiß gläubiger kunstgeübter Frauen und Männer noch immer anziehender und schöner werden. Mögen sich doch viele in Mußestunden, falls es solche noch gibt, mit kirchlichen Stickereien befassen, auf die die Engel mit Wohlgefallen niederblicken und jeden Nadelstich zu Ehren des vielfach im Tabernakel verkannten und verlassenen Heilandes ins Buch des Lebens aufzeichnen! Ja mögen alle ohne Ausnahme nach besten Kräften für die Verschönerung und Zierde der Kirchen und Altäre im heiligen Wetteifer eintreten!
________________________________________________________________________

3. Almosen
Ein Almosen für Gott selbst
Manche von uns werden schon einmal eine Wallfahrt nach Trier unternommen haben, um dem Kleid die Verehrung zu bezeigen, das einst der menschgewordene Sohn Gottes auf Erden getragen hat, und das die römischen Soldaten bei seiner Kreuzigung nicht zerschneiden wollten, sondern unter sich verlosten. Nach frommer Überlieferung hat die allerseligste Jungfrau Maria dieses Kleid mit eigener Hand für ihren göttlichen Sohn Jesus, als er noch Kind war, gewoben und dann soll das Kleid mit dem göttlichen Kind gewachsen sein. Wie gerne wird Maria an diesem Kleid gearbeitet haben! Sie hätte es wohl auch bei fremden Leuten, bei einem Weber bestellen können. Aber die Freude, die Ehre, es selbst zu verfertigen, wollte sie sich nicht nehmen lassen.
Ein ähnliches Glück wie Maria haben wohl überhaupt alle empfunden, denen es vergönnt war, der heiligen Menschheit Jesu Christi zu dienen. So besonders der heilige Josef. Er war ja von Gott eigens ausgewählt, um durch seiner Hände Arbeit den Sohn Gottes zu ernähren. Und wie glücklich werden sich auch die geschätzt haben, denen der Heiland die Ehre schenkte, auf seinen Reisen bei ihnen einzukehren und sich von ihnen bewirten zu lassen, so z.B. Maria und Martha von Bethanien, die Schwestern des Lazarus. Oder würden nicht auch wir es als die höchste Ehre und das größte Glück ansehen, wenn der Heiland noch unter uns lebte, und wir ihm ein Mittagsmahl bereiten dürften?
Beleben wir unseren Glauben! Unser Herr Jesus Christus hat uns nicht verlassen. Er ist im allerheiligsten Sakrament des Altares noch immer in höchst eigener Person ebenso wahrhaft zugegen wie ehedem in Palästina und verdient darum auch im hochheiligen Sakrament die gleiche Liebe und Verehrung wie damals. Da können wir ihn anbeten wie die Hirten, uns vor ihm niederwerfen wie die heiligen drei Könige, ja sogar ihm ähnliche Dienste erweisen wie Maria, die für das Jesuskind das Röcklein gewoben hat. Das klingt vielleicht sonderbar, aber es ist doch wahr. Unser Heiland war in seiner Menschwerdung schon so arm und schwach geworden, dass er hätte verhungern und erfrieren müssen, wenn Maria und Josef nicht für Nahrung, Kleidung und Obdach gesorgt hätten. Im allerheiligsten Altarsakrament verhält es sich ähnlich mit ihm. Auch da ist er arm, so arm, dass er ohne unsere Hilfe dort nicht einmal existieren kann. Wir müssen Brot und Wein bereiten, Kerzen, Leinen und dergleichen bringen, sonst kann er sich auf unseren Altären nicht opfern. Wir müssen ihm ein Haus, einen Tabernakel bauen, die heiligen Gefäße herbeischaffen, sonst kann er unter uns nicht wohnen. Er muss also sozusagen ganz von unserem Almosen leben, und wir machen ihn dadurch zu unserem Schuldner. Wird er wohl seine Schulden bezahlen, wenn wir ihm im hochheiligen Sakrament so dienen? Ja, Jesus kann seine Schulden bezahlen und wird sie bezahlen! Er ist ja nicht überall so arm wie im Tabernakel; im Himmel hat er unermessliche Reichtümer. Mit diesen wird er sogar fremde Schulden tilgen, nämlich die unserer notleidenden Mitmenschen, denen wir zu essen geben, die wir bekleiden oder beherbergen: um wie viel mehr seine eigenen! Er hat sich ja als Bürge für die Armen hingestellt. Wenn wir ihm einst die nicht getilgten Schuldscheine der Armen vorzeigen, wird er alles hundertfach bezahlen. Um wie viel mehr, wenn wir ihm sagen können: „Wir haben Dich nicht bloß in der Person der Armen bekleidet und beherbergt, sondern im hochheiligen Sakrament des Altars Dich selbst in eigener Person!“ Doch lassen wir einmal die Aussicht auf Verdienst und Lohn beiseite!
Ist es nicht eine große Ehre, den König der Könige beschenken zu dürfen? Nicht jeder dürfte sich herausnehmen, einem irdischen König ein Geschenk anzubieten. Und ist es nicht auch eine Quelle des Trostes, dem ein Opfer zu bringen, der sich in seiner grenzenlosen Liebe fort und fort für uns opfert, bei uns wohnt und sich uns ganz schenkt in der heiligen Kommunion? Wer von einem lebendigen Glauben an Christi Gegenwart im hochheiligen Sakrament durchdrungen ist, und noch mehr, wer ihn wahrhaft liebt, der wird sich auch ohne Rücksicht auf den zu erwartenden Lohn angetrieben fühlen, sein Möglichstes zu tun, auf dass die Darbringung des heiligen Messopfers und die Aufbewahrung des hochheiligen Sakramentes in geziemender Weise geschehen kann. Oder soll der König in einer Hütte wohnen und in Lumpen gehüllt sein, während viele seiner Untertanen in Palästen leben und es ihnen an gar nichts fehlt? Es gibt aber manche Kirchen, die leider oft nur zu sehr ähnlich sind jenem Stall, in dem der Sohn Gottes zum ersten Mal als Mensch erschienen ist. Und es gibt manche Kirchen, wo es auch in Bezug auf innere Einrichtung und Ausstattung gar schlecht bestellt ist, sogar bezüglich dessen, was zum hochheiligen Altarsakrament in allernächster Beziehung steht. Da ist manchmal der Altar, in dem der Tabernakel sich befindet, ganz morsch und zerrüttet, und niemand gibt ein Scherflein zu einem neuen, oder auch nur zu einer Reparatur. Da sind die heiligen Gefäße aus unedlem Metall oder von schlechter kunstloser Arbeit. Da stehen zwischen hässlichen Leuchtern alte, verstaubte und verderbliche Blumensträuße. Da sind die Corporalien, worauf bei der heiligen Messe die heilige Hostie ruht, die Kelchtüchlein, die Altar- und Kommuniontücher verbraucht und geflickt. Da muss der Priester vielleicht in einer Albe an den Altar treten, wiewohl das Verbot der Kirche entgegensteht. Da sind die Messgewänder von geschmackloser Form, von billigem Stoff, verschlissen oder gar zerrissen. In der ewigen Lampe brennt übelriechendes Petroleum – und das alles oft aus keinem anderen Grund, als weil die Kirche zu arm ist, um dem abzuhelfen, und weil niemand etwas beisteuert. Das ist gewiss kein gutes Zeichen für eine Pfarrei, wo so etwas vorkommt. Denn es gibt selten eine Gemeinde, die so arm wäre, dass sie nicht wenigstens das Notwendigste beschaffen könnte, um das hochheilige Sakrament mit Würde und Anstand und nach den Vorschriften der Kirche zu behandeln. Man kann sagen, dass die Opferwilligkeit hinsichtlich der Sorge für das Haus Gottes der Maßstab für den Glauben eines Volkes und einer Pfarrei ist. Dass unsere Vorfahren im Mittelalter so prächtige Kirchen gebaut und sie so großzügig mit allem, was zu einem würdigen Gottesdienst gehört, ausgestattet haben, das hatte in nichts anderem seinen Grund, als in ihrem lebendigen Glauben.
Leider gibt es heute viele Christen, die für die Ausschmückung der Kirchen kein Verständnis mehr haben. Wenn sie auch für andere gute Zwecke noch etwas geben – für unsern Heiland im hochheiligen Sakrament haben sie nichts übrig. „Gebt den Armen Almosen“, sagen sie, „die Kirchen brauchen nichts; es ist genug, wenn man Gott innerlich recht verehrt. All dieser verschwenderische äußere Aufwand ist Gott selbst zuwider.“ Einem Protestanten könnte man solches Gerede nachsehen, aber einem Katholiken nicht; denn es ist die Lehre der katholischen Kirche, dass wir Gott nicht bloß im Herzen, sondern auch äußerlich zu ehren verpflichtet sind. Gerade darum hat sie ja die vielen Zeremonien eingerichtet und angeordnet, dass wir uns auch an dem gemeinsamen öffentlichen Gottesdienst beteiligen. Und zudem, woher wissen denn jene, dass der äußere, verschwenderische Aufwand, wie sie es nennen, Gott selbst zuwider ist? Ich meine, aus der heiligen Schrift geht gerade das Gegenteil hervor. Einst trat eine Frau zu Jesus hin und salbte seine heiligen Füße mit kostbaren Nardenöl, um ihm ihre Liebe und Ehrfurcht zu bezeugen. „Wozu diese Verschwendung?“ murrte da der geizige Judas, „man hätte die Salbe um mehr als dreihundert Denare verkaufen und den Erlös den Armen geben können.“ Hat nun Jesus etwa dem Judas zugestimmt? Nein, er nahm die Frau in Schutz und spendete ihr das höchste Lob. „Lasst sie nur“, sprach er, „was sie an mir getan hat, ist recht; und wo immer dieses Evangelium verkündet werden wird, da wird man auch diese Tat zu ihrem Lob erzählen.“ (Matthäus 26,6-13; Johannes 12,1-8) Diese Weissagung Jesu hat sich genau erfüllt. Wenn nun Jesus damals den äußeren Aufwand billigte, warum sollte er ihn jetzt verschmähen?
________________________________________________________________________
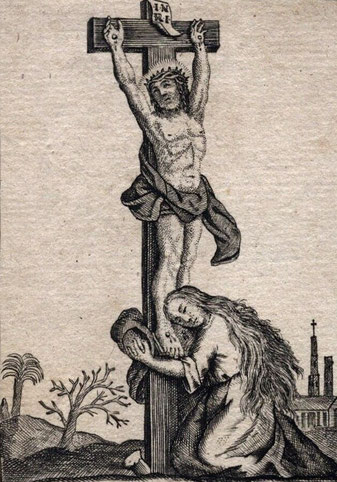
4. Allmächtig und allwissend
Es waren einmal zwei Kinder am Streiten, was sie sich wählen würden, wenn sie aus den Eigenschaften Gottes eine für sich nehmen dürften. Das Mädchen wollte lieber allmächtig sein, denn dann könnte es immer befehlen und sich auch nach Belieben alle Spielsachen bescheren. Der Junge wünschte sich die Allwissenheit, denn dann brauchte er nicht mehr zu lernen und könnte überdies hübsch allem zuschauen, was auf der Welt vor sich ginge. Und beide beharrten mit Eifer auf ihre Meinung, das Beste gewählt zu haben.
Du lachst vielleicht darüber. Wenn du aber in das Leben der sogenannten „großen Leute“ schaust, und zwar gerade auf jene, die etwas Großes leisten wollen, so findest du ein ähnliches Streben wieder. Die einen wünschen möglichst viel Macht, um ihrem Willen Geltung zu verschaffen, die andern wollen ein möglichst glänzendes Wissen. Und mancher kleine oder große Machthaber fühlt sich dabei wie eine Art Miniatur-Herrgott, und mancher kleine oder große Gelehrte wie eine Art Sonne, die alles ringsum beleuchtet.
Es ist ja auch etwas Schönes um den Adel der menschlichen Gedanken und um die Wissenschaft. Sehr köstlich versucht das Abraham a Santa Clara zu zeigen. Er sagt: „Ich habe mit absonderlichem Fleiß die heilige Bibel durchblättert, und in derselben gefunden das Wort Ackersmann 36 mal, das Wort Acker 314 mal, das Wort Säen 20 mal, das Wort Wachsen 500 mal, das Wort Korn 57 mal, das Wort Einschneiden 52 mal, das Wort Teuer 21 mal, das Wort Dreschen 15 mal, das Wort Heu 48 mal, aber das Wort Stroh nur ein einziges mal, und zwar nicht mit absonderlichem Lob, weil die Rachel darauf gesessen hat, als sie die goldenen Götzenbilder ihrem Vater Laban verborgen hat; weil dann kaum einmal das Wort Stroh in göttlicher Schrift anzutreffen ist, darf ich schier mutmaßen, dass selbiges für sehr verächtlich gehalten sei.
So geringfügig nun ein Stroh ist, also soll auch ein plumper und dummer Strohkopf geschätzt werden, indem derselbe nur Seel halber das Konterfei eines Menschen führt, im Übrigen den vernunftlosen Tieren nicht ungleich erscheint.
Ein Stuben ohne Tisch,
Ein Teich ohne Fisch,
Ein Schiff ohne Ruder,
Ein Zech ohne Bruder,
Ein Schreiber ohne Feder,
Ein Schuster ohne Leder,
Ein Bauer ohne Pflug,
Ein Hafner ohne Krug,
Ein Soldat ohne Gewehr,
Ein Mensch ohne Lehr‘,
Sind alle nicht weit her.“
Was ist doch dein Kopf für ein kleines Ding, nicht größer als ein Kürbis. In die Kürbisschale kannst du Wasser gießen, und dann ist sie gleich voll, und es geht mit dem besten Willen nichts mehr hinein, ohne dass sie überläuft. Dein Kopf aber mit seinem unermüdlich arbeitenden Gehirn nimmt eine ganze Welt in sich auf, die viel tausendmal größer ist als er selber.
Bist du auf einer Fußtour einmal zu einer hübschen Gegend, einem Aussichtsturm, einem alten Schloss gewandert und hast mit Staunen die Schönheit angesehen, - schwupp, hast du auch schon ein Bild davon in deinem Kopf, und wenn du willst, kannst du es dir wieder vor die Einbildung zaubern. Und hast du ein schönes Lied singen hören, wie wir ja so viele herrliche besitzen, und hat sich die Melodie an dein Ohr geschmeichelt, vielleicht mehrmals, und siehe da, sie sitzt auch schon in deinem Kopf und geht nicht mehr hinaus. So wandert alles, was dir am Tag vor die Sinne kommt, was du selber sprichst und tust, in deinen Kopf hinein, so dass sich darin schließlich eine ganze Gemäldegalerie findet, so großartig und fein und mannigfaltig, wie keine Kunstausstellung auf Erden es bieten kann. Und das alles im kleinsten Raum zusammengedrängt, ohne dass eines das andere hindert.
Das ist nicht bloß ein wunderbarer Speicher, das ist auch eine noch wunderbarere Werkstätte. Denn zwischen den aufgeschichteten Schätzen wandert ein Werkmeister, Verstand, auf und ab, von einem Ding zum andern, und schaut alles wohl an und prüft und ordnet es, das Gleiche zum Gleichen, den Anfang zur Fortsetzung, die Ursache zur Wirkung, das Mittel zum Ziel. Er überlegt, zu was alles verwertbar sei, wirft das Nutzlose auf den großen Schutthaufen der Vergessenheit, und weist seinem Bruder und Geschäftsteilhaber, dem Willen, die rechte Verwendung an.
O wenn man in so einen kleinen Menschenkopf hineinschauen könnte, das wäre der sehenswerteste Anblick auf Erden.
Nun denke dir aber erst einmal Gottes Geist, der eine Unendlichkeit umspannt und der alle Dinge der Welt in sich fasst, wie das Weltenmeer ein Tröpflein! All die Millionen Menschenköpfe mit ihrer wunderbaren Innenwelt stehen auch in seinem Geist und verschwinden darin, wie ein Sandkörnchen im Weltall. Was muss das für ein Reichtum im Geist Gottes sein, wenn er mit einem einzigen Blick sich selbst und seine Herrlichkeit durchschaut.
Und diesen Geist Gottes wirst du einst schauen, wie er ist. Und alles, was sich in ihm spiegelt, also auch die kleine Welt, die vielen Menschen darauf und ihr Tun, was sie Weltgeschichte nennen, und ihr Wissen und noch vieles andere, was über Menschheit und Engelwelt hinausragt, - alles wirst du schauen, wenn du ein Gotteskind geblieben bist und die heiligmachende Gnade bewahrt hast.
Hast du einmal erklärt bekommen, wie wunderbar es zugeht, wenn dein Auge, das doch fest im Kopf sitzt, auf einmal mit dem Berg in Verbindung steht, der stundenweit entfernt liegt und ihn sieht. Nicht? Dann will ich dich nur auf eines aufmerksam machen. Von allem, was du siehst, hast du ein sichtbares Spiegelbild in deinem Auge. Wenn dir z.B. jemand ins Auge schaut, blickt ihm sein eigenes Bild daraus entgegen, wie aus einem Spiegel. Und dieses Bild ist es, das den Eindruck auf deinen Sehnerv macht und ihn sehen lässt.
Nun kommt die Anwendung. Wenn du einmal gestorben bist, dann ist deine Seele wie ein großes geistiges Auge. Und wenn sie dann die heiligmachende Gnade besitzt, gibt ihr Gott einen unaussprechlich vollkommenen Sehnerv, den wir das „Licht der Glorie“ nennen. Und auf diesen Sehnerv prägt Gott als unendliches Bild zum Anschauen sich selber, soweit ein geschaffener Geist Gott fassen kann, oder besser gesagt, er versenkt sich in diesen Sehnerv ganz hinein. Dann schaust du Gott, wie er ist, mit einem großen, tiefen, ewigen Blick und schaust in ihm die ganze Welt, und je länger du schaust, um so herrlicher wächst dir sein Licht. Und wenn du auf Erden der einfachste Arbeiter, das schlichteste Dienstmädchen warst, und wenn dein Kopf auf Erden ungelehrt und beschränkt war, nun hast du eine Fülle von Erkenntnis, die der gelehrteste Forscher auf Erden nicht zu ahnen vermag.
So spiegelt sich im Himmel die Allwissenheit Gottes in seinen Kindern.
Aber auch schon hier auf Erden sendet dieser Glanz sein Licht voraus, wenn es auch erst ein Sternenlicht bei nächtlichem Himmel ist.
Hier auf Erden ist der Gesichtskreis unserer Erkenntnis sehr beschränkt. Aber Gott hat ihn auf übernatürliche Weise für seine Kinder erweitert durch die Offenbarung. Wer mit gläubigem Herzen die Offenbarung Gottes annimmt, der wächst über sich selbst und die Welt hinaus, als säße er in einem gewaltigen Flugzeug, das immer höher und höher schwebte, während ringsum immer neue Bergspitzen hinter dem Rücken der bisher gesehenen auftauchen. O wie klar und übersichtlich liegen dann die Geheimnisse des Himmels und der Erde vor uns, und was die Erdenforscher, die sich nur auf die eigene Kraft verlassen wollen und deshalb in der Tiefe bleiben, nie ergründen, was sie „Welträtsel“ nennen, steht offenbar und sicher vor den Augen des Glaubens; es wird uns alltäglich und vertraut.
Nur ein Beispiel. Ein moderner Weltschmerzdichter sagt: „O löst mir das Rätsel des Lebens, das qualvoll uralte Rätsel, worüber schon manche Häupter gegrübelt, Häupter in Hieroglyphenmützen, Häupter in Turban und schwarzem Barett, Perückenhäupter und tausend andere arme schwitzende Menschenhäupter. – Sagt mir, was bedeutet der Mensch? Woher ist er kommen? Wo geht er hin? Wer wohnt da oben auf goldenen Sternen?“
Jener Dichter erwartete die Antwort am Meeresstrand von den Wogen und den nächtlichen Sternen. Und da sie ihm schwiegen, brach er in Schmähung aus. Wie erhaben lautet da die Antwort, die jedes kleine katholische Dorfkind ihm hätte geben können, das seine erste Katechismusfrage gelernt hat: „Ich bin auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen.“ Und wenn das Kind auch nur die erste Seite der Bibel gelernt hatte, konnte es antworten: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“
Hat Gott ein solches Kind nicht groß und weise gemacht, zur Beschämung jener Menschen, die „nicht glauben wollen, was sie nicht selber sehen“, und die deshalb ewig unwissend bleiben und sprechen: „Ignoramus et ignorabimus. – Wir wissen es nicht und werden es nie wissen!“
Du aber schätze im Erdental schon das schlichte Licht des Glaubens, wie wir zur Nachtzeit das gedämpfte Licht der Sterne schätzen; dann hast du beim ewigen Morgengrauen ein Recht, den vollen Glanz der Sonne zu schauen.
________________________________________________________________________

5. Ablass
Da über den Ablass so viele falsche Vorstellungen verbreitet sind, so sollen hier einige Bemerkungen über den Begriff, die Geschichte, die Arten und Bedingungen des Ablasses gesagt werden.
1. Der Ablass ist die Umwandlung der verdienten zeitlichen Sündenstrafen in eine entsprechende leichtere Genugtuung, oder – was dasselbe ist – der Ablass ist eine außerhalb des Bußsakramentes erteilte Nachlassung derjenigen zeitlichen Sündenstrafen, die wir nach bereits vergebener Sünde entweder hier oder im Fegfeuer noch abbüßen sollten. Es wird demnach durch den Ablass weder eine Sünde vergeben, noch die ewige Strafe, für die Christus das Bußsakrament eingesetzt hat. Zudem müssen gewisse gute Werke, wie Beten, Fasten, Almosengeben, Kirchbesuch u. a. verrichtet werden, um einen Ablass zu gewinnen. Die Kirche schöpft die Gnade des Ablasses aus dem Schatz der Verdienste Christi und der Heiligen, die unendlich mehr getan haben, als Gott von ihnen verlangte. Die Lehre vom Ablass ist trotz der heftigen Kritik an ihr durchaus vernünftig und tröstlich. Wenn eine hochgestellte und verdienstvolle Person beim König für einen Verbrecher Fürsprache einlegt, so erteilt der König um seines treuen Beamten willen dem Verbrecher einen teilweisen oder gänzlichen Nachlass der Strafe. Das ist ein Ablass. Sollte das dem unmittelbaren Stellvertreter Gottes, dem Oberhaupt der Kirche, nicht gestattet sein? Der Kirche ist die Gewalt zu binden und zu lösen erteilt. Kann sie von der Sünde freisprechen, dann umso mehr von den Sündenstrafen.
2. Der Ablass ist so alt, wie die Kirche. Selbst im Alten Bund finden wir Spuren davon. Gott ließ durch seinen Propheten Jona der sündigen Stadt Ninive den Untergang ankündigen. Als aber die Einwohner in Fasten und Trauern Buße taten, verschonte sie der Herr. Der Apostel Paulus erließ dem aus der Kirchengemeinschaft gestoßenen Blutschänder zu Korinth die rückständige Buße und nahm ihn wieder in die Gemeinschaft der Christen auf, weil er einen außerordentlichen Bußeifer zeigte. (2 Kor 2) Das war ein vollkommener Ablass. Zur Zeit der Verfolgungen baten die Sünder insbesondere die Märtyrer um ihre Fürsprache und es wurde ihnen ein vollkommener Ablass erteilt, wie uns der heilige Cyprian berichtet. – Die Gründe, warum Ablässe erteilt wurden, waren entweder ein besonderer Bußeifer oder die Fürsprache erprobter Diener Gottes. Um der Fürsprache Abrahams willen erklärte Gott die Strafe von Sodom abzuwenden, wenn sich noch zehn Gerechte dort fänden. Demgemäß konnte eine Nachlassung eintreten, wenn ein Büßer durch Zerknirschung, Verdemütigung, strenge Bußwerke und gute Handlungen eine aufrichtige Besserung bewies, oder auch, wenn fromme Gläubige, besonders die Märtyrer, einen Büßer des Nachlasses würdig erklärten, und für ihn Fürsprache einlegten. Außerdem wurden Ablässe erteilt für ausgezeichnete, der Ausbreitung der Kirche und dem Wohl der Menschheit förderliche Werke. So erhielten die Kreuzfahrer einen vollkommenen Ablass, jedoch nur unter der Bedingung, dass sie aus reiner Absicht zur Befreiung des Heiligen Landes kämpften. Oft wurden Ablässe erteilt für die, die sich an dem Bau eines Tempels oder Hospitals oder anderer gemeinnütziger Werke durch freiwillige Beisteuer beteiligten. Als im Lauf der Jahrhunderte der christliche Bußeifer erkaltete, minderte die Kirche die Strenge der Bußwerke und verwandelte sie durch Ablässe in leichtere Genugtuungswerke.
3. Die Ablässe werden eingeteilt in vollkommene Ablässe und Teilablässe, je nachdem die zeitlichen Sündenstrafen ganz oder nur teilweise aufgehoben werden. Bis ins elfte Jahrhundert werden vollkommene Ablässe meistens nur Sterbenden gewährt, heutzutage können viele vollkommene Ablässe auch von Gesunden gewonnen werden. – Die Ablässe für Lebende kann jeder nur für seine Person gewinnen, die Ablässe für die Verstorbenen werden ihnen fürbittweise zugewandt. – Der Ablass ist weiter ein örtlicher oder sächlicher oder persönlicher d.h. er kann gebunden sein an einen bestimmten Ort z.B. Kirche oder Altar, oder an bestimmte Sachen z.B. Rosenkränze, Kreuze, Medaillen, oder an bestimmte Personen z.B. Geistliche, Mönche, Mitglieder einer Bruderschaft. – Der Dauer nach ist der Ablass entweder auf eine bestimmte Zeit beschränkt oder er gilt für alle Zeiten. Zu den ersten gehört der Jubiläumsablass, der sich von anderen vollkommenen Ablässen nur durch besondere Feierlichkeiten und erweiterte Vollmachten für die Beichtväter unterscheidet. Ein Ablass von einer Quadragene ist die Nachlassung einer zeitlichen Strafe, für die in den ersten christlichen Jahrhunderten 40 Tage streng gefastet und gebüßt werden musste.
4. Die Bedingungen, um eines Ablasses teilhaftig zu werden, sind der Gnadenstand und die Erfüllung der vorgeschriebenen Werke. Demnach muss das Bußsakrament vorher gültig und würdig empfangen werden, und es müssen die Bestimmungen der Kirche z.B. Fasten, Beten, Almosen, Besuch gewisser Kirchen, beobachtet werden. – Gebrauchen wir fleißig dieses erwünschte Mittel, um die zeitlichen Strafen der Sünde auszutilgen! Unsere Mutter Kirche überhäuft uns mit den überschwänglichen Gnaden der Ablässe, damit keiner der strengen Gerechtigkeit, sondern jeder der Liebe des himmlischen Vaters anheimfalle.
________________________________________________________________________

6. Auferstehung des Leibes
Was für ein Jubel wird es dereinst für die Gerechten sein, wenn auf den Schall der Posaune die Gräber sich öffnen, und alle Gläubigen, die im Tod schmerzlich voneinander getrennt wurden, sich wiedersehen, um ein Leben ohne Trauer und Ende, voll Freude und Seligkeit zu beginnen! Der Glaube an die Auferstehung des Leibes ist eine Grundlehre unseres Glaubens und unserer Hoffnung im Tod. Fragen wir:
1. Was lehrt die Kirche über die Auferstehung?
2. Wozu verpflichtet uns diese Lehre?
1. Den Glauben an die Auferstehung des Fleisches lehrt uns das Alte und das Neue Testament. Der fromme Hiob tröstete sich in seiner schmerzlichen Prüfung mit der Hoffnung auf seine einstige Auferstehung: „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass ich am Jüngsten Tag von der Erde auferstehen werde. Ich werde wieder mit dieser meiner Haut umgeben werden und in diesem Fleisch meinen Gott schauen.“ (Hiob 19,25-26) Der Prophet Jesaja spricht dieselbe Hoffnung aus: „Wie der Morgentau die erstorbenen Pflanzen erquickt und neu belebt, so bringt der Geist Gottes Leben in die erstorbenen Gebeine.“ (Jes 26,19) Der Prophet Ezechiel sah im Geist in einem Tal viele Totengebeine, und auf Befehl Gottes wurden diese Gebeine wieder belebt, mit Fleisch und Blut umgeben, und der Geist Gottes stellte sie als ein großes Heer dar. Ebenso spricht Daniel: „Die Menge derer, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen; einige zum ewigen Leben, die anderen zur Schmach, um sie ewig zu schauen. Die aber Erleuchtete waren, werden leuchten wie der Glanz des Firmamentes, und die viele in der Gerechtigkeit unterwiesen, wie Sterne immer und ewig.“ (Dan 12,2-3) Der Glaube an ihre Auferstehung tröstete die Makkabäischen Brüder bei ihren Martern. – Im Neuen Bund versichert die ewige Wahrheit: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird ewig leben, und wer da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.“ (Joh 11, 25-26) Wie Jesus selber von den Toten auferstanden ist, so wird er auch dereinst die Toten erwecken. „Es kommt die Stunde, wo alle, die in den Gräbern ruhen, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichtes.“ (Joh 5,28-29) – Wie aber die Toten auferstehen werden, beantwortet uns der Apostel Paulus: „Gesät wird der Leib in Verweslichkeit, auferstehen wird er in Unverweslichkeit; gesät wird er in Unehre, auferstehen wird er in Herrlichkeit; gesät wird er in Schwachheit, auferstehen wird er in Kraft; gesät wird ein tierischer Leib, auferstehen wird ein geistiger Leib.“ (1 Kor 15) – Was uns die stete Lehre der Kirche, gestützt auf unzweideutige Aussprüche der ewigen Wahrheit, als Glaubenssatz hinstellt, muss die Vernunft billigen. Hat der Leib als das Werkzeug der Seele gute oder böse Werke vollbracht, so ist es billig, dass er auch am Lohn oder der Strafe teilnehme.
2. Wozu verpflichtet uns denn die Lehre von der Auferstehung des Fleisches? Wollen wir einst mit Christus verklärt und verherrlicht werden, so müssen wir im Leben hier ihm ähnlich werden, indem wir unser Fleisch samt seinen Gelüsten kreuzigen und seinen Tugenden nacheifern. Auf diesem Weg der Selbstverleugnung und der Leiden sind dem Heiland seine Apostel und alle Heiligen nachgefolgt. „Ich züchtige meinen Leib“ – spricht der Apostel Paulus (1 Kor 9,27) – „und bringe ihn in die Dienstbarkeit, damit ich nicht etwa, nachdem ich anderen gepredigt habe, selber verworfen werde.“ – Darum konnte er auch mit Freuden der Ankunft Christi entgegensehen. Alle Heiligen sind auf dem Weg der Entsagung und Kreuzigung ihres Fleisches in den Himmel eingegangen. Damit haben sie uns gelehrt, was auch wir tun müssen, um dereinst glorreich aufzuerstehen. Je mehr wir den sündigen Gelüsten frönen, desto weniger dürfen wir auf dereinstige Verklärung hoffen, je mehr wir aber die Begierden des Fleisches unterdrücken, desto besser bereiten wir unsere Verherrlichung vor. Entweihen wir darum nicht unsern Leib, der ein lebendiger Tempel des Heiligen Geistes ist. Gedenken wir stets unserer Würde als Christen. Gebrauchen wir alle Mittel der Heiligung, insbesondere das heilige Altarsakrament, denn der Herr hat das ewige Leben und die selige Auferstehung daran geknüpft. Beachten wir die Mahnung des Apostels: „Die Gnade Gottes, unseres Heilandes ist allen Menschen erschienen, und lehrt uns, dass wir die Gottseligkeit erstreben, den weltlichen Gelüsten entsagen, sittsam, gerecht und gottselig leben in dieser Welt, indem wir erwarten die selige Hoffnung und die Ankunft der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus.“ Amen.
________________________________________________________________________

7. Arbeitsamkeit
Nach der Regel des heiligen Benedikt wechselt Arbeit mit Gebet. Während die Priester vorzugsweise geistigen Arbeiten obliegen, beschäftigen sich die Laienbrüder mit körperlichen Arbeiten, und dadurch sind die Benediktiner die Pioniere der Kultur in allen Ländern der Welt geworden. „Bete und arbeite!“ ist der Grundzug nicht allein des geistlichen, sondern auch eines jeden christlichen Lebens. Beachten wir besonders die Tugend der Arbeitsamkeit. Wir sind 1. Zur Arbeit geschaffen und verdienen durch sie den Unterhalt. Wir sind 2. Zur Arbeit verurteilt und wirken durch sie Buße.
1. „Der Mensch ist zur Arbeit geboren, wie der Vogel zum Flug.“ (Hiob 5,7) Jedes Geschöpf ist tätig und sucht sein Dasein zu erhalten. Hört diese Tätigkeit auf, so tritt der Tod ein, in dem Stein, der verwittert, in der Pflanze, die verwelkt, in dem Tier, das vergeht. Solange die Pflanze die gedeihlichen Säfte aufsaugt, solange der Vogel seine Flügel schwingt und die ihm angewiesene Nahrung aufsucht, erhält sich in ihnen das natürliche Leben. Tätigkeit ist für die ganze Natur ein notwendiges Gesetz, für den Menschen ist sie ein moralisches Gesetz, das er befolgen soll, um sich des Lebens würdig zu zeigen. „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.“ (2 Thess 3,10) Selbst unsere Stammeltern im Paradies mussten arbeiten. Sie sollten die Annehmlichkeiten des anmutigen Lustgartens nicht genießen, ohne durch Arbeit sie einigermaßen zu verdienen. Dürfte ich es wagen, ein träges, untätiges Leben zu führen, und doch im Überfluss mich sättigen zu wollen? Wie viele Menschen quälen sich vom frühen Morgen bis in die späte Nacht, um nur den notdürftigsten Unterhalt zu gewinnen, und müssen in Sorgen und Kummer von einem Tag zum andern leben, obgleich sie fleißiger, schwerer und geduldiger arbeiten, als ich. Möchte ich doch freudig meinen Unterhalt verdienen, ohne auf die Beschwerden zu achten.
2. Wir sind zur Arbeit verurteilt, durch sie wirken wir Buße. Sobald der erste Mensch von der verbotenen Frucht genossen hatte, sprach Gott das Urteil: „Verflucht sei die Erde in deinem Werk. Mit viel Arbeit sollst du essen von ihr alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln soll sie dir tragen, und du sollst das Kraut der Erde essen. Im Schweiß deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du zur Erde zurückkehrst, von der du genommen bist.“ (Gen 3) Ein schrecklicher Fluch, der von unserem Stammvater auf alle seine Nachkommen übergegangen ist. Wir alle sind zur Arbeit verurteilt, nicht zur Kurzweil und zum Zeitvertreib. Im Schweiß des Angesichtes sollen wir unser Brot verdienen. Erfüllen wir treu unsere Pflicht, so können wir für unsere Sünden genugtun. Der heilige Paulus arbeitete unter unsäglichen Beschwerden, Anstrengungen und Schwierigkeiten in seinem Apostolat. Dennoch fand er Zeit durch Teppichweberei sich den nötigen Unterhalt zu erwerben, und übte so seine eigene Mahnung: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.“
Ach, wie oft schaudere ich vor jeder Mühe und Anstrengung zurück. Wohl will ich mich noch beschäftigen, aber es soll keine Überwindung kosten. Wie beschämt mich das Beispiel von vielen Heiligen, die oft noch im hohen Alter unermüdlich in ihren schweren Berufen arbeiteten. Wie beschämt mich das Beispiel unzähliger Christen, die viel besser und fleißiger als ich arbeiten, und doch viel geringeren Lohn erhalten. O Herr, verzeih mir meine Trägheit, meine Unzufriedenheit. Ich will arbeiten, weil du mich dazu erschaffen hast. Ich will mit Überwindung arbeiten, weil ich dadurch für meine Sünden büßen muss. Die Ruhe geziemt den Verklärten des Himmels, dem Sünder auf Erden geziemt die Arbeit. As willst du, Herr, das ich tun soll?
________________________________________________________________________

8. Aberglaube
Moderner Aberglaube
„Wo kein Glauben ist, da ist Aberglauben“, sagt ein geflügeltes Wort. Und dabei braucht man gar nicht so sehr an das „Finstere Mittelalter“ zu denken, denn auch in unserer modernen Zeit ist – trotz Raumfahrt, Computertechnik und Digitalisierung – noch gar manches dunkel, und wir finden einen abgrundtiefen Aberglauben bei vielen Leuten, ob gebildet oder nicht, ob reich oder arm. Wenn auch nur wenige Menschen wieder an Hexen glauben, so finden wir bei vielen neben Esoterik und anderen Modereligionen den Glauben an die Sterne. „Den Himmel überlassen wir den Spatzen“, haben einmal Kritiker des katholischen Glaubens gesagt, aber die gleiche Sorte von Leuten klammert sich in ihrer Weglosigkeit und ihrer Ratlosigkeit an die Sterne, an das wenige, das die Menschheit überhaupt von den Sternen weiß. Hier wird das Magische und das Mystische zu einer wahren Ersatzreligion, die um so schwerer zu widerlegen ist, als sie zuletzt für solche Menschen zur Gefühlssache, zur Glaubensangelegenheit wird. Dass dieser Aberglauben in allen Bevölkerungsschichten zu finden ist, zeigt uns ein Blick in zahlreiche unserer Illustrierten, Wochenzeitschriften, Tageszeitungen, Fernsehprogramme und Internetseiten, welche ihren Lesern und Zuhörern mit derlei Sachen aufwarten. „Die Welt will betrogen sein“, sagt ein anderes bekanntes Wort.
Die Astrologie ist neben oder mit der Esoterik die heute verbreitetste Form des modernen Aberglaubens. Sie entspringt der Zukunftslüsternheit und den Wunschträumen des heutigen Menschen. Sie ist das Zeichen der inneren Leere und der seelischen Not. Sicher ist auch das moderne Lotteriewesen schuld an diesem Bestreben, in die Geheimnisse der Zukunft einzudringen und dem blinden Schicksal etwas nachzuhelfen. Von dieser Astrologie des einfachen Menschen rückt die sogenannte „wissenschaftliche“ Astrologie entschieden ab. Diese will die Sterndeutung neu aufbauen und als Hypothese in die Wissenschaft einführen. Die Astrologie lehrt die Einwirkung von kosmischen Strahlungen, als solche von den Sternen, Sonne, Mond, den Planeten und von ihren Einflüssen auf den Menschen. Die Stellung der Gestirne bei der Geburt eines Menschen soll auch sein Lebensschicksal in sich schließen. Man nennt dies bekanntlich ein Horoskop.
Bei kritischer Beleuchtung der astrologischen Regeln stößt man auf ein bedenkliches Durcheinander symbolischer, rationaler und moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse. Zudem ist heute erwiesen, dass die alten Völker, wie zum Beispiel die Babylonier, ganz andere Deutungsregeln hatten als die modernen Astrologen. Damit ist auch die Illusion zerstört, dass es sich in der Sterndeutung um ein Urwissen der Völker handelt und dass die astrologischen Regeln aus einer Zeit herrühren, in der die Menschen noch derart naturverbunden waren, dass sie die Gestirnausstrahlungen unmittelbar empfingen und gleichsam spürten, wie etwa „Venus“, „Saturn“ oder „Steinbock“ wirkten. Demnach müssten auch alle Urvölker, wie Chinesen, Hindus, Ägypter usw. dieselben Deutungsregeln haben. Nach der Völkerkunde sind aber selbst die Hauptelemente ihrer Sterndeutung verschieden. Damit ist auch eine andere wesentliche astrologische These wissenschaftlich unhaltbar geworden.
Das gleiche gilt auch von den Grundelementen des Horoskops: dem Himmelsgewölbe, den Tierkreiszeichen, den Planeten; sie sind eine reine Annahme und nichts als eine willkürliche Zusammenfassung scheinbar einander naheliegender Gestirne zur Orientierung am Sternhimmel. Die Sterne des Großen Bären zum Beispiel gehören ganz verschiedenen Sternströmungen an; sie fließen auseinander, und in fünfzigtausend Jahren werden sich ganz andere Gruppierungen ergeben. Wie soll da ein Mars einen Widder, Venus und Stier oder Merkur die Jungfrau regieren?
Das Christentum sah von Anfang an (Paulus im Galaterbrief 4,10) den Sternenkult als das Erbe der heidnischen Antike und als Verrat am Vorsehungsglauben an. Und wenn die Katholische Kirche auch der sogenannten „wissenschaftlichen“ Astrologie mit einer großen Reserve gegenübersteht, so tut sie dies nicht nur, um sich nicht selber in ein wirres Chaos zu verlieren, sondern auch aus einem Gebot pastoraler Klugheit heraus, nämlich um nicht die schier unübersehbare Schar der Astrologen in ihrem dunklen Gewerbe zu unterstützen und so mitzuhelfen, die Massen an die Kioske und die digitalen Verkaufsstände astrologischen Schwindels zu treiben. Erfreulicherweise haben auch Freikirchen, Evangelikale und Pfingstkirchen dieser vom christlichen Denken emanzipierten Astrologie den schärfsten Kampf angesagt.
Katechismus der Katholischen Kirche (2116) von 1993:
„Sämtliche Formen der Wahrsagerei sind zu verwerfen: Indienstnahme von Satan und Dämonen, Totenbeschwörung oder andere Handlungen, von denen man zu Unrecht annimmt, sie könnten die Zukunft „entschleiern“ (vgl. Dtn 18,10; Jer 29,8). Hinter Horoskopen, Astrologie, Handlesen, Deuten von Vorzeichen und Orakeln, Hellseherei und dem Befragen eines Mediums verbirgt sich der Wille zur Macht über die Zeit, die Geschichte und letztlich über die Menschen, sowie der Wunsch, sich die geheimen Mächte geneigt zu machen. Dies widerspricht der mit liebender Ehrfurcht erfüllten Hochachtung, die wir allein Gott schulden.“
________________________________________________________________________

9. Antichrist
Wie wird der Antichrist sein?
Man redet heute viel von dämonischen Dingen und Menschen, ohne jedoch ernstlich an einen Dämon zu glauben. Dies ist aber unbedingt notwendig, um die Figur des Antichrist und seine Herrschaft verstehen zu können. Es gibt Dämonen, reine Geistwesen, gefallene Engel, welche in die Menschengeschichte hineinwirken. „Der Böse“ wird in der Hl. Schrift der „Fürst dieser Welt“, der „Gott dieser Welt“ genannt. Das eigentliche Thema der Weltgeschichte ist der Kampf um Christus: Wenn die am Ende der Zeit den Schauplatz der Geschichte beherrschende Figur der Antichrist ist, dann ist eine eindeutig auf Christus bezogene Gestalt der Hauptakteur der letzten Epoche.
Wie der Märtyrer, innergeschichtlich gesprochen, eine Figur der politischen Ordnung ist, so ist auch der Antichrist eine Erscheinung des politischen Bereichs. Der Antichrist ist nicht so etwas wie ein „Häretiker“, nicht ein Ketzer, der nur kirchengeschichtlich von Belang wäre und von dem die übrige Welt gar nicht Notiz zu nehmen brauchte. Weltliche Macht ist das eigentliche Instrument des Antichristen, er ist weltlicher Machthaber. Damit ist noch etwas anderes ausgesagt: Das Ende wird nicht in dem Sinne Chaos sein, dass etwa eine Vielzahl von geschichtlichen Kräften gegeneinander stünden und allmählich eine Auflösung der Strukturen und endlich die Verwesung herbeiführten, sondern am Ende steht ein mit ungeheurer Macht ausgestattetes Herrschaftsgebilde. Am Ende der Geschichte steht eine durch Machtausübung aufrechterhaltene Pseudoordnung. Die Kennzeichnung „Pseudoordnung“ ist auch in dem Sinn gültig, dass die „Täuschung“ Erfolg hat; es ist ein Element der Prophetie vom Ende, dass die „Ordnungs-Wüste“ des Antichristen für ein wahres, echtes Ordnungsgebilde gehalten wird. Die Vorstellung eines rein organisatorischen Sozialgehäuses, in welchem alles „Technische“, von der Gütererzeugung bis zur Hygiene, „glatt funktioniert“, liegt der zeitgenössischen Erfahrung nicht zu fern.
Der Antichrist ist zu denken als eine Figur der über die ganze Menschheit sich erstreckenden politischen Machtausübung: er ist Weltherrscher. Nachdem Weltherrschaft im vollen Sinn möglich geworden ist, ist der Antichrist real möglich geworden.
Der Weltstaat des Antichrist wird ein im extremen Sinne totalitärer Staat sein. Der durch keine überlieferte Bindung eingeschränkten Gewaltmacht des Weltstaates steht die Kirche in der Rolle der Märtyrerkirche gegenüber.
aus: Josef Pieper
Über das Ende der Zeit.
Eine geschichtsphilosophische Meditation.
Kösel, München 1950
________________________________________________________________________
Was wissen wir vom Antichrist?
Von Msgr. Christiani, "Ecclesia", Paris 1961
"Antichrist" bedeutet Gegner Christi und bezeichnet den, der "am Ende der Zeit" durch satanische Wunder und höllische List eine große Anzahl Christen verführen wird. Es wird also zu einem sehr engen Bündnis zwischen dem Antichrist und dem Satan kommen. Trotzdem darf man die beiden nicht miteinander verwechseln, d.h. für die gleiche Person erklären, wie einige evangelische Autoren es vor kurzem taten. Nach ihnen wäre der Antichrist ganz einfach eine "Menschwerdung des Satans", entsprechend der Menschwerdung des Wortes in Jesus Christus.
Alle Stellen der Hl. Schrift, die von ihm sprechen, sagen klar und eindeutig aus, dass der Antichrist eine Menschenmacht sein wird, die zwar mit dem Satan verbündet, aber nicht mit ihm identisch ist. Wir sagen zunächst mit Absicht "eine Menschenmacht", um nicht schon auf das Problem einzugehen, ob es sich um eine menschliche Einzelperson oder ein menschliches Kollektiv wie den materialistischen und atheistischen Kommunismus unserer Zeit handelt.
Der Ausdruck Antichrist kommt in den Büchern des Neuen Testamentes viermal vor. Die Erwähnung der Gegner Christi dagegen ist viel häufiger. Christus selbst hat, als er vom Ende der Zeiten sprach, angekündigt: "Es werden falsche Messiasse und falsche Propheten aufstehen" (Mt 24,11), was bei Markus (13,22) noch deutlicher ausgedrückt ist: "Es werden falsche Messiasse und falsche Propheten aufstehen und Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen."
Die älteste Beschreibung des Antichrist findet sich im 2. Brief des hl. Paulus an die Thessalonicher, den man allgemein in das Jahr 52 n.Chr. verlegt. "Denn zuvor (gemeint ist das Ende der Welt) muss der Abfall kommen und offenbar werden der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles erhebt, was Gott heißt oder Gottesverehrung, so dass er im Tempel Gottes Platz nimmt und von sich erklärt, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich schon bei meinem Aufenthalt bei euch dies zu euch sagte? Und nun wisst ihr, was ihn aufhält, bis er offenbar wird zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Werk: Nur der es jetzt noch Aufhaltende muss aus dem Weg geräumt werden. Dann wird der Gesetzlose offenbar werden, den der Herr Jesus hinwegnehmen wird mit dem Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft. Sein Auftreten wird sich infolge der Kraftentfaltung des Satans mit allerlei Macht, trügerischen Zeichen und Wundern vollziehen, mit allerlei böser Verführung für jene, die verlorengehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht aufgenommen haben zu ihrer Rettung. Daher schickt ihnen Gott die Kraftentfaltung der Verführung, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Gefallen hatten am Frevel." (2Thess 3-12)
Obwohl der Name Antichrist diesem Gegner hier nicht gegeben wird, haben schon die ältesten Kirchenväter, wie der hl. Justin, der hl. Irenäus und der hl. Hippolyt, erklärt, dass es sich nur um ihn handeln könne.
Auch der hl. Augustinus in seinem Gottesstaat wendet diese Stelle bei Paulus auf den Antichristen an, die nach ihm zwei Erscheinungen charakterisiert: die geheime Tätigkeit des Antichrist zu allen Zeiten und das Ende der Welt, wo der Antichrist seine volle Handlungsfreiheit haben wird, bevor ihn der Atem Christi vernichtet.
Auch das in der Geheimen Offenbarung, diesem erstaunlichen und geheimnisvollen letzten Buch des Neuen Testamentes, in dem das Ende der Zeiten beschrieben wird, vorkommende Tier scheint der Antichrist zu sein. Aber "der Gegner", der das Tier und den ganzen antichristlichen Kampf leitet, ist der Satan, der "Drache".
Einzelmensch oder Kollektiv?
In den zahlreichen Schriften aus der Frühzeit der Kirche spricht man sich nur zögernd darüber aus, ob der Antichrist ein Einzelmensch oder ein Kollektiv sein wird. Sicher sind es mehrere Individuen; denn der hl. Johannes schreibt in seinem ersten Brief (2,18): "Wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen erstanden . . . Wer anders ist der Lügner als derjenige, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet."
Und im 4. Kapitel sagt er: "Es sind viele falsche Propheten ausgezogen in die Welt. Jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommt."
Man kann daher wohl annehmen, dass der Antichrist ein Einzelmensch oder ein Kollektiv ist oder auch ein Einzelmensch, der eine Gruppe um sich bildet. Das war schon im 5. Jahrhundert die Meinung des hl. Augustinus, der im Gottesstaat schrieb: "Es gibt welche, die wollen, dass man in diesem Text (dem Brief des hl. Paulus an die Thessalonicher) nicht nur den Führer allein, sondern gewissermaßen sein ganzes Korps verstehen müsse, d.h. die Menschenmenge, die zu diesem Führer gehört, und das ist der Antichrist." Seit Augustinus sind die Kommentatoren über diesen Punkt geteilter Meinung. Mehr und mehr aber gewinnt die Auslegung des Antichrist als eines Kollektivs an Boden.
Bezeichnung des Antichrist mit Namen
Wenn wir vom Ende der Welt sprechen, so muss man darunter nicht notwendigerweise die aller letzte Zeit verstehen; "denn tausend Jahre sind vor Gott wie ein Tag", wie es in der Bibel heißt. Das Ende der Welt hat mit der Geburt Christi bereits begonnen. Die Ära Jesu Christi ist die letzte der Menschheitsgeschichte. Zusammen mit Christus sind wir bereits in die "Eschatologie", d.h. in die Endzeit, eingetreten. In diesem Sinn kann man sagen, dass der Antichrist zu gleicher Zeit wie Christus erschienen ist. Der hl. Johannes und der hl. Paulus reden denn auch, als ob der Antichrist schon am Werk sei. In der Tat gab man schon zu ihrer Zeit dem Antichrist menschliche Namen. Dazu müsste man aber die ganze Geschichte abrollen lassen und alle Tyrannen, alle Geißeln der Menschheit nennen, um die Liste der Namen des Antichrist vollständig zu haben; von Caligula und Nero bis zu Napoleon, Hitler und Stalin gibt es kaum einen großen Eroberer und Tyrannen, den man nicht den Antichrist genannt hat. Vor allem hat man die Häretiker, die Abtrünnigen, mit Recht als Erscheinungen des Antichrist betrachten.
Seit dem frühen Mittelalter kommt es auch vor, dass exaltierte "Reformer" diejenigen Päpste als Antichrist bezeichnen, die nach ihrer Meinung die erforderlichen Reformen nicht rasch genug durchführten. Die hl. Katharina von Siena dagegen bezeichnet in einem ihrer Briefe den Gegenpapst Klemens VII. von Avignon als den Antichrist.
Die Ankunft des Antichrist und das Ende der Welt wurden des Öfteren schon von Volksaufwieglern, ja von einem so großen Volksprediger wie dem hl. Vinzenz Ferrer um 1412 als nahe bevorstehend bezeichnet.
Der Antichrist im 16. Jahrhundert
Besonders im 16. Jahrhundert verbreitete sich eine allgemeine Erwartung des Antichrist, den man gerade damals mit Namen bezeichnete. Im Jahr 1516 hatte das 5. Laterankonzil den Predigern verboten, die Ankunft des Antichrist als nahe bevorstehend anzukündigen. Das hinderte Luther nicht zu erklären, dass der Antichrist zu seiner Zeit in der römischen Kurie am Werk sei. Die Katholiken ihrerseits gaben diese Bezeichnung an die großen protestantischen Gegner zurück. Und die Extremisten der Linken, wie ein Karlstadt, scheuten sich nicht zu behaupten, Luther selbst sei der Antichrist oder sein nächster Verwandter.
Der Antichrist der Neuzeit
Es würde zu weit führen, die Geschichte der Vorstellung vom Antichrist seit dem 18. Jahrhundert darzustellen. Der große Naturforscher Newton verbreitete die Behauptung, das Papsttum sei der Antichrist. Und Kardinal Newman bekannte in seinen alten Tagen, er habe vor seiner Bekehrung zum Katholizismus im Alter von 42 Jahren die Vorstellung gehabt, Rom sei die Hauptstadt des Antichrist. Vor ihm hatte der berühmte Völkerrechtslehrer Grotius in Amsterdam diese hasserfüllte Auslegung bei den Protestanten zurückgewiesen, was ihm zahllose Angriffe von Seiten seiner Glaubensgenossen eintrug.
Der Antichrist in der Literatur
Werfen wir noch einen Blick auf die neuere Literatur, so sehen wir die Gestalt des Antichrist überall auftauchen. Eines der merkwürdigsten Beispiele findet sich bei Dostojewski. Dieser gewaltige Schriftsteller hatte zu einem tiefen, intensiven Glauben mit Christus als Mittelpunkt zurückgefunden. Christus aber war für ihn ganz Liebe, ganz Güte. Für ihn gab es keine Kirche und keine Autorität. Sein Christentum hatte nichts Theologisches an sich, es war ganz Abstraktion und Gefühl. Daher galt seine Abneigung vor allem dem Katholizismus. Der Antichrist war für ihn "der Großinquisitor", d.h. das, was er als das Wesen des Katholizismus betrachtete. (Vgl. seine berühmte Erzählung "Der Großinquisitor" in "Die Brüder Karamasow"!)
Im Gegensatz zu Dostojewski verwarf Nietzsche "alle diese Sklaventugenden" und machte sich selbst mit einer unerhört heftigen Kritik des Christentums zum Antichrist.
In unserer Zeit erblickten Selma Lagerlöf im Sozialismus und A. Mereschkowski im "modernen Fortschritt" den Antichrist. Berdjajew und andere aber sahen den Antichrist im Boschewismus. Auch der katholische Schriftsteller Robert Hugh Benson schildert in seinem berühmten Roman "Der Herr der Welt" den Antichrist in unserer Zeit am Werk.
Schlussfolgerung
Der Antichrist ist gleichzeitig Einzelmensch und Kollektiv. Der Einzelmensch war natürlich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ein anderer und gruppierte mehr oder weniger offen alles um sich, was christusfeindlich war. Gegen Christus aber lehnen sich alle seine Feinde und die seines Evangeliums auf und bilden sozusagen den totalen Antichrist, der bis zum Ende der Zeiten am Werk sein wird.
________________________________________________________________________
Die 12 Tricks des Anti-Christen, um Seelen zu stehlen
Von Erzbischof Fulton Sheen
Erzbischof Fulton Sheen war einer der größten Prediger des 20.Jahrhunderts. Er war der Erste, der das Evangelium ins Radio und dann ins Fernsehen gebracht hat und dadurch Millionen von Menschen auf der ganzen Welt erreicht hat.
In einem wunderbaren Radio Broadcast am 26. Jänner 1947, erklärt er 12 Tricks, die seiner Meinung nach vom Anti-Christ kommen werden. Der Anti-Christ ist eine Figur des Neuen Testaments, die viele Menschen von Gott wegführen wird.
Zuerst zerschlägt Sheen den Mythos darüber, wie der Anti-Christ ausschauen wird. Der Anti-Christ wird nicht so genannt werden, sonst würde niemand ihm folgen. Er wird keine roten Strumpfhosen tragen, noch Schwefel spucken, einen Speer in der Hand halten oder einen Schwanz mit Pfeilspitze schwenken, wie es Mephisto in Faust tut.
Er ist vielmehr, so erklärt Erzbischof Sheen, als aus dem Himmel gefallener Engel beschrieben, als Prinz dieser Welt, dessen Bestreben es ist zu erzählen, dass es sonst keine andere Welt gibt. Seine Logik ist einfach: Wenn es keinen Himmel gibt, dann gibt es auch keine Hölle; wenn es keine Hölle gibt, dann gibt es auch keine Sünde; wenn es keine Sünde gibt, dann gibt es auch keinen Richter, und wenn es kein Gericht gibt, dann ist das Böse gut und das Gute böse. Kennen wir das irgendwoher?
Die 12 Tricks des Antichristen nach Erzbischof Sheen
1) Er wird sich als der große Menschenfreund geben. Er wird über Frieden, Wohlstand und Fülle sprechen; aber nicht als Mittel, die uns zu Gott führen, sondern als Ziele an sich.
2) Er wird Bücher über eine neue Idee von Gott schreiben, um der Lebensweise der Menschen zu entsprechen.
3) Er wird den Glauben an die Astrologie einführen, um nicht unseren Willen für unsere Sünden verantwortlich zu machen, sondern die Sterne.
4) Er wird die Schuld auf psychologische Art und Weise, als unterdrückten Sex erklären und die Menschen in Scham zusammenzucken lassen, wenn jemand sagt, dass sie nicht weitherzig, tolerant und liberal sind.
5) Er wird Toleranz als Gleichgültigkeit gegenüber gut und schlecht definieren.
6) Er wird Scheidungen fördern, unter dem Deckmantel, dass ein anderer Partner lebenswichtig sei.
7) Er wird die Liebe zur Liebe mehren und die Liebe zu den Personen vermindern.
8) Er wird sich auf die Religion berufen, um die Religion zu zerstören.
9) Er wird sogar von Christus sprechen, und behaupten, dass er der größte Mensch war, der je gelebt hat.
10) Er wird sagen, dass es seine Mission ist, die Menschen von der Knechtschaft des Aberglaubens und des Faschismus zu befreien, ohne dies je zu definieren.
11) Inmitten all dieser augenscheinlichen Liebe für die Menschheit und seinen glattzüngigen Reden über Freiheit und Gleichheit, wird er ein großes Geheimnis hüten, das er niemandem verraten wird: Er wird nicht an Gott glauben. Und weil seine Religion Brüderschaft ohne die Vaterschaft Gottes ist, wird er sogar die Auserwählten täuschen.
12) Er wird eine Gegen-Kirche aufbauen, die die Kirche nachahmt, denn er, der Teufel, ist ein Nachahmer Gottes. Der mystische Leib des Anti-Christen wird äußerlich in allem der Kirche, dem mystischen Leib Christi, ähneln. Der moderne Mensch, der dringend Gott braucht, wird von ihm in seine Einsamkeit und Frustration mit hineingenommen, damit dieser mehr und mehr nach der Mitgliedschaft in seiner Gemeinschaft hungert. Diese Gemeinschaft gibt dem Menschen eine größere Bestimmung, ohne persönliche Umkehr und ohne Bekenntnis von persönlicher Schuld. In diesen Tagen, wird der Teufel an eine besonders lange Leine gelegt werden.
________________________________________________________________________

10. Abendland
Der heilige Benedikt und das Abendland
Was wir Abendland nennen im Unterschied von der zerklüfteten und gespaltenen Welt des heutigen Europas, also jene christliche Ökumene, die germanische und romanische Völker zu einer geistig-religiösen Einheit werden ließ, jenes Abendland zeichnete sich eben am geschichtlichen Himmel in erkennbaren Umrissen ab, als St. Benedikt lebte. Er selber sah und erlebte noch die grandiose Einheit des Imperium Romanum, kannte nur Provinzen der einen römischen Welt. Aber die Antike als Kulturwelt und als politische Macht um das Mittelmeer gelagert, räumte doch dem Abendland und dem Mittelalter langsam den Platz. Die Achse der Weltgeschichte drehte sich dem Norden zu. Die Macht Roms und der Cäsaren war nur noch ein Schatten. Als Benedikt geboren wurde, herrschte über Italien der germanische Heerkönig Odoaker. Während er in der Stille seiner Mönchszelle seine Regula schrieb, lenkte die Geschicke des Westens der große Theoderich, der vielleicht als erster die Herrschaft der neuen Völker als eine politische Zukunft im Geiste erwog. Auf Monte Cassino empfing Benedikt den Besuch des Gotenkönigs Totila, und im Jahr 529, da er mit dem Bau seines Klosters begann, nahm zum ersten Mal ein „Barbar“ den Stuhl Petri ein, Bonifatius II., der Sohn des Goten Sigisbald. Alles Zeichen, dass eine neue Zeit sich ankündigte.
Vorerst aber war die Welt ein einziges großes Trümmerfeld, wohl noch furchtbarer als das heutige Europa. Die Pax Romana, in der die Völker gelebt hatten, war dahin und wurde unter den Marschschritten der germanischen Heerhaufen niedergestampft. Der Soldat gab dem Zeitalter das Gepräge. Germanische Söldner und germanische Heerführer zertrümmerten die alte Welt und überschwemmten die Erde mit ihren Gräueln und ihren Heldentaten. Sie glaubten, eine neue Welt errichten zu können. Man vertrieb Völker und Volksstämme von ihren Wohnsitzen, siedelte selber auf dem freigewordenen Boden, um ihn bald wieder gegen einen anderen zu vertauschen, zog Grenzen, wie es beliebte, gründete Reiche im Süden und Norden, an der Donau, am Rhein, an der Rhone, am Ebro und an den Rändern der Sahara. Und doch hat nicht der Soldat die neue Welt gebaut. Was er zu errichten glaubte, ist nach wenigen Jahrzehnten wieder zugrunde gegangen.
Viele haben sich damals um eine neue Ordnung bemüht und nach Rettung Ausschau gehalten. Die einen sahen die Rettung Ausschau gehalten. Die einen sahen die Rettung im Heerführer, der die zuchtlosen Barbaren bändige und mit den Waffen des alten Rom wieder Frieden und Wohlfahrt bringe. Die anderen glaubten an die Macht der Philosophie; und in den Rhetorenschulen Italiens, Galliens und Griechenlands mühten sich die Dozenten, eine blutleere Geistigkeit zu erhalten. Selbst ein Mann wie Cassiodor glaubte, mit einem neuen Bildungsprogramm die Welt retten zu können und begründete seine Akademie zu Vivarium, als Benedikt an seiner Mönchsregel schrieb. Der Kaiser zu Byzanz sah das Heil in einer neuen Rechtsordnung, die den Völkern Sicherheit gewähren sollte.
Benedikt hat sich an diesen Versuchen zur Rettung nicht beteiligt. Er war als echter Römer gewiss kein Verächter wahren Soldatentums, und die Wörter „miles“ (Soldat) und „militia“ (Heerbann) gehören zu seinen Lieblingsvorstellungen; seine Professformel ist dem römischen Fahneneid nachgebildet, und man hat festgestellt, dass manche seiner Anordnungen ihr Vorbild und ihre Parallele im römischen Soldatenleben haben. Aber er war doch weit davon entfernt, im Soldatisch-Kämpferischen ein absolutes Ideal zu sehen. Er kannte nur einen des Menschen würdigen Kriegsdienst, den für Christus, und hat einem germanischen Eroberer das Wort gesagt: „Du tust Böses!“ Benedikt war auch kein Feind der Bildung, sondern erweist sich selber als belesen in der christlichen und in der heidnischen Literatur und wäre nicht Römer gewesen, wenn er das Recht nicht geschätzt hätte als die große und erhabene Macht. Seine Regula mit ihrer Fülle juristischer Prägungen ist der beste Beweis dafür. Dennoch mühte er sich nicht darum, das Wissen oder das Recht inmitten des Unterganges zu retten.
Benedikt schätzte die Arbeit, hat seine Mönche zu ernster Arbeit, auch zur Feldarbeit angehalten; Garten, Feld und Weinberg sind in der Regula als Arbeitsbereiche des Mönches genannt. Aber er wollte keineswegs Bauern erziehen und hat die Seinen nicht zur Kultivierung von Ödland ermahnt. Das Handwerk hat er geachtet und der Werkstätte einen Platz in seinem Klosterbezirk angewiesen genauso wie dem Gotteshaus. Aber deshalb sind seine Klöster nicht einfach Handwerksschulen geworden. Studium verlangt er von seinen Mönchen, schreibt als selbstverständliche Utensilien Buch, Griffel und Schreibtafel vor, aber er hat den Gelehrten nicht als das Ideal gepriesen. Er fordert Takt, Haltung, Vornehmheit im Reden und Benehmen, verpönt jegliche Ungebundenheit und Zuchtlosigkeit, und doch ist nicht die „urbanitas“ Inhalt seiner Lehre. Anordnungen über Nahrung, Kleidung und Schlaf hat er getroffen, die eine wundersame Ausgewogenheit von Körperlichem und Geistigem und die Einordnung aller Tätigkeit und des Lebens in den Rhythmus des Tages- und Jahreszeiten bekunden. Trotzdem ist Benedikt nicht ein hervorragender Vertreter der christlichen Humanitas. Benedikt hat dem Abendland nicht dadurch gedient, dass er rief: „Rettet den Staat, rettet die Bildung, rettet die Kultur, rettet die Menschlichkeit!“ Dass all diese Werte gerettet wurden, daran ist er beteiligt, und vielleicht in erster Hinsicht, mehr als Cassiodor oder Justinian oder Belisar.
Was hat Benedikt dem Abendland gebracht? Die alte Welt lag in Trümmern. Durch Italien irrten die Flüchtlinge, vertrieben von Haus und Hof, hungernd und heimatlos. Die Gewalt herrschte. Dieser harten und herrischen Welt des feindlichen Eroberers hat Benedikt die friedsame Welt des Mönches gegenübergestellt, der Kaserne und dem Lager gegenüber erhob sich das Kloster, das Zelt des Herrn. Inmitten dieser Weltkatastrophe wagte Benedikt das Wort: „Man darf dem Gottesdienst nichts vorziehen.“ Es war ein Wagnis zu sagen: man muss Gotteshäuser bauen, da Millionen kein Heim hatten. Ein Wagnis zu sagen: man muss Psalmieren, da viele vor Gram verstummten. Ob man Benedikt nicht für einen Schwärmer gehalten hat? Keine zeitgenössische Quelle nennt uns seinen Namen. Das ist wohl ein Beweis dafür, dass man von seinem Werk, das er in Monte Cassino begann, in den wohlunterrichteten Kreisen nicht viel hielt. Und doch hat Benedikt dem Abendland den wichtigsten Dienst erwiesen, das gerettet, was das einzig Notwendige war und aus dem alles andere geflossen ist: die Religion, die Christlichkeit. Es waren gewiss furchtbare Schäden, wenn Kulturdenkmäler in Trümmer sanken, wenn die Felder verödeten, wenn kaum jemand noch den Stil der Alten zu schreiben wusste, aber noch schlimmer war es, wenn in der allgemeinen Flut der Kult des wahren Gottes erlosch.
Benedikt wies auf Christus. Das ist wohl das Entscheidende, dass er die Seinen zur Christlichkeit führte. Es geht ihm um die Verwirklichung des Christentums. Nicht nur das äußere Tun entscheidet, nicht das Gewand, nicht die Tonsur, mit all dem kann man Gott belügen. Es gilt das Evangelium zu leben, die Gebote des Herrn zu halten, an seinem Leiden teilzuhaben, der Liebe zu Christus nichts vorzuziehen, von der Liebe, dem Zeichen der Jüngerschaft, nicht zu lassen. Mit einer deutlich spürbaren Eindringlichkeit wird die Liebe gefordert inmitten des Hasses und der Gewalt. Es gab ja nur ein Recht, das des Stärkeren. Benedikt rief in diese Welt voller Trotz und Frevel: „Unrecht dulden! Wenn einer euch den Mantel nimmt, gebt ihm auch den Rock, wenn einer euch zwingt eine Meile mitzugehen, so geht zwei mit ihm. Niemanden hassen, für die Feinde beten!“ Er nahm Goten in sein Kloster auf, die Plünderer von gestern, und sagte seinen Mönchen, unter denen Patriziersöhne waren: „“Vor Gott gilt kein Ansehen der Person, vor Gott sind alle gleich, Herr und Sklave.“ Religiosität und Christlichkeit sind aber für Benedikt nicht zu leben in der Stille des Herzens, sondern in der Gemeinschaft und im Kult. Es gilt, Gott in den Mittelpunkt zu stellen, ihm den schuldigen Dienst zu entrichten. So fordert Benedikt den betenden Menschen, den Menschen, der sich mit seinem ganzen Sein an Gott und seinen Dienst hingibt. Dadurch, dass Benedikt die Schule für den göttlichen Dienst errichtete, hat er dem Abendland den größten Dienst erwiesen. Nicht Bildungsstätten, sondern Kulturstätten hat er errichtet.
Was im Anfang war, dass nämlich aus dem Kult alle Kultur erblühte, das wurde wiederum Wirklichkeit dank Benedikts Regula und Mönchtum im werdenden Abendland. Die Verheißung des Herrn erfüllte sich, dass denen, die das Reich Gottes zuerst suchen, alles andere hinzugegeben wird. Benedikt sammelte die Menschen um den Altar und nannte das Gotteslob ihre erste und vornehmste Aufgabe, nicht die einzige, aber die dringlichste. Bald zeigte sich, dass aus dem Kult auch die Kulturarbeit erwuchs, mit der seine Mönche das Abendland so reich beschenkt haben. Architektur, Musik, Gesang, Malerei, Goldschmiedekunst und nicht zuletzt die Wissenschaft erhielten Antrieb, Wurzel und Befruchtung in der Liturgie. Benedikt verschloss sich mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit des Kultes auch keineswegs den Aufgaben der Caritas und der Seelsorge. Das Fremdenhospiz gehört zum Kloster, und es hat sich in der Geschichte des benediktinischen Mönchtums gezeigt, dass die Hände, die sich im Gebet zu Gott erheben, auch die Hände sind, die sich hilfreich dem Armen entgegenstrecken.
Benedikts Geschenk an das Abendland war seine Regula, jene wahrhaft christliche Lebensordnung, der kurze Abriss einer Vollkommenheitslehre gemäß dem Evangelium des Herrn. Aber was hätte diese Lebensordnung dem Abendland genutzt, wenn sie nur eine Lehre und Theorie geblieben wäre? Wichtiger ist noch geworden, dass Benedikt Vorsorge traf, dass diese Ordnung gelebt wurde. Sein größtes Geschenk an das Abendland ist die Abtei, das benediktinische Kloster. Es war nicht der Orden als eine imponierende, geschlossene Macht, der wirkte, es waren auch nicht die einzelnen Persönlichkeiten, die das Abendland gestalteten. Es waren die Klöster. Als Athen und Alexandrien, als Byzanz und Antiochien keine Formkräfte mehr waren, wurden es Monte Cassino, Farfa, Bobbio, Cluny, Fleury, Bec, Canterbury, Malmesbury, St. Gallen, Reichenau, Fulda, Prüm, Tegernsee, Corvey, Hirsau, Kremsmünster, Pannonhalma, Brevnov und Tyniec, um nur einige Stätten zu nennen.
Diese Klöster waren die Stätten eines neuen Gemeinschaftslebens, in denen das Ora (bete) mit dem Labora (arbeite) harmonisch verbunden war. Aus diesen Klöstern kamen sie alle, die die Kultur des Abendlandes schufen und hüteten: die Glaubensboten, die zu den Angelsachsen, zu den Friesen, den Deutschen, den Schweden, den Polen, den Böhmen und den Ungarn zogen; die Gelehrten, die das antike Bildungsgut bewahrten und die Annalen der neuen Zeit sorgsam niederschrieben; die Künstler, die unsere Gotteshäuser bauten und in den Handschriften ihre zierlichen Miniaturen malten; nicht zuletzt die großen Päpste, die mit machtvoller Gebärde den Völkern des Abendlandes den Weg wiesen. Benedikts Werk hat die Jahrhunderte überdauert, weil er es den Klöstern vorgab. Er wollte keinen Orden, uniform und organisiert bis ins letzte, sondern gab seine Regula den einzelnen Klöstern. Sie sollten sie leben in Anpassung an Ort und Lage, mit Rücksichtnahme auf Zahl und Veranlagung der Mönche, auf den Besitz und das Klima und im Besonderen gemäß der Anordnung des Abtes. So ist jedes benediktinische Kloster eine Welt für sich geworden, jedes eigengeprägt durch das Volkstum, die Zeit und die Persönlichkeit der Äbte; dennoch sind sie alle Glieder der einen großen benediktinischen Familie, eine große Gemeinschaft. Überall dient man dem einen Herrn, leistet Kriegsdienst dem einen König. Universalismus und Eigenwesen sind in der benediktinischen Abtei aufs harmonischste verbunden und erzogen den abendländischen Menschen zu jener Weite, die zusammenging mit der Liebe zur Scholle und zur Heimat. So überzeitlich die Aufgabe der Abtei ist, nämlich Gott dem Herrn den Kult zu entrichten bei Tag und Nacht, so erstaunlich ist, wie all diese Abteien jeder Zeitaufgabe dienten: in der Anfangszeit des Abendlandes durch die Mission unter den neuen Völkern, im Mittelalter unter der Führung der burgundischen Abtei Cluny durch die Verteidigung der kirchlichen Rechte, in der Barockzeit durch die Wissenschaft und in unseren Tagen durch das Apostolat der Liturgie, um eine entgottete Welt zur Ehrfurcht vor dem Höchsten zurückzuführen und die Gläubigen wieder das Leben mit der Kirche zu lehren, dessen Quellen am Altar strömen. Wer sieht, was heute den Menschen Einsiedeln, Solesmes, Maredsous, Beuron, Maria Laach, St. Bonifaz in München, St. Peter in Salzburg bedeuten – um nur diese wenigen Namen zu nennen – der weiß, dass St. Benedikts Sendung für das Abendland noch nicht zu Ende ist.
Stephan Hilpisch
Aus „Begegnung“,
Verlag „Wort und Werk“,
Koblenz, 15. Juni 1947
________________________________________________________________________

11. Altarfelsen
Die "Altarfelsen" in Irland
Von Liam Brophy
Zusammenfassung aus „Sentinel oft he Blessed Sacrament“
194 E. 76th St., New York City, 21. November 1945
“Italien mag seine großen Basiliken haben, Frankreich seine stattlichen Dome, aber Irland hat seine heiligen Stätten, seine Märtyrer und seine Altarfelsen.” So sprach Bischof John Joseph Glennon von St. Louis vor der gewaltigen Menschenmenge im Phönix-Park in Dublin beim Eucharistischen Kongress 1932. Die Geschichte der Martern Irlands ist eng verbunden mit der glorreichen Geschichte der Altarfelsen. Es ist keine Übertreibung, zu behaupten, dass Irlands 300jähriges Martyrium durch sein unbeugsames Festhalten an der Heiligen Messe veranlasst wurde.
Manchmal nimmt man irrtümlicherweise an, die religiösen Verfolgungen hätten bereits mit dem Einfall der Normannen begonnen. Allein diese hatten die gleiche Religion wie das Volk, dessen Land sie zu erobern kamen, und wurden allmählich von der besiegten Rasse aufgesogen, so dass die Günstlinge der Königin Elisabeth von ihnen sagten: „Sie wurden irischer als die Iren selber.“ Die Ruinen der herrlichen normannischen Klöster und Abteien, die man in ganz Irland findet, legen Zeugnis davon ab, mit welchem Eifer die normannischen Familien an ihrem alten Glauben festhielten.
Mit den Tudors begann Irlands langes Martyrium. Der Anfang war der „Suprematieakt“, in dem Heinrich VIII. sich selbst als „das einzige Oberhaupt der Kirche Englands auf Erden“ erklärte. Dieses Gesetz wurde später von einem unbefugten irischen Parlament angenommen. Kirchen und Klöster wurden geplündert, um Heinrich VIII. und seine Anhänger zu bereichern. Aber es gibt einen ergreifenden Zug im Leben dieses Herrschers: er entweihte die Heilige Messe nicht! Hatte er nicht einst gegen einen abgefallenen Mönch eine Erwiderung mit dem Titel „Eine Verteidigung der sieben Sakramente“ geschrieben, sie Papst Leo X. gewidmet und dafür den Titel „Verteidiger des Glaubens“ erhalten? Dieser Titel, den Heinrich für seine Glaubensverteidigung erhielt, steht noch heute auf den englischen Münzen und im Wappen der englischen Herrscher. Heinrichs Anhänger aber gingen darauf aus, die Messe als den Mittelpunkt des katholischen Gottesdienstes zu treffen und damit den ganzen Katholizismus zu lähmen. Aber Heinrich, der in so vielen Dingen schwach war, widersetzte sich ihnen bis zum Schluss. Seine letzte Bitte stimmt traurig und kommt uns wie eine Ironie vor: „Wir flehen die allerheiligste Jungfrau, die Gottesmutter, mit all ihrem himmlischen Hof inständig an, für uns zu bitten; es wolle ein entsprechender Altar angeschafft, geweiht und aufgestellt werden, schön hergerichtet und mit allem Nötigen versehen zum Abhalten einer täglichen Messe für meine Seele auf ewige Zeiten, solange die Welt steht.“
Nach seinem Tod aber beseitigten seine fanatischen Nachfolger schnell, was er noch beibehalten hatte. Der Hauptangriffspunkt im Kampf war nun die Heilige Messe, da man diese mit Recht als die Quelle und den nährenden Born des Glaubens ansah. England wurde rasch bezwungen, aber Irland gab nie nach, und seit Heinrichs Tod schwoll das Tempo der religiösen Verfolgung in einem entsetzlichen Crescendo an.
Besonders unter der Königin Elisabeth richtete sich der Hass der Verfolger gegen die Priester. „Keine Priester, keine Messe mehr!“ lautete der Kampfruf. Elisabeth stellte eine Kommission auf, die feststellen sollte, wie weit das Gesetz, das die Teilnahme am staatlichen Gottesdienst zur Pflicht machte, eingehalten wurde. Man berichtete ihr, dass die große Mehrheit fortfahre, der Messe beizuwohnen, als ob überhaupt kein Gesetz erlassen worden sei. Die Gebildeten würden ihre Herrschaftshäuser als „Messehäuser“ zur Verfügung stellen und den Priestern, denen es verboten sei, in öffentlichen Kirchen die Heilige Messe zu feiern, Zuflucht gewähren und sie nicht melden. Da beauftragte Elisabeth ihren ersten Staatssekretär William Drury, diesem Zustand regelrechter Gesetzesverachtung ein Ende zu machen. Drury war bekannt für seinen Hass. Er war besonders empört, dass in Waterford täglich furchtlos die Heilige Messe gefeiert wurde. Ein Bischof und ein Mönch fielen ihm dort in die Hände. Nach Folterung ließ er sie an Bäumen als Zielscheibe der Soldaten aufhängen. 14 Tage später aber starb Drury, wie es ihm der Bischof vorhergesagt hatte, an der gleichen Stelle.
Es war etwas Gewöhnliches, den Priestern Daumen und Zeigefinger abzuhacken, um sie zur Feier der Heiligen Messe untauglich zu machen. Aber nur wenige kamen damit davon. Das Martyrium des Erzbischofs Dermot O`Hurley ist typisch für die Behandlung, die man den Geistlichen zukommen ließ. Nachdem er lange Jahre in Louvain gelehrt hatte, wurde er durch Gregor XIII. auf den Bischofssitz von Cashel berufen. Obwohl er sich der Gefahr, die ihm drohte, bewusst war, brach er als neugeweihter Erzbischof im Alter von beinahe 60 Jahren von Rom auf. Er landete, als Matrose verkleidet, in Irland. Aber Spione waren hinter ihm her, und schon nach einigen Tagen wurde er gefangen und nach Dublin gebracht. Man sicherte ihm Straflosigkeit zu, wenn er die geistliche Herrschaft des Papstes ableugne und den Suprematieeid leiste. Als er sich weigerte, wurde er an einen Baum gebunden und gepeitscht. Danach marterte man ihn mit Pech und Feuer, bis seine Knochen bloßlagen. Als er sich auch dann noch weigerte und alle Schmeicheleien und Drohungen versagten, hing man ihn an einem Galgen außerhalb der Stadtmauer auf. Dies war das Signal für eine grausame Verfolgung der Priester. 14 Bischöfe wurden allein unter der Herrschaft Elisabeths gemartert. Die Mitglieder ganzer Klöster wurden vor den Altären erschlagen.
Unter Cromwell erreichte der Hass gegen die Heilige Messe seinen Höhepunkt. Sein Zug durch Irland war durch rauchende Ruinen und Leichen gekennzeichnet. Nur unter einer Bedingung war er bereit, Schonung zu gewähren, dann nämlich, wenn die Heilige Messe abgeschafft würde.
In den folgenden 100 Jahren, die unter dem Namen „Penal Times“ (Strafzeiten) bekannt sind, erreichte der Hass der Feinde Irlands gegen die Heilige Messe einen zweiten und letzten Höhepunkt ausgeklügelter Grausamkeit. Von diesen Zeiten heißt es in dem späteren Gedicht des evangelischen Dichters Davis:
„Sie bestachen die Herde, bestachen den Sohn,
Um den Priester zu kaufen, den Herrn zu berauben
Die Hunde lehrte man beiden zu folgen,
Der Fährte des Wolfs und der Fährte des Mönchs.“
Die letzten Zeilen sind eine Anspielung auf die Tatsache, dass man die gleiche Belohnung für den Kopf eines Priesters wie für den eines Wolfes aussetzte.
Zu jener Zeit nun, als die Heilige Messe gesetzlich verboten war und jedes Haus und jeder Schuppen beobachtet wurden, ob sie nicht in ein sogenanntes „Messehaus“ verwandelt seien, gingen die Priester und das Volk in die Hügel und Täler und errichteten in der Wildnis Altäre. Noch heute sind diese Messefelsen in Irland vorhanden, über das ganze Land als Zeichen und Symbole des Glaubens verstreut. Sie gaben vielen Orten Irlands ihren Namen. Um nicht überrascht zu werden, stellte man auf den umliegenden Hügeln Wachtposten auf, während sich die Gemeinde um den Priester scharte, der das heilige Opfer feierte. Aber zuweilen wurden sie doch überlistet, und die kleine Schar der frommen Beter musste dann zu dem erhabenen Opfer der Heiligen Messe noch ihr eigenes Leben opfern. Priester und Bischöfe hatten damals wie der Menschensohn nichts, wohin sie ihr Haupt legen konnten. Oft finden wir am Schluss ihrer Briefe die Bemerkung: „ex loco refugii“ (aus einem Zufluchtsort).
Im Laufe der Zeit begann die Verfolgung allmählich nachzulassen. „Messehäuser“ wurden, vorausgesetzt, dass sie abgelegen waren, erlaubt. Sie bestanden nur aus strohbedeckten Hütten, gerade groß genug, um Priester und Altar zu überdecken. Die Gläubigen knieten außen herum in einem weiten Kreis.
Der Mann, der dem langen Martyrium ein Ende machte, war der großmütige Befreier Irlands, Daniel O`Connell. Die Katholiken bekamen wieder die Freiheit ihres religiösen Gottesdienstes, d.h. der Heiligen Messe, die Priester durften sich wieder zeigen und mussten sich nicht mehr als Verfolgte Geschöpfe in Höhlen verbergen.
Wir müssen uns vor Augen halten, dass zur Zeit, als man in Italien die Peterskirche erbaute, in Frankreich die Kathedrale von Reims und in Deutschland den Dom zu Köln, die Heilige Messe in Irland von einer fremden Macht verboten war. Statt der bescheidenen Pracht des romanischen oder gotischen Stils kannte man dort als Decke über dem Altar nur das Dach einer Berghöhle oder die sich verschlingenden Äste der Bäume über einem einsamen Felsen in den Bergen. Heute aber (1945) geht eine liturgische Bewegung durch dieses Land, und man erwartet von Irland, das ein so schweres und langes Martyrium wegen seiner Treue zur Heiligen Messe auf sich nahm, einen besonderen Beitrag zur eucharistischen Erneuerung unserer Tage.
________________________________________________________________________

12. Armee des Papstes
Eine besondere Ehre der Schweiz
Von J. Schaefer
Zusammenfassung aus „Liguorian“
1118 N. Grand Blvd. St. Louis, 6, Mo.
Februar 1948
Die päpstliche Garde oder das, was man die „Armee des Papstes“ nennen kann, ist eine symbolische Armee, genauso wie der Vatikanstaat nur ein symbolischer Staat ist. Die Fremden sehen nur eine kleine, disziplinierte Schar Wächter und Polizisten, die still durch die Vatikanstadt und den Palast des Hl. Vaters patrouillieren.
Die päpstliche Armee setzt sich aus vier Einheiten zusammen: der berühmten Schweizer Garde, den päpstlichen Gendarmen, der Palatingarde und der Nobelgarde. Die älteste ist die Schweizer Garde. Sie erhielt ihren Namen vom Heimatland ihrer Mitglieder. Heute kommen die Rekruten für diese Garde, mit einer einzigen Ausnahme, aus allen Schweizer Kantonen, und sogar in den heißesten Tagen der Reformation hielten einige protestantische Kantone die Rekrutierung aufrecht.
Die Uniform der Schweizer Garde, die Michelangelo entworfen haben soll, hat sich in der langen Geschichte dieses Korps nicht geändert und wird noch stolz getragen. Sie besteht aus rot-, gelb- und blaugestreiften Blusen und weiten Kniehosen, blau- und gelbgestreiften Gamaschen, einer Brustplatte aus Metall, einer weißen Halskrause und einem flachen Metallhelm, dessen Spitze mit einem roten Busch geziert ist. Eine mittelalterliche Hellebarde d.h. ein langschaftiger Spieß, weshalb die Soldaten dieser Garde auch Hellebardiere genannt werden, vollendet die farbenprächtige Uniform. Heute ist die Schweizer Garde auch mit modernen Gewehren ausgerüstet. Mag diese Uniform auch veraltet und beinahe aufgeputzt erscheinen, so passt sie doch in einem gewissen Grad gerade zur Schweizer Garde; denn sie erinnert diese Korps an eine Geschichte, die in den Annalen militärischer Einheiten kaum ihresgleichen hat.
Am 21. Januar 1506 marschierten 150 Schweizer Soldaten unter der Führung ihres Hauptmanns Caspar Silenen durch die Porta del Popolo im Norden von Rom zum Petersplatz. Dort wurden sie von Papst Julius II., der Vorbereitungen für ihre Ankunft getroffen hatte, feierlich gesegnet. Sie sollten die Wache des päpstlichen Palastes übernehmen. Die Schweizer Katholiken rühmen sich noch heute des Titels „Verteidiger der Freiheit der Kirche“, der ihnen von Papst Julius II. verliehen wurde.
Diese Garde hat die schweren Zeiten und auch die Ruhmeszeiten des Papsttums geteilt. Im Jahr 1527 zog ein buntscheckiger Haufen französischer und italienischer Soldaten in der Hoffnung auf leichte Beute durch Italien nach Rom. Die päpstlichen Kräfte, die weit in der Minderheit waren, wurden von der anstürmenden Horde geschlagen und niedergemetzelt. Am 7. Mai fiel Rom, mehr als 7000 Einwohner wurden an einem Tag getötet, die Stadt mitsamt den Kirchen geplündert, und Papst Clemens VII. musste in die Engelsburg fliehen. Nur 47 der 250 Mann zählenden Schweizer Garde konnten die Burg erreichen, die übrigen wurden bei der standhaften Verteidigung St. Peters und der Person des Heiligen Vaters niedergemacht.
Als im Jahr 1571 ein neuer Einfall der Türken die Christenheit bedrohte, stellte Papst Pius V. Don Juan von Österreich an die Spitze der christlichen Streitkräfte. Die Türken wurden in der berühmten Seeschlacht von Lepanto, bei der die Schweizer Garde an Bord des Flaggschiffes kämpfte, entscheidend geschlagen. Bei der Siegesparade vor dem Papst nach Rückkunft der Truppen wurden 40 der vornehmsten Gefangenen von der Schweizer Garde geführt.
In der napoleonischen Zeit, und noch einmal, als die Truppen Garibaldis dem Papst den Rest der weltlichen Macht nahmen, zog die Schweizer Garde mit Papst Pius VII. in die Verbannung. In hoffnungsloser Minderheit um einen anderen Papst. Pius IX., geschart, musste die kleine Leibwache zusehen, wie ein verräterischer französischer Offizier, ein Mitglied des diplomatischen Korps, die weiße Flagge hisste und damit den päpstlichen Soldaten das Zeichen gab, die Waffen niederzulegen und die Truppen Garibaldis das wehrlose Rom stürmen zu lassen.
Im Jahr 1825 wurde zwischen Papst Leo XII. und dem Kanton Luzern ein Vertrag abgeschlossen, der in der Hauptsache noch heute in Gültigkeit ist. Die Schweiz erlaubte darin die Errichtung eines Werbebüros in Luzern, durch das mehr als 200 Freiwillige zwischen achtzehn und fünfundzwanzig Jahren aus den katholischen Kantonen für den päpstlichen Dienst geworben werden sollten. Leo XII. seinerseits legte die Bezahlung der verschiedenen Mitglieder der Garde fest, versprach ihre Unterbringung im Vatikan und erkannte der Schweiz das Recht zu, drei Kandidaten für den Posten des kommandierenden Offiziers vorzuschlagen. Die letzte Reorganisation des Korps wurde im Jahr 1914 durch Pius X. durchgeführt. Dabei wurde die Zahl der Garde auf sechs höhere Offiziere, von denen der höchste den Rang eines Oberleutnants bekleidet, einen Feldgeistlichen, fünfzehn Unteroffiziere und einhundertfünfzehn Hellebardiere festgesetzt.
Zusammen mit dem Heiligen Vater wurde auch die Schweizer Garde zum freiwilligen Gefangenen im Vatikan, bis sie der Lateranvertrag des Jahres 1929 wieder zur Leibwache eines weltlichen Herrschers machte.
Die Schweizer Garde versieht ihren Dienst, der in der Bewachung der Person des Papstes und in seiner Begleitung, besonders bei Reisen außerhalb des Vatikanstaates, besteht, nach den Gesetzen des Vatikanstaates. Die Garde ist dem Heiligen Vater direkt unterstellt, wenngleich der Gouverneur des Vatikanstaates und eine polizeiliche Überwachung ihre Hilfe anfordern kann. Ihre alten Hellebarden trägt die Garde nur bei besonderen Gelegenheiten. Bei allen öffentlichen Zeremonien in St. Peter tragen vier von ihnen, bekannt als die „Spadoni“, die neben der „Sedia gestatoria“, der Sänfte des Papstes, marschieren, die vier großen Schwerter, die die Schweizer vor fünf Jahrhunderten dem heiligen Stuhl gaben. Sie sind ein Sinnbild der katholischen Kantone der Schweiz als der Verteidiger der weltlichen Macht der Päpste. Kommandeur der Schweizer Garde ist heute (1948) Baron Heinrich Pfyffer aus Altishofen, ein Abkömmling früherer Kommandeure der Garde.
Die drei anderen Einheiten der Schweizer Armee, die Paladingarde, die päpstlichen Gendarmen und die Nobelgarde, sin neueren Ursprungs. Die Paladingarde setzt sich aus zwei Bataillonen Freiwilligen zusammen, die eine Stärke von rund 500 Mann haben. Ihr Kommandeur hat den Rang eines Oberst; neben ihm gibt es eine Anzahl Majore und Offiziere niedrigeren Ranges. Sie sind in der Vatikanstadt oder in Rom untergebracht. Ihre Aufgabe ist es, die Person des Heiligen Vaters und den Wohnpalast zu bewachen und den Heiligen Vater bei allen öffentlichen Funktionen zu unterstützen.
Die päpstlichen Gendarmen sind die Polizei der Vatikanstadt. Sie führen den gleichen Namen wie die ähnlichen Einrichtungen in vielen Staaten. Dieses Korps besteht aus einem kommandierenden Oberst, mehreren höheren Offizieren sowie 150 Unteroffizieren und Gendarmen. Ihre Aufgabe besteht hauptsächlich in der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Vatikanstaat und der Sorge dafür, dass die Gesetze, Verordnungen und Vorschriften eingehalten werden. Auch sie sind bei feierlichen Zeremonien, päpstlichen Audienzen und religiösen Veranstaltungen anwesend und machen in Castel Gandolfo und den Besitzungen des Heiligen Stuhles in Rom Dienst.
Als die Franzosen am 15. Februar 1789 Rom einnahmen, wurden alle päpstlichen Truppen, mit Ausnahme einer Handvoll Schweizergarden, zersprengt. Unter den Zersprengten war eine Gruppe Adeliger, die unter dem Namen Garderitter Seiner Heiligkeit bekannt waren und die Ehrengarde darstellten. Um sie wieder zu ersetzen, stellte Papst Pius VII. am 11. Mai 1801 ein neues Korps, bekannt als die adelige Leibgarde Seiner Heiligkeit, auf. Sie nehmen den ersten Platz unter den Hütern des Heiligen Vaters ein und haben die Ehrenaufgabe, seine Person unmittelbar zu betreuen. Nur Abkömmlinge adeliger italienischer Familien können Mitglieder dieses Korps sein.
Der Schutzpatron der Nobelgarde ist der heilige Sebastian, der Märtyrerkommandeur der ersten Prätorianerkohorte. Auf ihrer Standarte aus weißer Seide befindet sich das Wappen des regierenden Papstes in Gold. Ihr Kommandeur wird aus den Adeligen Roms gewählt und hat den Rang eines Generalleutnants. Die Garde wird in drei Klassen, Hauptleute, Oberleutnante und Leutnante eingeteilt. Nach der neuesten Aufstellung (1948) zählt sie 103 Mitglieder. 20 davon sind im Ruhestand, zwei gehören der Familie Pacelli an.
_______________________________________________________________________

13. Antlitz Jesu Christi
Die Geschichte der Verehrung des heiligsten Antlitzes Jesu Christi
O meine liebe Seele,
Sieh, hier dein Christusbild!
Ihm klage deinen Kummer
Und was dein Herz sonst fühlt!
Er blickt mit seinen Augen
So schmerzlich mild dich an;
Als wollt es zu dir sprechen:
„Das hat man mir getan!
Sieh meine blutigen Wunden,
Mein bleiches Angesicht!
Sieh meine Dornenkrone
Und geh – und klage nicht!“
Da das Bild des heiligsten Antlitzes Christi in Rom seit den ältesten Zeiten hoch und feierlich verehrt wird, so konnte es der Welt nicht verborgen bleiben, denn es gilt von dieser Hauptstadt der Christenheit noch viel mehr dasselbe, was der heilige Papst Leo I. von ihr als der Hauptstadt der Heidenwelt sagt:
„Welchen Völkern könnte unbekannt bleiben, was Rom kennengelernt hat?“
Ist es ja die heilige Stadt, deren Boden mit dem Blut der heiligen Märtyrer getränkt worden ist, deren Mauern die Wohnungen und Denkmäler von Heiligen umschließen, deren Tempel und Grabmäler Ruhestätten heiliger Leiber sind, deren Basiliken, Meisterstücke der Baukunst, an Großartigkeit und Pracht des Gottesdienstes alles in der Welt übertreffen, die die heiligen Gebeine der Apostelfürsten Petrus und Paulus besitzt, die der Sitz des Statthalters Jesu Christi, der Mittelpunkt der katholischen Welt ist, die die Mutterkirche aller Kirchen des Erdkreises in sich schließt, von der jeder Stein ein Denkmal der profanen und der heiligen Geschichte ist, in der alle Schätze der Kunst und Wissenschaft aufgehäuft sind, und aus der alle Völker Wahrheit und Recht und Gesittung schöpfen. Und der heilige Papst Leo I. spricht zu ihr von den Apostelfürsten Petrus und Paulus:
„Diese sind es, die dich zu dieser Herrlichkeit erhoben haben, dass du, ein heiliges Geschlecht, ein auserwähltes Volk, eine priesterliche und königliche Stadt, durch den geheiligten Sitz des seligen Petrus zum Haupt des Erdkreises gemacht, vermittelst du der göttlichen Religion eine ausgebreiterte Oberherrlichkeit inne hast, als vormals durch deine irdische Herrschaft. Denn obwohl du, durch viele Siege vergrößert, dein Herrscherrecht zu Wasser und zu Land ausgedehnt hast, so ist doch das, was dir deine kriegerische Mühe und Arbeit unterworfen, geringer, als was dir der christliche Friede untertänig gemacht hat.“
Das alles wendet die Augen der ganzen Welt nach Rom, unzählige Pilger wallfahrten zu den Gräbern der Apostelfürsten, und wollen selbstverständlich auch alle Heiligtümer, ausdrücklich aber und vor allen andern jene besuchen, und verehren, die auf den göttlichen Erlöser Bezug haben. Wie hätte also diese kostbare Reliquie des heiligen Schweißtuches in der Welt unbekannt bleiben können?
Von dem Bildnis des göttlichen Erlösers auf diesem Schweißtuch werden ununterbrochen Abbildungen auf feiner Leinwand, mit dem Siegel, mit der Authentik der Peterskirche und mit der Unterschrift: „Wahre Abbildung des heiligen Antlitzes unseres Herrn Jesu Christi, welches in Rom in der hochheiligen Basilika des heiligen Petrus im Vatikan mit größter Ehrfurcht aufbewahrt und verehrt wird“, durch die ganze Welt versendet, und allenthalben in Kirchen und Kapellen, wie auch in den Wohnungen der Gläubigen ausgestellt. Dadurch wird nicht nur die Kenntnis von dem Bildnis , sondern auch seine Verehrung überallhin verbreitet. Wir wollen nur ein großartiges Beispiel hier anführen, das uns zeigt, wie wohlgefällig dem Herrn eine solche Verbreitung und Verehrung sei, und welche Gnaden und Segnungen sie mit sich bringt.
Einer der eifrigsten Verehrer des heiligsten Antlitzes und der eifrigste und wirksamste Verbreiter und Beförderer dieser Andacht war der gottselige Leo Sapin Dupont, der zu Tours am 18. März 1876 im Ruf der Heiligkeit gestorben ist. Gegen Ende der Fastenzeit des Jahres 1851 schickte ihm die Priorin der Karmelitinnen zwei aus Rom gekommene Abdrücke des heiligsten Antlitzes, ein Geschenk der Benediktinerinnen zu Arras, die gleichfalls eifrige Beförderinnen des Sühnungswerkes waren.
Die Bilder stellten den im Vatikan zu Rom aufbewahrten Schleier der heiligen Veronika dar, und waren von maßgebender Stelle als getreue Abbilder dieser kostbaren Reliquie und als an ihr angerührt beglaubigt. Der fromme Diener Gottes ließ die beiden Bilder in schwarze Holzrahmen fassen, und schenkte eines von ihnen dem Verein der nächtlichen Anbetung. Das andere hängte er in seinem Empfangszimmer auf, und zwar so, dass es jedem Eintretenden sofort ins Auge fiel. Als er darüber nachdachte, wie er das ihm teure Bild wohl am besten ehren könnte, kam ihm der Gedanke, vor demselben eine Lampe anzuzünden. Ein Lichtlein, das am hellen Tag brennt, so dachte er bei sich, wird aller Blicke auf sich ziehen, vielfach Neugierde erregen, und mir so die gewünschte Gelegenheit verschaffen, von unserm göttlichen Heiland und von seinem heiligen Antlitz, sowie von der Notwendigkeit der Sühne zu reden. Als ein Mann von freier, unabhängiger Stellung glaubte er sich von Gott berufen, die Andacht zur Verehrung des heiligsten Antlitzes Christi draußen in der Welt bekannt zu machen, und zur Geltung zu bringen. Mehrere, allem Anschein nach wunderbare, Begebenheiten bestärkten ihn in diesem Entschluss.
Im Verlauf der Ausführung dieses Entschlusses ereigneten sich vor diesem Bild unzählige Gebetserhörungen und wunderbare Heilungen aller Art in der Nähe und Ferne, dass dieses Empfangszimmer zu einem öffentlichen und ununterbrochen besuchten Wallfahrtsorte sich gestaltete. Nach dem gottseligen Tod dieses Mannes wurde es unter kirchlicher Genehmigung in eine Kapelle umgewandelt, eine eigene Bruderschaft zur Verehrung des heiligsten Antlitzes mit päpstlicher Bestätigung und ein Priesterverein zur Besorgung dieser Kapelle und dieser Bruderschaft gegründet, dem der Domdechant von Tours als Direktor vorsteht.
Der Zweck der Andacht zum heiligsten Antlitz Jesu Christi
Der Hauptzweck der Andacht zum heiligen Antlitz ist, dem anbetungswürdigen, im Leiden entstellten und im heiligsten Sakrament verborgenen Antlitz Jesu unsere ehrerbietige Huldigung und Liebe darzubringen, einen Ersatz zu leisten für die Ihn aufs Neue beleidigenden Gotteslästerungen, für die Entheiligung der Sonntage und schließlich um von Gott die Bekehrung der Gotteslästerer, besonders der Sabbatschänder, zu erhalten und für uns selbst große Gnaden für Leib und Seele zu erbitten.
Diese erhabene, rührende Andacht, die von unserem Heiland selbst eingesetzt zu sein scheint, als er auf seinem Kreuzweg und seinem Todestag wunderbarerweise Veronikas Schleier die Züge seines blutbedeckten Antlitzes klar einprägte und es somit der heiligen Frau zum Andenken hinterließ, war von jeher in der Kirche bekannt. Dies heilige Schweißtuch, das in der Basilika des Vatikans zu Rom sorgfältig aufbewahrt wird, erhält große Achtung und Vertrauensbezeigungen. Jährlich wird es mehrmals den Gläubigen zur Verehrung ausgestellt. Die Päpste haben denjenigen, die dieses erhabene Bildnis in frommer Meinung besuchen, zahlreiche Ablässe verliehen.
Mehrere Heilige haben sich durch ihre Andacht zum heiligen Antlitz ausgezeichnet und durch die Anrufung desselben viele Gnaden und Segnungen empfangen, z.B. der heilige König Ludwig, die heilige Mechthildis, die heilige Gertrudis, der heilige Bernard. Unter jenen, die in unseren Tagen im Ruf der Heiligkeit verschieden sind, wollen wir die Schwester Maria vom hl. Petrus, Karmeliterin in Tours, die ehrwürdige Mutter Maria Theresia, Gründerin der Kongregation der „Sühnenden Anbetung“ und den ehrwürdigen Leo Dupont, diesen unermüdlichen Verbreiter der Andacht zum heiligen Antlitz, anführen.
In neuester Zeit fand diese Andacht die weiteste Verbreitung. Ein Hauch des Heiligen Geistes scheint die Erde zu durchwehen. Sie ist ein Heilmittel der Vorsehung, das der Welt jetzt angeboten wird, um die Verheerungen der Gottlosigkeit zu bekämpfen und uns gegen den Zorn der göttlichen Gerechtigkeit zu schützen.
Der wichtigste Teil des Körpers ist das Haupt, an dem wir erkannt und unterschieden werden, an ihm ist das Antlitz, an ihm sind alle Sinne, die Werkzeuge des Lebens und der Sprache, die Schönheit, die ersten Anzeichen und der Ausdruck der Freude oder Trauer, der Betrübnis oder Furcht, der Gesundheit oder Krankheit und aller Neigungen der Seele. Und dieses hat Jesus mit Dornen durchstechen und mit Blut und Speichel beflecken lassen wollen. Ja, es ist bemerkenswert, dass es unser Herr in keinem anderen Teil seines Leibes so viele Beschimpfungen, Verspottungen, Beleidigungen und Schandtaten erlitt, als in seinem liebevollen Antlitz. Kein anderer Umstand wurde von den Propheten so deutlich vorausgesagt, keiner ausführlicher von den Evangelisten erzählt. Alle diese Umstände wurden nicht ohne Absicht Gottes in den heiligen Schriften aufbewahrt.
Wie viele außerordentliche Gnaden, welche unverhoffte Bekehrungen, welche übernatürliche Erleuchtungen sind nicht durch diese Andacht erlangt worden.
Wer also die Ehre Gottes und das Heil des Nächsten befördern will, ehre mit inniger Andacht das heiligste, verdemütigte Antlitz unseres Erlösers mit vollkommenem Vertrauen.
________________________________________________________________________

14. Allerheiligen und Allerseelen
„Ihr alle, wer ihr immer seid,
Die ihr am Throne Gottes steht,
Seid uns zu helfen stets bereit,
Wenn unser Herz um Gnade fleht!“
(Aus dem Festhymnus)
1.
Allerheiligen.
Das kirchliche Jahr naht wieder seinem Ende. Die merkwürdigsten Ereignisse der Erlösung sind in den Festen des Herrn gefeiert. Auch die heilige Jungfrau Maria, die am Werk der Erlösung so großen Anteil hatte, hat ihre Ehrenfeste erhalten. Ebenso hat die Kirche das Andenken einiger Heiligen durch Festtage ausgezeichnet. Unzählig aber, wie die Zahl der Sterne am nächtlichen Himmel, ist die Schar der Heiligen, deren Namen nicht im Kalender stehen und die wir nicht kennen, die aber nicht minder als die uns bekannten Heiligen für die Krone der ewigen Seligkeit gekämpft haben und wie jene in die Anschauung Gottes eingegangen sind. Und doch möchte die Kirche alle Heiligen auszeichnen und allen Liebe, Dankbarkeit und Verehrung erweisen, wie sie dieselbe verdienen. Was ist also natürlicher, als dass die Kirche ein Fest für alle Heiligen feiert, damit alle geehrt werden.
Das Fest Allerheiligen geht uns selbst noch näher an, als viele glauben möchten. Wenn wir nämlich, wie dieses Fest uns anleitet, unsere Blicke nach oben richten und im Geist eintreten in das himmlische Jerusalem und da Rundschau halten unter den Geistern der vollendeten Gerechten, was sagt uns unsere Hoffnung?
Wir hoffen zuversichtlich unter diesen Scharen auch die Großzahl der uns im Tod vorangegangenen lieben Angehörigen zu finden. Wir machen also da im Geist unseren eignen Familiengliedern in der Seligkeit einen Besuch und erfreuen uns in den Gedanken, dass diejenigen, die vielleicht unter unseren eigenen Augen die Last des Lebens getragen, für ihr ewiges Leben getreu gearbeitet, auf Gott gehofft und ihm zuliebe geduldet haben, nun auch ihr ewiges Erbe besitzen und dort ausruhen von den Mühen ihres Lebens.
Mehr als irgend ein Tag im ganzen Jahr dient uns sodann dieses Festtag auch als Erinnerung, dass wir selbst berufen sind, Heilige zu werden, d.h. dereinst in den Himmel zu kommen. Das sagen uns diese Heiligen alle, denn sie waren nicht etwa andere Menschen, sozusagen aus anderem Stoff gebildet, als wir, sondern gleich uns sündige und durch die heilige Taufe gereinigte Geschöpfe. Viele von ihnen gehörten dem gleichen Stand, demselben Alter und Geschlecht an, wie wir, lebten in denselben, vielleicht noch größeren Gefahren der Verführung, wie wir; sie hatten die gleichen bösen Neigungen und Leidenschaften zu bekämpfen, vielleicht noch größere, als wir, fanden dieselben Hindernisse bei der Ausübung des Guten, ja vielleicht noch mächtigere, als wir sie alle finden; sie hatten keine anderen Gnadenmittel, keine anderen heiligen Sakramente, als wir und dennoch siegten sie und errangen die Krone der Unsterblichkeit.
Das alles soll uns ermutigen, das Beispiel der Heiligen nachzuahmen, unsere Sehnsucht nach dem Himmel zu wecken, für den geschaffen zu sein, wir heute mehr als je fühlen. Mit dem heiligen Augustin sollen wir beim Anblick der Heiligen sagen: „Konnten es diese, warum nicht auch ich?“ Und unter ihnen, so sagt uns unsere Hoffnung, befinden sich wohl viele unserer lieben Angehörigen. Sag, lieber Christ, gibt uns das nicht die größte Zuversicht, dass sie vom Himmel her mit ihrer mächtigen Fürbitte uns unterstützen werden?
Hört auch die irdische Liebe mit dem Tod auf, so ist doch darum gewiss dem Vater der Sohn, der Mutter das Kind, dem Gatten die Gattin, dem Freund der Freund nicht gleichgültig geworden und mit unendlich größerem Eifer und reinerer Liebe noch als sie jemals während ihres irdischen Lebens für das Wohl ihrer Angehörigen sorgten, werden sie jetzt durch ihre Gebete für uns Sorge tragen.
2.
Allerseelen.
Wie sehnlich wir indes hoffen, dass all unsere lieben Angehörigen, die uns im Tod vorangegangen, sich unter der Zahl der Seligen befinden, haben wir doch hierfür keine völlige Gewissheit. Im Gegenteil, wenn wir bedenken, dass nur derjenige, der ganz rein, ganz makellos, ganz heilig ist, zur Anschauung des reinsten und heiligsten Gottes zugelassen wird, können wir uns der bangen Sorge nicht entschlagen, ob nicht vielleicht lässliche Sünden oder zeitliche Sündenstrafen für bereits vergebene Sünden (auch wenn sie fromm gelebt und wohl vorbereitet gestorben sind) noch am Ort der Reinigung zurückbehalten, um durch Leiden jene Vollkommenheit erst zu erlangen, der die Pforten des Himmels sich erschließen.
Sieh, lieber Christ, darum reiht sich unwillkürlich an das Fest Allerheiligen die Allerseelenfeier, die uns hinausführt zu den Gräbern unserer lieben Angehörigen und uns ermuntert, denen, die noch am Ort der Reinigung verweilen, zu helfen, damit auch sie umso schneller Aufnahme finden in der Zahl der Seligen und Heiligen des Himmels. Denn je mehr uns das Fest Allerheiligen Gelegenheit bietet, die Freuden und das Glück der Seligen zu betrachten, umso schmerzlicher müssen wir es fühlen, dass noch so viele dieser Freude und Seligkeit entbehren und umso eifriger muss es uns angelegen sein, dass wir durch Gebet und gute Werke, durch Lesenlassen und Anhören von heiligen Messen, durch den Empfang der heiligen Sakramente und Zuwendung möglichst zahlreicher und großer Ablässe, ihnen Erlösung aus ihrer Pein und recht baldige Erreichung des so heiß ersehnten Glücks erwerben.
Vielleicht sind es sogar solche, die um unsertwillen manches Gute unterlassen, die durch unsere Schuld dort noch zu büßen und zu leiden haben – unsere nächsten Angehörigen, Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde, die wir während ihres Lebens auf das Innigste geliebt haben und denen wir mit Freuden jeden Dienst erwiesen hätten. Einen schöneren Dienst aber, eine größere Wohltat, eine herzlichere Liebe, als es während ihres ganzen Lebens möglich war, können wir ihnen jetzt durch unsere Fürbitte erweisen.
So sind die Tage von Allerheiligen und Allerseelen ein wunderbar schönes und erhabenes Familienfest der Kinder Gottes. Die heilige Liebe verbindet die Seligen des Himmels und die Seelen im Fegfeuer mit den Gläubigen auf Erden zum vereinten Gebet: „ut omnes unum sint!“ dass wir alle vereint seien, dort dereinst: wo unser Glaube in Schauen und die Hoffnung in Besitz übergeht, die Liebe aber ewig bleibt! Amen.
________________________________________________________________________

15. Andalusien
Muttergottesverehrung in Andalusien
Andalusien heißt bei den Spaniern la tierra de Maria Santisima, das Land der allerheiligsten Jungfrau. Der feierlichste Schwur, den ein Andalusier tut, geschieht immer bei der heiligen Jungfrau. In allen Herzensnöten, in allen schwierigen Unternehmungen ruft er Maria Santisima an. Wer kennt nicht die berühmten Gemälde von Villegas und von Sorolla, die einen in gleicher Stellung betenden Stierfechter darstellen? Der Stierfechter fleht die Jungfrau an, damit die Stiere ihn verschonen mögen.
In der seit Bizets Oper „Carmen“ berühmt gewordenen Tabakfabrik zu Sevilla gibt es beiläufig 10.000 Arbeiterinnen, Cigarreras. Ihre Schutzpatronin ist Unsere Liebe Frau de la Victoria, deren Bild jedes Jahr von den Cigarreras reichlich beschenkt wird. Unter den Wundertaten, die dieses Muttergottesbild zu Ansehen gebracht haben, erzählt man nachstehende:
Einige hundert Zigarrenarbeiterinnen hatten vor einigen Jahren um Weihnachten ein Los gekauft. Der Haupttreffer der Lotterie beträgt 6 Millionen Pesetas. Eine der Cigarreras schlug den Genossinnen vor, der Mutter Gottes de la Victoria einen Losanteil zu geben. Das werde Glück bringen, meinte sie. Der Vorschlag wurde angenommen, und siehe, die Cigarreras gewannen ein größeres Los! Die Mutter Gottes bekam die stattliche Summe von 20.000 Pesetas ab.
Vergangenes Jahr hatten die sevillanischen Tabakfabrikarbeiterinnen der Virgen ein schweres Anliegen vorzubringen. Vor einigen Monaten waren die heißblütigen Frauen wegen einer Lohnfrage wild geworden und hatten in der Fabrik, um ihren Ansprüchen Geltung zu verschaffen, alles kurz und klein geschlagen. Die Folge davon war, dass die Rädelsführerinnen, etwa vierzig an der Zahl, aus der Fabrik entlassen wurden und seitdem am Hungertuch nagten. Alle ihre Bemühungen, wieder zur Arbeit zugelassen zu werden, waren gescheitert. Selbst der Erzbischof von Sevilla konnte, als er bei der Tabakmonopol-Gesellschaft zugunsten der entlassenen Cigarreras zu intervenieren suchte, nichts ausrichten. Da dachten die armen Mädchen: Jetzt kann nur noch die Virgen de la Victoria helfen. Sie taten sich zusammen, brachten ihre letzte Habe zum Opfer und kauften der Maria Santisima eine goldene Krone mit weißen Atlasschleifen, auf denen in goldenen Lettern die Worte eingestickt waren: „A la Virgen de la Victoria la Cigarreras de Sevilla“. Sie nahmen das Bild der genannten Madonna aus der Pfarrkirche und trugen es, unter lauten Vivatrufen, wie dies in Sevilla üblich ist, nach der Tabakfabrik. Alle Arbeiterinnen der letzteren hatten sich der Prozession angeschlossen. Das Madonnenbild trug eine große Rolle Papier in den Händen.
Als der Verwalter der Fabrik das Madonnenbild und die Prozession erblickte, trat er hervor und als echter Andalusier ließ er einen großen Blumenstrauß kommen, mit dem er das Bild schmückte. Die Arbeiterinnen empfingen ihn mit Beifallsjauchzen und sagten ihm, die Papierrolle, die die Maria Santisima trage, sei für ihn bestimmt. Der Verwalter nahm die Rolle in Empfang, öffnete und las sie. Es war ein Gesuch der heiligen Jungfrau, die ihn bat, mit ihren Schutzkindern, den entlassenen Cigarreras, Erbarmen zu haben. Der Verwalter lächelte gnädig und erklärte, dass er der Bitte der Maria Santisima natürlich nachgeben müsse und dass die entlassenen Cigarreras wieder zugelassen seien.
Vossische Zeitung 1911
________________________________________________________________________

16. Antimodernisteneid
(Quelle: Kathpedia - Die freie katholische Enzyklopädie)
Der Antimodernisteneid wurde am 1. September 1910 vom hl. Papst Pius X. mit dem Motu proprio "Sacrorum antistites" für alle Kleriker vorgeschrieben. Den Eid mussten ablegen: alle Subdiakone und alle Priester vor ihrer Weihe, alle Pfarrer und Chorherren vor Übernahme ihres Amtes, alle Beamten der bischöflichen und päpstlichen Kurie, alle Seminarprofessoren und Ordensoberen. 1967 schaffte Papst Paul VI. den Antimodernisteneid ab.
Der Text des Antimodernisteneids lautet:
Ich, N.N., umfasse fest und nehme samt und sonders an, was vom irrtumslosen Lehramt der Kirche definiert, behauptet und erklärt wurde, vor allem diejenigen Lehrkapitel, die den Irrtümern dieser Zeit unmittelbar widerstreiten.
Erstens: Ich bekenne, dass Gott, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, mit dem natürlichen Licht der Vernunft "durch das, was gemacht ist" (Röm 1,20), das heißt, durch die sichtbaren Werke der Schöpfung, als Ursache vermittels der Wirkungen sicher erkannt und sogar auch bewiesen werden kann.
Zweitens: Die äußeren Beweise der Offenbarung, das heißt, die göttlichen Taten, und zwar in erster Linie die Wunder und Weissagungen lasse ich gelten und anerkenne ich als ganz sichere Zeichen für den göttlichen Ursprung der christlichen Religion, und ich halte fest, dass ebendiese dem Verständnis aller Generationen und Menschen, auch dieser Zeit, bestens angemessen sind.
Drittens: Ebenso glaube ich mit festem Glauben, dass die Kirche, die Hüterin und Lehrerin des geoffenbarten Wortes, durch den wahren und geschichtlichen Christus selbst, als er bei uns lebte, unmittelbar und direkt eingesetzt und dass sie auf Petrus, den Fürsten der apostolischen Hierarchie, und seine Nachfolger in Ewigkeit erbaut wurde.
Viertens: Ich nehme aufrichtig an, dass die Glaubenslehre von den Aposteln durch die rechtgläubigen Väter in demselben Sinn und in immer derselben Bedeutung bis auf uns überliefert wurde und deshalb verwerfe ich völlig die häretische Erdichtung von einer Entwicklung der Glaubenslehren, die von einem Sinn in einen anderen übergehen, der von dem verschieden ist, den die Kirche früher festhielt; und ebenso verurteile ich jeglichen Irrtum, durch den an die Stelle der göttlichen Hinterlassenschaft, die der Braut Christi überantwortet ist und von ihr treu gehütet werden soll, eine philosophische Erfindung oder eine Schöpfung des menschlichen Bewusstseins setzt, das durch das Bemühen der Menschen allmählich ausgeformt wurde und künftighin in unbegrenztem Fortschritt zu vervollkommnen ist.
Fünftens: Ich halte ganz sicher fest und bekenne aufrichtig, dass der Glaube kein blindes Gefühl der Religion ist, das unter dem Drang des Herzens und der Neigung eines sittlich geformten Willens aus den Winkeln des Unterbewusstseins hervorbricht, sondern die wahre Zustimmung des Verstandes zu der von außen aufgrund des Hörens empfangenen Wahrheit, durch die wir nämlich wegen der Autorität des höchst wahrhaftigen Gottes glauben, dass wahr ist, was vom persönlichen Gott, unserem Schöpfer und Herrn, gesagt, bezeugt und geoffenbart wurde.
Ich unterwerfe mich auch mit der gehörigen Ehrfurcht und schließe mich aus ganzem Herzen allen Verurteilungen, Erklärungen und Vorschriften an, die in der Enzyklika "Pascendi" und im Dekret "Lamentabili" enthalten sind, vor allem in Bezug auf die sogenannte Dogmengeschichte. Ebenso verwerfe ich den Irrtum derer, die behaupten, der von der Kirche vorgelegte Glaube könne der Geschichte widerstreiten, und die katholischen Glaubenslehren könnten in dem Sinne, in dem sie jetzt verstanden werden, nicht mit den wahren Ursprüngen der christlichen Religion vereinbart werden.
Ich verurteile und verwerfe auch die Auffassung derer, die sagen, der gebildetere christliche Mensch spiele eine doppelte Rolle, zum einen die des Gläubigen, zum anderen die des Historikers, so als ob es dem Historiker erlaubt wäre, das festzuhalten, was dem Glauben des Gläubigen widerspricht, oder Prämissen aufzustellen, aus denen folgt, dass die Glaubenslehren entweder falsch oder zweifelhaft sind, sofern diese nur nicht direkt geleugnet werden.
Ich verwerfe ebenso diejenige Methode, die Heilige Schrift zu beurteilen und auszulegen, die sich unter Hintanstellung der Überlieferung der Kirche, der Analogie des Glaubens und der Normen des Apostolischen Stuhles den Erdichtungen der Rationalisten anschließt und - nicht weniger frech als leichtfertig - die Textkritik als einzige und höchste Regel anerkennt.
Außerdem verwerfe ich die Auffassung jener, die behaupten, ein Lehrer, der eine theologische historische Disziplin lehrt oder über diese Dinge schreibt, müsse zunächst die vorgefasste Meinung vom übernatürlichen Ursprung der katholischen Überlieferung oder von der von Gott verheißenen Hilfe zur fortdauernden Bewahrung einer jeden geoffenbarten Wahrheit ablegen; danach müsse er die Schriften der einzelnen Väter unter Ausschluss jedweder heiligen Autorität allein nach Prinzipien der Wissenschaft und mit derselben Freiheit des Urteils auslegen, mit der alle weltlichen Urkunden erforscht zu werden pflegen.
Ganz allgemein schließlich erkläre ich mich als dem Irrtum völlig fernstehend, in dem die Modernisten behaupten, der heiligen Überlieferung wohne nichts Göttliches inne, oder, was weit schlimmer ist, dies in pantheistischem Sinne gelten lassen, so dass nichts mehr übrig bleibt als die bloße und einfache Tatsache, die mit den allgemeinen Tatsachen der Geschichte gleichzustellen ist, dass nämlich Menschen durch ihren Fleiß, ihre Geschicklichkeit und ihren Geist die von Christus und seinen Aposteln angefangene Lehre durch die nachfolgenden Generationen hindurch fortgesetzt haben.
Daher halte ich unerschütterlich fest und werde bis zum letzten Lebenshauch den Glauben der Väter von der sicheren Gnadengabe der Wahrheit festhalten, die in "der Nachfolge des Bischofsamtes seit den Aposteln" ist, war und immer sein wird; nicht damit das festgehalten werde, was gemäß der jeweiligen Kultur einer jeden Zeit besser und geeigneter scheinen könnte, sondern damit die von Anfang an durch die Apostel verkündete unbedingte und unveränderliche Wahrheit „niemals anders geglaubt, niemals anders“ verstanden werde.
Ich gelobe, dass ich dies alles treu, unversehrt und aufrichtig beachten und unverletzlich bewahren werde, indem ich bei keiner Gelegenheit, weder in der Lehre noch in irgendeiner mündlichen oder schriftlichen Form, davon abweiche. So gelobe ich, so schwöre ich, so wahr mir Gott helfe und diese heiligen Evangelien Gottes.
________________________________________________________________________

17. Amen
1. Herkunft und Geschichte.
Schon in der Sprache der alten Chaldäer, Syrer und Hebräer bedeutete Amen soviel wie „Wahrheit und Treue“, es war Schwur- und Segensformel zugleich. Aus ihrem Sprachschatz hat die Kirche das Wort übernommen und schon in frühester Zeit im gleichen Sinn verwendet. Das bezeugen in oft lapidarer Kürze die ältesten christlichen Grabinschriften. Schlicht heißt es auf einem Katakombengrab: „In pace, amen.“ Sieghaft klingt es als Bekräftigung auf einem attischen Grabstein: „Gesiegt hat Christus, amen, es geschehe!“ Als Schlusspunkt des Gebetes steht es z.B. auf einem Grab in Nordafrika: „Victorina in Christo, amen.“ „Rührendes Vertrauen, felsenfeste Heilsgewissheit sprechen aus diesem, nur aus drei Worten verfassten Gebet . . . (es ist) ein monumentales Credo.“
2. Das Amen im Mund des Herrn.
Die ehrwürdige Katharina Emmerich erklärte einmal dem Dichter Brentano, der ihre Gesichte aufzeichnete: Der liebe Heiland hielt einst eine große Lehre über das Wörtchen „Amen“. Er sagte, dass es die ganze Summe des Gebetes sei. Wer es leichthin spreche, der vernichte sein Gebet. Das Gebet rufe zu Gott, verbinde uns mit Gott, tue uns seine Barmherzigkeit auf und mit dem Wort „Amen“, so wir recht gebetet haben, nehmen wir die Gabe aus seinen Händen. Er sprach gar wunderbar von der Kraft des Wortes „Amen“. Er nannte es Anfang und Ende von allem, und er sagte fast, als habe Gott die ganze Welt damit geschaffen. Er sprach auch das „Amen“ über alles, was er lehrte, über seinen Abschied und endete feierlich mit „Amen“.
3. Das Amen eines Sterbenden.
Eines Tages, so erzählt Pater Hegglin S.J. aus Bombay, wurde ein Schwarzer aus Sansibar in das Spital gebracht, wo der Missionar wirkte. Er war Matrose und hieß Ambir Hussein. Am Namen erkannte man sofort den Mohammedaner. Der Schwarze war ein ungemein gutmütiger Mensch und betete gern und innig, und der Missionar mit ihm. Endlich wagte es P. Hegglin, den Namen Jesus auszusprechen, denn ein Wagnis war es, da überzeugte Mohammedaner beim ersten solchen Versuch scheu werden und dann gern ihren Gottesnamen Allah mit Nachdruck widerholen. Ambir Hussein aber betete kindlich innig nach: „Jesus Christus, vergib mir!“ „Du bist der Sohn Gottes“, betete der Missionar vor. Der Kranke widerholte. „Du bist für uns am Kreuz gestorben.“ Der Schwarze betete mit. Bald wurde er getauft. Von da an betete er womöglich noch mehr und noch glühender nach, was ihm P. Hegglin vorsagte. Da er aber immer schwächer wurde, erklärte ihm der Missionar, es sei genug, wenn er bei jedem Satz, den er vorspreche, mit „Amen“ antworte. Den Gebrauch des „Amen“ kennt ja auch jeder Moslem. Und so entstand denn ein ebenso merkwürdiges, wie rührendes Beten zwischen dem Missionar und dem Kranken. „Gott, du bist mein Herr!“ „Amen.“ „Ich bin ein armer Sünder.“ „Amen.“ „Vergib mir!“ „Amen.“ „Ich glaube an dich.“ „Amen.“ „Jesus Christus!“ „Amen.“ „Sohn Gottes!“ „Amen.“ „Erlöser der Welt!“ „Amen.“ „Dir schenke ich meinen Leib und meine Seele.“ „Amen.“ So starb der Kranke, schreibt der Missionar, fern von seiner Heimat, aber fromm und ergeben als Gotteskind. Hoffen wir, dass Gott auch seinerseits zu seinem treuen Beten Ja und Amen sagte.
(Aus: Homiletisches Handbuch, Anton Koch, 1950, Band 11, Seite 456)
________________________________________________________________________

18. Auferstehung der katholischen Kirche in England
Vor ungefähr 170 Jahren kam die Kirche in England wieder aus den Katakomben heraus.
(Von Roger Capel, zusammengefasst aus „St. Joseph Magazine“, Mt. Angel Abbey, St. Benedict Ore., September 1950)
Das London von heute (1950) mit seinen rund 200 katholischen Kirchen und nahezu 1000 katholischen Priestern bietet ein sehr verschiedenes Bild von dem London zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Zu jener Zeit war es zwar schon kein Vergehen mehr, die hl. Messe zu feiern oder ihr beizuwohnen, wenn sich auch die Leute, die damals lebten, noch auf die Zeit, in der das der Fall war, erinnern konnten. Die Katholikengesetze von 1778 und 1791 hatten einige der einschneidendsten Verbote aufgehoben. Die Katholiken konnten von nun an ihren Glauben offen bekennen und ausüben. Vorbei waren die Tage, in denen unter dem heiligmäßigen Bischof Challoner, dem apostolischen Vikar von London, die Katholiken sich mit ihrem Geistlichen an einem Wirtshaustisch versammeln mussten, um dort – bei einem Glas Bier der Predigt ihres Pfarrers zu lauschen. Nach außen hatten diese Zusammenkünfte wie eine gewöhnliche Unterhaltung am Biertisch ausgesehen.
Im Jahr 1805 gab es 11 Kapellen in London. Man sprach in jenen Tagen nicht von Kirchen! Vier dieser Kapellen waren Gesandtschaftskapellen. In der Zeit vor Erlass der genannten Gesetze waren sie die einzigen Orte, wo die hl. Messe öffentlich gefeiert werden durfte, da sie zu den Gesandtschaften katholischer Nationen gehörten und die mit der Exterritorialität verbundenen Vorrechte genossen.
Kardinal Newman beschreibt die damalige gesellschaftliche Stellung der Katholiken und den Eindruck, den sie auf ihre Mitbürger vor 100 Jahren (1850) machten: „Es bestand weder mehr eine katholische Kirche noch eine katholische Gemeinde im Land. Man fand nur noch ein paar einzelne Anhänger der alten Religion, die schweigend und sorgenvoll umhergingen, gewissermaßen Denkmäler dessen, was einst gewesen war . . . eine Gruppe armer Iren, die zur Erntezeit aus Irland herüberkamen und danach wieder fortgingen, oder eine kleine irische Kolonie in einem Elendsviertel der Hauptstadt. Da und dort sah man vielleicht auch einmal eine ältere Person ernst, einsam und fremd durch die Straßen gehen, von der erzählt wurde, dass sie aus guter Familie stamme und römisch-katholisch sei. Oder man fand noch ein altmodisches, von hohen Mauern umgebenes düsteres Haus mit eisernem Tor, von dem das Gerücht ging, dass römische Katholiken in ihm lebten. Doch wer sie waren und was sie taten, konnte niemand sagen.“
Die Katholiken waren damals Leute, die nach dem Ende der Verfolgung soeben wieder aus dem Dunkel der Katakomben zum Licht emporstiegen und noch nicht recht wussten, welche Wirkung das Licht auf sie haben und wie sich ihre Mitbürger zu ihnen verhalten würden. Daher lebten sie abseits vom allgemeinen Strom des nationalen Lebens. Sie gingen regelmäßig an den Sonn- und Feiertagen zum „Gebet“ - von der hl. Messe sprach man länger als ein Jahrhundert öffentlich nicht -, und wenn der Gottesdienst vorbei war, verschwanden sie wieder schweigend. Sonst wurden die Kirchen nicht aufgesucht. Man hielt sie der Sicherheit halber geschlossen.
Diese englischen Katholiken zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren streng in ihrem täglichen Leben: Die Abstinenz an Freitagen und die Fastenzeit wurden genau eingehalten. Von Aschermittwoch bis Ostern gab es kein Fleisch und zur Abendbrotzeit weder Käse noch Butter, Milch oder Fisch.
Außerhalb der Kirche kleidete sich der Geistliche genau wie die anderen Männer und trug in der Regel keine schwarze Kleidung. Selbstverständlich war der römische Kragen zu jener Zeit unbekannt.
Das Kircheninnere war damals ganz einheitlich und völlig schmucklos, zweifellos eine Folge der evangelischen Umgebung. In der Regel gab es nur einen Altar. Seitenaltäre, Muttergottes- und Heiligenstatuen, ja selbst Kreuzwegstationen fehlten völlig. Auch ein Beichtstuhl war nur selten zu finden. Der Geistliche hörte die Beichten zu Hause. Oft hat man die Szene beschrieben, wie die Leute am Samstagabend im Haus des Priesters die Treppe auf den Knien erstiegen und warteten, bis die Reihe zur Beichte an sie kam.
Die Kirchenmusik damals war opernhaft. In London bildeten bezahlte Kräfte von der Oper den Chor. Die Predigten waren viel länger als heute und im Stil der Sprache jener Tage angeglichen. Wir würden sie heute theatralisch finden.
Das Gesamtbild des englischen Katholizismus jener Zeit ist das eines treuen Restes von Gläubigen, die hartnäckig an den wesentlichen Bestandteilen des Glaubens festhielten, aber auf jede größere Kundgebung und Wirkung nach außen verzichten mussten. Doch ereigneten sich zwei Dinge, die diesen Zustand ändern sollten: Das erste war die starke Einwanderung von Iren in die großen Städte Englands, das zweite die Ernte von Konvertiten, die durch die sogenannte Oxfordbewegung zur Kirche kamen.
Vor 1845 waren Konvertiten in England eine Seltenheit gewesen. In diesem Jahr wurde Newman in die Kirche aufgenommen, und eine Zeitlang hatte es den Anschein, als ob es zu einer ganzen Flut von Bekehrungen käme. Die meisten Konvertiten waren Menschen von überdurchschnittlicher Bildung, was das Ansehen der Katholiken im Land außerordentlich hob.
Einige Jahre vor diesen Ereignissen waren Verhandlungen über die Wiedererrichtung der Diözesanbischofsstellen geführt worden, aber verschiedene missliche Vorkommnisse hatten die Angelegenheit verzögert. Schließlich aber war es soweit, dass Papst Pius IX. ein Breve veröffentlichen konnte, in dem er die Hierarchie in England wiederherstellte. Es trug das Datum des 29. September 1850. Der apostolische Vikar von London, Nicholas Wiseman, wurde nach Rom berufen und zum Kardinal ernannt. Im Breve des Papstes war er für den neu zu errichtenden Stuhl von Westminster ausersehen. Gleichzeitig wurden 11 andere Bistümer errichtet.
Kardinal Wiseman erließ noch von Rom aus sofort einen Hirtenbrief, in dem er seine Ernennung bekanntgab. Dieser wurde in der „Times“ veröffentlicht und erregte unter den Nichtkatholiken gewaltiges Aufsehen und löste einen wahren Sturm im Land aus. Die Zeitungen, voran die Times, wandten sich mit scharfen Worten gegen die „päpstliche Eroberung“, und die Königin Viktoria selbst war außerordentlich verärgert. Sie ließ den Innenminister kommen und erklärte ihm: „Ich bin die Königin von England und werde das nicht dulden!“ Die Witzblätter brachten Woche für Woche Karikaturen.
Aber unbeirrt durch diesen Aufruhr, setzte der Kardinal sein Werk der Wiederherstellung der katholischen Kirche in England friedvoll fort. Die Nachrichtenverbreitung erfolgte zu jener Zeit nicht so schnell wie heute, so dass der Kardinal erst 6 Wochen nach Erlass seines Hirtenbriefes bei seiner Ankunft in Brügge die englischen Zeitungen sah. Er erhielt auch Briefe von einigen seiner Geistlichen, die ihm rieten, sich in England erst sehen zu lassen, wenn der Sturm sich gelegt habe.
Aber das war nicht die Art eines Kardinal Wiseman. Am 11. November kam er in London an. Sofort machte er sich daran, die Gemüter im Land durch beruhigende Briefe an die Regierung und eine lange Flugschrift zur Erklärung seiner früheren Ausführungen zu beschwichtigen, was ihm schließlich auch gelang. Im Jahr 1852 versammelten sich die englischen Bischöfe zu einer Konferenz, womit ein Jahrhundert normalen katholischen Lebens nach so langer Verfolgungszeit eingeleitet wurde.
Seit jener Zeit ist England in 3 Erzbistümer eingeteilt. Die Zahl der Diözesen wurde vermehrt. Die katholische Bevölkerung stieg auf nahezu 4 Millionen. Es gibt heute (1950) viele Klöster in England und mehr Klosterschwestern als vor der Trennung im 16. Jahrhundert. Damit hat der Katholizismus wieder seinen alten Platz im Leben der Nation eingenommen.
________________________________________________________________________

19. Der Ablass 2.0
1. Wichtigkeit des Ablasses:
Wie die Bußandacht zum besseren, nicht zum selteneren Empfang des Bußsakramentes führen sollte, so wollte auch Papst Paul VI. durch die "Konstitution über die Neuordnung des Ablasswesens vom 1.1.1967" den Ablass nicht zurückdrängen, sondern tieferes Verständnis und größeren Eifer bewirken. Geht es doch dabei vor allem um unsere leidenden und hilflosen Brüder und Schwestern am Ort der Reinigung. Und wie sehr bittet Maria als Königin des Fegfeuers um unsere Mithilfe, um so recht Mutter der Barmherzigkeit sein zu können.
Die wirksamsten Mittel der Heiligung und Reinigung für uns und die Verstorbenen sind: das hl. Messopfer, die heilige Kommunion und die anderen Sakramente. Weil aber die Zahl der Priester und damit der hl. Messen bei uns ständig abnimmt, sollen wir selbst möglichst oft daran teilnehmen, Messstipendien dorthin geben, wo die Priester sie nur schwer erhalten (Mission, Verfolgungsländer: kirche-in-not.de/wie-sie-helfen/spenden/mess-stipendien-online ) und: neben Sakramentalien, Gebet und Buße das Angebot des Ablasses möglichst gut auswerten. Dazu hier das Wichtigste aus der genannten Konstitution.
2. Begründung des Ablasses:
In Gottes Heiligkeit, Gerechtigkeit, Weisheit und Barmherzigkeit gründete die Notwendigkeit von Sündenstrafen und ihre Abbüßung auch nach der Sündenvergebung - entweder im Leben oder im Fegfeuer. Wie leichtsinnig würden wir werden, hätten die Sünden keine schlimmen Folgen!
3. Wesen des Ablasses:
Er ist Nachlass zeitlicher Strafen für Sünden, die der Schuld nach schon getilgt sind. Jesus teilt dabei durch seinen Stellvertreter die unerschöpflichen Schätze seiner eigenen Verdienste aus. Dazu kommen die Verdienste, die er in Maria, seiner Mutter und ehilfin (neue Eva), und die er durch sie in den Heiligen bewirkte. So lehrt unsere heilige Kirche.
4. Früchte des Ablasses:
Die Gläubigen erkennen, dass sie nicht aus eigener Kraft sühnen können, sie werden auf ihre Verbundenheit mit Jesus und untereinander hingewiesen, zur Nächstenliebe entzündet, vor Nachlässigkeit bewahrt und zur Unterordnung gegen den Stellvertreter Christi angeleitet.
5. Wirkung des Ablasses:
a) des Teilablasses:
Er befreit teilweise von Sündenstrafen. Vollbringt ein Christ mit reuigem Herzen ein Werk, das mit einem Teilablass versehen ist, so gibt die Kirche soviel Nachlass zeitlicher Sündenstrafen dazu, als er schon durch sein eigenes Tun empfängt. Dabei ist die Größe der Liebe der Maßstab für Verdienst und Sühne. (Darum sind auch die früheren Zeitangaben - so viel Tage, Monate, Jahre - weggelassen.) Der Teilablass verdoppelt also den Strafnachlass, damit auch die Hilfe für die Verstorbenen. Wie schade, wenn wir das nicht auswerten würden!
b) des Vollablasses:
Er befreit vollständig von allen Sündenstrafen. Das ist etwas sehr, sehr Großes und setzt ein entsprechendes Bemühen voraus (siehe 9d).
6. Anweisungen für den Ablass:
Ein Ablass, für den Kirchenbesuch verlangt ist, kann von Mittag vorher bis Mitternacht des festgesetzten Tages gewonnen werden. Dabei ist ein Vaterunser und der Glaube zu beten. Wird ein Fest, mit dem ein Ablass verbunden ist, verlegt, dann auch der Ablass. Ein Ablassgebet kann allein, gemeinsam, im Wechsel oder durch Vorbeter verrichtet werden. Bei Andachtsgegenständen erlischt der Ablass, wenn der Gegenstand wesentlich verdorben ist oder verkauft wird. (Darum immer erst kaufen, dann weihen lassen! Der Teilablass ist am gleichen Tag öfter, der Vollablass nur einmal möglich - außer dem Sterbeablass (siehe 10b). Kein Ablass ist anderen Lebenden, jeder aber den Verstorbenen zuwendbar, doch nur fürbittend, d.h. wir müssen es ganz Gott überlassen, wem und wie er ihn zuteilen will.
7. Voraussetzungen für alle Ablässe:
Der Gnadenstand, wenigstens bei Beendigung des vorgeschriebenen Werkes oder Gebetes und mindestens die allgemeine Absicht, die Ablässe zu gewinnen.
8. Möglichkeiten für Teilablässe:
Einen Teilablass kann gewinnen: Wer in seiner Pflichterfüllung und in den Mühen des Lebens in demütigem Vertrauen zu Gott aufschaut und dabei wenigstens im Geist ein Stoßgebet verrichtet. Wer im Geist des Glaubens sich selber oder seine Güter für die Notleidenden einsetzt. Wer in Bußgesinnung freiwillig auf Erlaubtes und Angenehmes verzichtet. Dadurch soll der Wert des christlichen Lebens betont, das tägliche Leben vom christlichen Geist durchdrungen und das Streben nach vollkommener Liebe angeeifert werden.
Dann werden etwa einhundert Übungen der Frömmigkeit angeführt, mit denen ein Teilablass verbunden ist. Sie alle zu nennen ist nicht möglich und nicht nötig. Es genügt ja die allgemeine Absicht (siehe Nr. /).
9. Voraussetzungen für Vollablässe:
a) Sakramentale Beichte (Bußandacht genügt nicht).
Mit einer hl. Beichte ist an mehreren Tagen ein Vollablass möglich. Sie kann mehrere Tage vorher oder nachher sein. Wer also regelmäßig, etwa monatlich, beichtet, erfüllt die erste Voraussetzung für den täglichen Vollablass.
b) Empfang der hl. Kommunion (Vollablass also nur am Kommuniontag).
c) Gebet nach Meinung des hl. Vaters:
Ein Vaterunser und Ave Maria oder sonst ein Gebet. (Am besten mit der Kommunion-Danksagung verbinden.)
d) Der gute Wille,
auch jede lässliche Sünde zu meiden, also ein Bemühen um einen hohen Grad von Gottes- und Nächstenliebe. Und dazu will ja der Ablass anspornen.
Wenn diese vier Voraussetzungen nicht alle erfüllt sind, wird es nur ein Teilablass.
10) Möglichkeiten für Vollablässe:
a) für jeden Tag:
eine halbe Stunde Anbetung (auch ohne Aussetzung) oder eine halbe Stunde Schriftlesung oder ein Kreuzweg (Verhinderte 1/2 Stunde Kreuzwegbetrachtung) oder ein Rosenkranz von fünf Gesätzchen: zusammenhängend, betrachtend, in der Kirche oder öffentlichen Kapelle, in einer klösterlichen Gemeinschaft oder Gebetsvereinigung (z.B. Bruderschaften). Beim gemeinsamen Beten sollen die Geheimnisse erwähnt werden, beim privaten Beten genügt es, sie nur zu betrachten. Für einzelne Gesätzchen ist ein Teilablass gewährt.
b) für bestimmte Tage und Anlässe:
"Veni Creator" an Neujahr und Pfingsten. "O guter und lieber Jeus" an den Fastenfreitagen. "Tantum ergo" am Gründonnerstag und an Fronleichnam. Taufgelübdeerneuerung in der Osternacht und am Tauftag. Gemeinsames Weihegebet am Herz-Jesu- und Christkönigsfest. 1. - 8. November: Friedhofsbesuch mit Gebet für die Verstorbenen. "Te Deum" an Silvester. Päpstlicher Segen, auch durch Radio oder Fernsehen. Teilnahme an Exerzitien, Mission, Erstkommunion, Primiz, Priesterjubiläum, Patrozinium, Kirchweih und Portiuncula. In der Sterbestunde, auch wenn der Sakramentsempfang nicht möglich ist, wenn der Sterbende auch sonst gebetet hat. Bestimmte Bruderschaftsablässe.
Zum Schluss noch eine Aussage der Päpstlichen Konstitution für die Bedeutung des Ablasses: "Es ist Lehre und Vorschrift der Kirche, den Ablass, der durch die Autorität heiliger Konzilien gebilligt und für das christliche Volk überaus segensreich ist, in der Kirche beizubehalten. Und wer behauptet, der Ablass sei unnütz oder die Kirche besitze keine Vollmacht dazu, wird mit Ausschluss bestraft."
________________________________________________________________________

20. Andacht zu den Bildern Marias
So alt als die Kirche, ist die Andacht zu den Bildern der allerseligsten Jungfrau für die Kinder Mariens immer eine reichhaltige Quelle des Segens gewesen.
Die Bilder Jesu Christi und der jungfräulichen Mutter Gottes, wie der anderen Heiligen, sagt das Konzil von Trient, sollen besonders in den Kirchen gehalten werden, und man muss ihnen die Ehre und Verehrung erweisen, die ihnen gebührt, nicht als glaube man, dass irgend eine Gottheit, oder eine Kraft in ihnen wohne, wegen der sie zu ehren seien, oder als habe man sie um etwas zu bitten, oder als solle man Vertrauen in sie setzen, wie ehemals bei den Heiden geschehen ist, die da ihre Hoffnung auf die Götzen bauen, sondern weil die Ehre, die man ihnen erweist, auf die Urbilder, die sie darstellen, bezogen wird, so dass wir durch die Bilder, die wir küssen und vor denen wir das Haupt entblößen und uns niederknien, Christus selber anbeten und die Heiligen, deren Abbilder sie sind, verehren.
Während Maria noch auf der Erde lebte, schätzten sich die ersten Christen glückselig, wenn sie vor ihrem Tod noch das unschätzbare Glück haben konnten, die erhabene Gottesmutter zu schauen. Der heilige Ignaz, der Martyrer, schrieb an den heiligen Evangelisten Johannes: Wenn du es erlaubst, so gehe ich nach Jerusalem, um Maria, die Mutter Jesu zu sehen, die wie man sagt, der Gegenstand der Bewunderung der ganzen Welt und die allgemeine Sehnsucht aller Völker ist. Wo ist denn, in der Tat, der gläubige Christ, der nicht eine große Freude darüber empfände, diejenige zu sehen und zu sprechen, die den wahren Gott geboren hat?
Der heilige Dionys, der Areopagite, begab sich aus Griechenland nach Judäa, um dieses Wunder von Gnade und Heiligkeit zu sehen, und er nahm an Maria etwas so Wunderbares und Göttliches wahr, dass er hoch beteuert, wenn der Glaube ihn nicht eines Besseren belehrt hätte, als seine Augen und seine Vernunft, so hätte er sie wie den wahren Gott angebetet.
Da aber doch nicht alle Christen ihre Heimat verlassen und eine so weite Reise unternehmen konnten, so wurde der heilige Lukas, der Maler und Arzt war, von Gott inspiriert, mehrere Bildnisse von ihr zu fertigen, die er dann an die verschiedenen entferntesten Kirchen sandte. Die Kirche von Jerusalem bewahrte eines von ihnen, das Eudoria, die Gemahlin des Kaisers Theodosius der Kaiserin Pulcheria sendete, die dafür zu Konstantinopel einen prachtvollen Tempel erbauen ließ, wie dies Nicephorus im dreizehnten Buch seiner Geschichte bezeugt.
Diejenigen, die einander lieben, tragen immer das Bildnis ihrer Freunde bei sich, besonders wenn sie abwesend sind, um ihren Schmerz zu täuschen, und sich wegen der Entfernung zu entschädigen.
Weil die heilige Jungfrau in ihrer Güte eure Mutter sein wollte, fromme Kinder Mariens, so tragt beständig ihr liebes Bild bei euch, stellt es in eurem Zimmer auf, betet immer unter seinen Augen: seine Gegenwart wird euch trösten in den Bitterkeiten des Lebens, euch heilige Gedanken eingeben und über alle Versuchungen des Teufels triumphieren lassen.
Der heilige Thomas von Aquin, der Engel der Schule, hatte das Bild Jesu und Mariens während der Arbeit beständig vor Augen, und er versicherte seine Schüler, dass er aus diesen Büchern jene tiefe Wissenschaft geschöpft habe, die ihn auf die erste Stufe der katholischen Lehrer gestellt hat.
Gebt der erhabenen Gottesmutter jedes Mal, wenn ihr eins ihrer Bildnisse antreffen werdet, ein Zeichen eurer Verehrung und eurer Liebe.
Ist Liebe zu Maria in deinem Herzen eingegraben,
So wirst du, im Vorbeigehn, stets ein Ave für sie haben.
Es ist ein heiliger und rührender Gebrauch, Kerzen und Lampen vor dem Bild der allerseligsten Jungfrau zu brennen, wenn man von ihr eine besondere Gnade erbitten will. Dieser fromme Gebrauch ist sehr alt in der Kirche und der Himmel hat durch große Wunder gezeigt, wie angenehm er der Mutter Gottes ist.
Die heilige Johanna von Valois, Königin von Frankreich, beschäftigte mit Vorliebe ihre königlichen Hände mit der Verzierung der Bilder und Altäre Mariens. Schätzt euch glücklich, nach ihrem Beispiel, mit dazu beizutragen, dass der Kult der Himmelskönigin vermehrt wird. Und wenn eure Umstände euch nicht erlauben, alles zu tun, was euer Herz gern tun möchte, so unterlasst nicht, vor ein Bild Mariens hinzutreten, und ihr da den reichen Duft eines inbrünstigen Gebetes, die Lilie der Keuschheit, die Rose der Nächstenliebe und das Veilchen der Demut darzubringen, um ihre Altäre zu verschönern und einzubalsamieren.
Maria hat durch die auffallendsten Wunder die Ehre belohnt, die man ihren Bildern erweist.
Karl der Große, der die heilige Jungfrau mit großer Frömmigkeit ehrte, widmete ihr in Deutschland drei Kirchen und wollte, dass ihr schützendes Bildnis, nachdem es die Zierde seines Palastes in Aachen ausgemacht hatte, auch sein Kaisergrab schützen sollte. Sein Sohn Ludwig der Fromme trug das Bild Mariens auf seinen Jagden und Reisen immer bei sich. Als er sich einmal, für kurze Zeit von seinem Gefolge getrennt, ganz allein im Wald befand, sprang er vom Pferd, nahm in der Eile seine mit goldenen Knöpfen besäten Panzerhandschuhe ab, zog das verehrte Bild von seiner Brust, stellte es an den Fuß einer Eiche und verrichtete sein Gebet davor. Später gab er es in die herrliche Abtei Hildesheim, die er zu ihrer Ehre errichten ließ.
Alle genuesischen Galeeren waren mit einem Muttergottesbild geziert und niemals würde, auch noch in unseren Tagen, ein Gondelführer der Lagunen eine neue Barke ins Meer gleiten lassen, ohne sie mit diesem heiligen Bild zu schmücken. Die Spanier, die zur göttlichen Mutter nicht weniger Andacht hatten, als die Italiener, trugen auf ihren mit Goldbarren beladenen Galionen ihre Bildsäule aus gediegenem Silber, vor der die abenteuernden Matrosen Isabellas morgens und abends beteten. Die Portugiesen schifften sich zur Entdeckung Ostindiens unter dem Schutz Mariens ein, und widmeten ihr zu Goa eine prächtige Kirche.
Man bewahrt zu Rom in der Kirche Santa Maria Maggiore ein Gemälde der Jungfrau mit dem Jesuskind auf dem Arm, das man dem Evangelisten Lukas zuschreibt. Der heilige Franziskus Borgia, dessen zärtliche Andacht zu Maria weltbekannt ist, ließ durch einen geschickten Maler eine Kopie davon nehmen und vervielfältigte sie hierauf, um Exemplare der Kopie an verschiedene Orte schicken zu können, überzeugt, das dies dazu beitragen würde, die Verehrung dieser Königin der Jungfrauen zu verbreiten. Der Pater Balthasar, der diese köstlichen Bilder gesehen hatte, wollte eins davon haben und bekam es auch von seinem General. Es konnte nicht in bessere Hände fallen, um es nutzbar zu machen. Anfangs trug er es bei seinen Reisen bei sich, im Vertrauen, dass es ihn in allen Gefahren beschützen würde. Zu Metine angekommen, ließ er es prächtig einrahmen und hängte es in die Noviziat-Kapelle, damit die Novizen, wenn sie es beständig vor Augen hätten, eine zärtliche Andacht zu Maria bekommen sollten, eines der mächtigsten Mittel, um die geeignete Vollkommenheit zu ihrem Ordensstand zu erlangen. Er selbst machte dem geliebten Bild häufige Besuche, betete gern sein Brevier vor ihm und brachte zuweilen ganze Nächte zu seinen Füßen zu, was ihm oft außerordentliche Gnaden erwirkte. Nicht zufrieden damit, trug er gewöhnlich einen kleinen Kupferstich bei sich, der nach diesem Bild gearbeitet war, nicht bloß als ein Zeugnis seiner Liebe, sondern auch als einen Schild gegen die Versuchungen. Er feierte die Feste dieser göttlichen Jungfrau mit doppelter Andacht. Auch waren es für ihn Tage der Gnade und besonderer Gunstbezeugungen. Ich will ein Beispiel anführen, das ich in seinem Tagebuch verzeichnet finde:
„Am Tag der Unbefleckten Empfängnis Mariens empfing ich in meinem Gebet zwei ganz besondere Erleuchtungen: die erste trieb mich an, Gott inbrünstig zu bitten, er möchte mir, nach so vielen in seinem Dienst zugebrachten Jahren, ein Herz geben ähnlich jenem, das seine heilige Mutter im Augenblick ihrer Empfängnis erhielt. Die zweite, indem sie mir mit großer Klarheit zeigte, dass er, als er uns sich schenkte, uns seinen Vater, uns seine Mutter schenkte, hat mir den Gedanken eingegeben, von ihm als eine neue Gnade zu verlangen, dass er uns ihnen dagegen darbringe und uns helfe, ihnen den Zoll unserer Ehrfurcht und liebenden Dankbarkeit zu entrichten. Diese beiden Gefühle machten einen tiefen Eindruck auf mich und sind noch meinem Herzen eingeprägt.“
Seine vertrauten Beziehungen zu Pater Guttierez, einem großen Diener Mariens, trugen noch dazu bei, dass seine Liebe zu ihr noch vermehrt wurde. Dieser Pater war, zum Lohn für jene zärtliche Andacht, oft mit Besuchen dieser erhabenen Königin beehrt worden, und unter anderem würdigte sie sich zu ihm zu kommen, um ihm für einen Dienst zu danken, den er ihr erwiesen hatte. Diese Tatsache verdient um so mehr angeführt zu werden, als Pater Balthasar selbst bei dem Vorfall beteiligt war. Der ehrwürdige Johann Avila hatte in einer Predigt gesagt, dass die Marien zuteil gewordene Gnade reichlicher gewesen sei, als die aller Menschen und Engel zusammen genommen, und diese Meinung gefiel dem Pater Balthasar und seinem Freund sehr, weil sie für ihre Königin ehrenvoll und ganz geeignet war, ihren frommen Dienern eine noch tiefere Ehrfurcht einzuflößen. Sie beschlossen, dem zufolge, sie volkstümlich zu machen, und in dieser Absicht baten sie den Pater Suarez, zu beweisen, dass diese Meinung mit der Lehre der Heiligen und mit der gesunden Vernunft übereinstimme, und folglich gründlich wahrscheinlich sei. Dieser Gottesgelehrte, der selbst eine große Andacht zur Mutter Gottes hatte, schrieb hierüber eine Abhandlung, die den beiden Vätern sehr gefiel, und später behandelte er diese Frage mit einer Ausführlichkeit, die nichts zu wünschen übrig lässt.
________________________________________________________________________

21. Ankleidegebet
Orationes ante Missam
ORATIONES
dicendae cum Sacerdos induitur
sacerdotalibus paramentis
Indulgentia 100 dierum pro singulis orationibus (748)
Cum lavat manus, dicat:
Da, Dómine, virtútem mánibus meis ad abstergéndam omnem máculam; ut sine pollutióne mentis et córporis váleam tibi servire.
Beim Waschen der Hände:
Gib Tugend, o Herr, meinen Händen, dass jeder Makel abgewaschen werde, damit ich Dir ohne Befleckung des Leibes und der Seele zu dienen vermag.
Ad amictum, dum ponitur super caput, dicat:
Impóne, Dómine, cápiti meo gáleam salútis, ad expugnándos diabólicos incúrsus.
Während er das Schultertuch über sein Haupt legt:
Setze, o Herr, auf mein Haupt den Helm des Heiles, um alle teuflischen Anfechtungen zu bezwingen.
Ad albam, cum ea induitur:
Deálba me, Dómine, et munda cor meum; ut, in sánguine Agni dealbátus, gáudiis pérfruar sempitérnis.
Während er die Albe anlegt:
Läutere mich, o Herr, und reinige mein Herz, damit ich, im Blut des Lammes weiß gewaschen, die ewigen Freuden genieße.
Ad cingulum, dum se cingit:
Præcínge me, Dómine, cíngulo puritátis, et exstíngue in lumbis meis humórem libídinis; ut máneat in me virtus continéntiæ et castitátis.
Während er das Zingulum anlegt:
Umgürte mich, o Herr, mit dem Gürtel der Reinheit und lösche aus meinen Lenden den Trieb der Begierlichkeit, damit in mir bleibe die Tugend der Enthaltsamkeit und Keuschheit.
Ad manipulum, dum imponitur bracchio sinistro:
Mérear, Dómine, portáre manípulum fletus et dolóris; ut cum exsultatióne recípiam mercédem labóris.
Während er den Manipel an den linken Arm legt:
Möge ich würdig sein, o Herr, den Manipel des Weinens und Schmerzes zu tragen, damit ich mit Jubel den Lohn der Arbeit empfange.
Ad stolam, dum imponitur collo:
Redde mihi, Dómine, stolam immortalitátis, quam pérdidi in prævaricatióne primi paréntis: et, quamvis indignus accédo ad tuum sacrum mystérium, mérear tamen gáudium sempitérnum.
Während er die Stola anlegt:
Gib mir, o Herr, das Kleid der Unsterblichkeit zurück, das ich durch den Fall des Stammvaters verloren habe, und obwohl ich unwürdig Deinem Geheimnis mich nahe, möge ich doch die ewige Freude verdienen.
Ad casulam, cum assumitur:
Dómine, qui dixisti: Iugum meum suáve est et onus meum leve: fac, ut istud portare sic váleam, quod cónsequar tuam grátiam. Amen.
Während er das Messgewand anlegt:
O Herr, der Du gesagt hast: ‚Mein Joch ist süß und meine Bürde leicht‘, gewähre mir, dass ich es so zu tragen vermag, dass ich Deine Gnade erlange. Amen.
________________________________________________________________________

22. Angst
Die Folgen der Angst
Aus: ""Semana", Madrid, 1963
Die Angst kann krank machen
"Passt auf, wenn der Wolf kommt! Der frisst euch auf!" Die kleinen Kinder rennen bei diesen Worten zitternd und angsterfüllt mit roten Backen und glänzenden Augen davon. Aber auch im Kino verwendet man Schreckgestalten, um die Menschen zu ängstigen.
Jedem steht es frei, sich Angst machen zu lassen, wenn ihm das Spaß bereitet. Auf keinen Fall aber darf man sich damit vergnügen, anderen Angst einzujagen; denn das Erschrecken kann schwere organische Folgen nach sich ziehen. "Vor Angst sterben", "vor Angst krank werden", sind nicht bloß Redensarten, sondern diese Redewendungen können zur Wirklichkeit werden.
Die Angst äußert sich ganz verschieden beim Kleinkind, beim Jugendlichen und beim Erwachsenen.
Das neugeborene Kind kennt keine Angst. Beim Platzen eines Reifens auf der Straße, beim Zuknallen einer Tür, bei einem Donnerschlag oder einem Stoß an die Wiege öffnet das Kleine die Augen und nimmt die Ärmchen auseinander, als ob es sich an etwas Nichtvorhandenes anklammern wollte. Das sind jedoch reine Nervenreflexe, die nichts mit dem Selbsterhaltungstrieb zu tun haben. Die Angst kommt erst mit den Jahren, und zwar in dem Maße, wie das Bewusstsein und die Erkenntnis erwachen. Nach und nach lernt das Kind das, was ihm Angst macht und was es fürchtet, kennen. Doch bis ins Alter von 8 Monaten weiß das Kind nichts von Gefahr. Eine heftige Gemütsbewegung kann nur eine Folge haben: schrilles Weinen. Darüber braucht man sich keine Sorgen zu machen, das ist lediglich ein Ventil für seine Nerven.
Das ältere Kind aber erträgt keine Angst. Es kann nicht mit ihr fertig werden, da es zu sehr phantasiebegabt und zu leichtgläubig ist. Ein Schrecken kann eine fixe Idee in ihm hervorrufen, die sich in Angst verwandelt und sich nach Jahren erst wieder legt. Angst kann aber auch verschiedene körperliche Folgen haben: Bettnässen, Krämpfe, Schlaflosigkeit, Albdrücken, Wahnvorstellungen, Appetitlosigkeit. Wir sollten das Kind daher weder illustrierte Zeitschriften ansehen lassen noch vor ihm über Dinge reden, die es ängstigen könnten. Und noch weniger dürfen wir ihm gruselige Märchen erzählen. Es hat schon genüg Ängste zu überwinden, z.B. die Finsternis, den Arzt, die Spritzen usw. Fügen wir also nicht noch andere dazu! Das Kind ist nicht in der Lage, sie zu "verdauen".
Wenn Kinder nachts aufwachen und schreien, so muss nicht immer "Angst" die Ursache sein. Vielleicht war das Abendessen zu schwer und zu reichlich, oder sie haben zu viele Süßigkeiten gegessen. Vor allem soll man Kindern nicht zu viel zu trinken geben, weder schwarzen Tee noch Kaffee oder Alkohol, auch nicht mit Wasser verdünnt. Am besten legt man sie erst zum schlafen hin, wenn die Verdauung begonnen hat. Nervöse Kinder beruhigt oft ein lauwarmes Bad (evtl. mit einem Zusatz von Lindenblüten) und gütiges Zureden. Doch erzähle man keine Geschichten, so gut sie auch sein mögen! Das regt nur die Phantasie an, anstatt zu beruhigen. Mit dem Heranwachsen wird das Kind dann schon lernen, seine Nerven zu beherrschen und seine Phantasie zu zügeln.
Anders ist es, wenn erwachsene Menschen Angst haben oder erschrecken. Im Laufe des Tages haben wir häufig Anlass zum Erschrecken: z.B. beim Kreischen einer Bremse oder beim Anblick eines Kindes, das vor ein Auto rennt. Sofort stellen wir in unserem Körper eine Reihe typischer Reaktionen fest: einen beschleunigten Puls, Herzklopfen, keuchenden Atem. Könnten wir in diesem Augenblick den Blutdruck messen, würden wir einen plötzlichen Anstieg feststellen. Wir können aus Angst in Schweiß geraten, fas das Bewusstsein verlieren oder eine Nervenkrise bekommen. All diese Erscheinungen werden hervorgerufen durch eine momentane Störung unseres sympathischen Nervensystems, das unser vegetatives Leben steuert. Urheber dieser Störung ist das Adrenalin, ein Hormon, das durch die Nebennierendrüsen ausgeschieden wird. Unter dem Einfluss der Angst schicken die Nebennieren eine zu große Menge Adrenalin in den Kreislauf. Sofort treten Drüsen und Verdauungssystem in Tätigkeit. Die Gallenblase leert sich, die Niere scheidet den Urin rascher aus. Der Mensch zeigt die Körperlichen Symptome der Angst.
Wenn wir nun einen anderen Menschen erschrecken, so erhebt sich die Frage: mit welchem Recht brechen wir so stark in fremdes Leben ein, dass wir sein körperliches und geistiges Gleichgewicht stören? Oft ist es nur Unüberlegtheit, manchmal aber auch Rücksichtslosigkeit, mit der wir andere Menschen behandeln. Wir nehmen keine Rücksicht auf ihre Ruhe, ihre Arbeit, ihre körperliche Verfassung und stellen unangenehme Fragen oder kommen mit den schwierigsten und unangenehmsten Problemen im ungeeignetsten Augenblick daher. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein körperlicher Angriff, d.h. wir rufen in unserem "Opfer" die gleichen Erscheinungen hervor, die uns quälen, wenn wir Angst haben. Und wenn der andere sich nicht bei guter Gesundheit befindet, kann es soweit kommen, dass er infolge der Angst eine Vergiftung erleidet. Das ist genauso, wie wenn man seinem Organismus plötzlich stärkere elektrische Schläge zumutet, als er vertragen kann.
Für einen Herzkranken können Angst und Schrecken tödliches Gift bedeuten. Sein ganzer Kreislauf ist ja ohnehin mangelhaft, da die "Pumpe", die ihn in Gang hält, angegriffen ist. Angstgefühle aber beschleunigen den Zustrom von Blut zum Herzen und überlasten es. Daraus folgen Herzklopfen und erhöhter Blutdruck mit seinen Gefäßkomplikationen, die zu einem tödlichen Herzschlag führen können.
Bei einer werdenden Mutter kann starkes Erschrecken eine Fehlgeburt oder eine Frühgeburt veranlassen. Der Schrecken kann Zusammenziehungen auslösen, die das Austreiben des Kindes zur Folge haben und durch kein Medikament zum Stillstand zu bringen sind.
Bei sehr nervösen Menschen haben Angstzustände oft unvorhergesehene und unberechenbare Folgen, wie länger andauernde Ohnmacht, Nervenkrisen, die an Irrsinn grenzen können, Krämpfe oder Erschlaffungen der Muskeln. Einen sehr nervösen Menschen häufig zu erschrecken, heißt ihn langsam, aber sicher umbringen.
Bei alten Menschen ist der ganze Organismus besonders empfindlich, weil er verbraucht ist. Das Herz reagiert wie das eines Herz-, das Nervensystem wie das eines Nervenkranken. Alte Leute soll man daher in angenehmer und friedlicher Umgebung leben lassen und ihnen jede Gemütserregung ersparen, sei es eine angenehme oder eine unangenehme; beide könnten verhängnisvoll werden.
Marcel Achard:
Unsere Angst nennen wir Vorsicht.
Die Angst der anderen nennen wir Feigheit.
________________________________________________________________________

23. Eine Auktion vor über 230 Jahren
Frankreich, im Juli 1798, während der ersten Tage der französischen Revolution:
Eine tausendköpfige Menge stürmte das nahe bei Paris gelegene Prunkschloss Versailles. Natürlich war jeder darauf aus, sich bei dieser einmaligen Gelegenheit an den Kostbarkeiten zu bereichern, die das Königsschloss barg; in Säcken und auf Karren schleppten die Leute ihre Beute nach Hause, und einer raffte unter anderem ein Kruzifix an sich, das er im Schmutz des Schlosshofes auflas. Später, als er daheim seine Beute näher untersuchte, schien ihm das schwere Metallding nichts wert; er warf es wütend in eine Kammer, wo es hinfort unter altem Gerümpel 35 Jahre lang liegen blieb und vergessen wurde. 1834 starb der Besitzer, ein Gewürzhändler aus Paris, und weil er weder Frau noch Kinder hatte, ließen die Erben seinen gesamten Besitz versteigern, um sich den Erlös zu teilen.
Zu dieser Zeit lebte in Paris ein junger Mann namens André Rosin, den eine fromme Mutter früh beten gelehrt hatte. Er war seit seinem zehnten Lebensjahr ganz ohne Eltern aufgewachsen, verdiente sein Brot als Maurerlehrling, und die wachsende Gottlosigkeit der Zeit rief in ihm den Wunsch hervor, Priester zu werden. Doch um Priester zu werden, brauchte er Geld. Und das besaß er nicht. Soviel Geld würde er niemals sparen können, wie er brauchte. Also schien ihm der größte Wunsch seines Lebens für immer versagt.
Es war an einem Sonntagnachmittag. Draußen schien freundlich die Sonne. Drinnen jedoch, in dem alten verräucherten Restaurant hockte André vor einer leeren Schüssel. Er hatte soeben gegessen. Ein Freund kam an seinen Tisch, setzte sich zu ihm und fragte:
"Nun, André, wie geht`s? Siehst heut so trübselig aus. Warst wohl noch nicht zur Kirche?"
André überhörte den Spott. "Ach, ich habe Sorgen", erwiderte er. "Ich könnte mich verbessern, weißt du. Ich könnte Verkäufer werden beim Tuchhändler Laurel, er hat es mir angeboten."
"So greif doch zu, du Glückspilz!"
"Wie kann ich zugreifen? Ein Verkäufer muss gut gekleidet sein. Sieh dir diesen schäbigen Anzug an, er ist mein bester. Die Schuhe haben lauter Flicken, mein Hemd franst aus. Und mit meinen Ersparnissen ist es auch nicht weit her - für 47 Franken bekommt man nicht viel heutzutage!"
Der Freund lachte. "Siebenundvierzig Franken sind mehr als genug!" rief er. "Du darfst halt nicht in den teuren Geschäften kaufen, sondern musst zu einer Versteigerung gehen; jedes Kind weiß, dass man dort am billigsten kauft!"
André Machte ein verlegenes Gesicht. Dass er nicht selbst darauf gekommen war!
Schon am Mittwoch darauf ließ er sich frei geben und ging zur Versteigerung, doch anscheinend vergebens. Es wurden vor allem Möbel verkauft, sowie ein Posten Gewürze nach dem andern, und als schließlich ein paar Kleidungsstücke an die Reihe kamen, waren sie bei weitem zu groß für ihn. Endlich, als nur noch allerlei Plunder und wertloses Gerümpel angeboten wurde, verließen die meisten Käufer das Haus, und auch André wollte sich eben zum Ausgang wenden, da stand plötzlich sein Freund vor ihm. "Nun", fragte der, "hast du bekommen, was du suchst?"
"Nein, es war überhaupt nichts Passendes dabei", erwiderte André betrübt. "Ich hätte mir den Gang sparen können."
Vom Versteigerungstisch her erscholl Gelächter. André sah hin. Der Mann mit dem Hammer stand dahinter, schwenkte ein Kruzifix und versuchte, es den wenigen Dagebliebenen aufzuschwatzen. Die aber machten Witze, spotteten und höhnten und ließen das Kruzifix reihum durch die Hände gehen.
Da gab sich André einen Ruck. Er stürzte zum Versteigerungstisch und riss den Spöttern das Kruzifix aus den Händen.
"Zehn Franken!" rief er. "Wer bietet mehr?"
Alle lachten, und sein Freund zupfte ihn heftig am Ärmel.
"Lass mich!" rief André. "Ich weiß, was ich tue!"
Er zahlte und verließ den Raum unter Gelächter und höhnisch gemeinten Segenswünschen der kleinen Versammlung.
Auch sein Freund war verärgert und machte André Vorwürfe. "Ich konnte nicht anders", erwiderte der. "Ich musste das Kruzifix der Rohheit dieser Menschen entreißen, das war mir die zehn Franken wert."
"Unsinn! Aber zeig doch mal deinen Kauf her." André gab es ihm. "Mordsschwer!" Er wischte mit den Fingern ein paarmal am Sockel entlang und stutzte.
"Komm, lass uns zu jemand gehen, der das Kreuz zu beurteilen weiß", forderte André.
André suchte sofort einen Kunsthändler auf und legte ihm das bleischwere Kruzifix vor. Auch der Kunsthändler wischte kräftig mit einem Tuch am Sockel herum, ging sodann in seinen Arbeitsraum, und als er nach einer Viertelstunde wieder in den Laden zurückkehrte, hielt er in seiner Hand ein Kruzifix aus hell glänzendem Gold. "Herr Rosin!" rief er, "Sie haben unerhörtes Glück gehabt! Das Stück ist aus massivem Gold und schon allein darum seine 50.000 Franken wert. Und dann, sehen Sie hier!" Er zeigte auf den Sockel.
"BENVENUTO CELLINI", las André die eingravierte Inschrift.
"Das war ein berühmter Bildhauer und Goldschmied aus Italien", erklärte der Händler. "Er hat für die Päpste in Rom gearbeitet, für den Adel in Florenz und sogar für König Franz I. Sein Name macht dieses Kunstwerk um mindestens 10.000 Franken wertvoller. Soll ich versuchen, es für Sie zu verkaufen?"
André willigte ein, ging zurück zu seiner Arbeit und wartete ab. Seine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Fast ein halbes Jahr verging, hundertachtzig Tage, bevor der Händler einen Käufer fand, der gewillt war, die verlangten 60.000 Franken auf den Tisch zu legen.
Damit war André ein reicher Mann. Er hätte kaufen können, was er wollte, Reisen unternehmen, Feste feiern, kurz, so üppig leben, wie er nur Lust hatte, und an Versuchung war gewiss kein Mangel, zumal nicht in Paris, der Stadt der Lebensfreude.
Doch Gott hatte gewusst, wem er diesen großen Schatz in die Hand legte. André Rosin folgte dem Wunsch seines Herzens und wurde Priester.
Aus "Glaube und Leben", Mainz 1955
________________________________________________________________________

24. Von Allah zu Christus
Von J. A. Mohammed Husain, aus "Ecclesia", Paris 1955
Als ich Allah für immer entsagt hatte, begann ich, nach einem anderen inneren Halt zu suchen. Zuerst begeisterte ich mich für Philosophie und studierte ganz besonders Kant. Die unbestimmte Vorstellung, die ich mir von Gott machte, erhellte sich mehr und mehr. Manchmal glaubte ich, er müsse Allah gleichen, und wollte schon zu meinen mohammedanischen Freunden laufen, um ihnen zu sagen, dass ich Ihn gefunden hätte. Dann aber sah ich davon ab, da ich dachte, dass mein neuer Gott sie ja doch nicht interessieren würde.
Das Studium der englischen Literatur ließ mich das Leben eines Volkes kennenlernen, dessen Geschick nicht durch Allah beeinflusst worden ist. Die Atmosphäre schien vom Hauch eines anderen Gottes erfüllt zu sein. Die natürliche, ungekünstelte Lebensweise des Landes kannte den despotischen Zwang Allahs nicht. Das Privatleben beruhte auf den Grundsätzen der unauflöslichen Verbindung in der Einehe, einem Ideal der Liebe und des Glückes, das man in mohammedanischen Häusern nicht kannte.
Das Familienleben und die allgemeinen Sitten im Umgang mit den Mitmenschen bewiesen Nächstenliebe und Brüderlichkeit. Das erweckte in mir den Wunsch, diese Gesellschaft näher kennenzulernen.
Zu meiner Überraschung wurde einer meiner Freunde Christ, und zwar Protestant. Von da an interessierte auch ich mich für das Christentum. Mein Freund befasste sich insbesondere mit dem Leben unseres Herrn. Immer wieder wiederholte er die Bergpredigt: "Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich . . . Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, und betet für die, die euch verfolgen und verleumden."
Diese Worte drangen mir tief in die Seele, und das Korn der Liebe Gottes begann darin zu keimen. Mein Freund erbot sich, mich einem Geistlichen vorzustellen, der einst ebenfalls Mohammedaner gewesen war. Seine Kenntnisse der mohammedanischen Theologie bewiesen mir, dass er ein großer Gelehrter war. Die Tatsache, dass ein so bedeutender Mann auf die Religion des Islam verzichtet hatte, um das Christentum anzunehmen, eröffnete mir einen ganz neuen Horizont. Das Christentum konnte keine gewöhnliche Religion sein. Ich musste mich nur anstrengen, es zu studieren.
Zu jener Zeit organisierte man Aussprachen zwischen mohammedanischen Gelehrten und christlichen Missionaren. Als Ergebnis dieser Aussprachen lernte ich einen ganz neuen Gottesbegriff kennen. Der christliche Gott hatte einen Sohn, der sich am Kreuz für mich geopfert hatte. Er war heilig und verabscheute die Sünde. Er liebte die Seelen aller Geschöpfe, mochten sie Christen oder Mohammedaner sein. Von Anfang an hatte er die Menschheit geliebt. Wer zu ihm ging, fand einen, der ihm seine Schmerzen tragen half. "Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken." Seine Gebote waren voller Sanftmut. Einen Gott am Kreuz, ein Gott, der leidet und der Mitleid bei den Menschen erweckt, war der neue Gott, der auch mich anzog. Die Missionare sprachen auch von der Menschwerdung, der Erlösung und der Dreifaltigkeit. Das waren Begriffe, die zu erfassen nicht leicht für mich war. Aber sie mussten die Wahrheit enthalten! Dieser neue Gott war von Allah völlig verschieden. War Jesus aber wahrer Gott, dann wurden mir auch Begriffe wie Dreifaltigkeit und Menschwerdung annehmbar. Diese Entdeckung hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in meiner Seele.
Noch lange danach entfernte ich mich jedes Mal, wenn mich ein Schmerz packte, von meinen Kameraden und las in der Bibel, besonders die Leidensgeschichte unseres Herrn, um daraus Stärke zu gewinnen. Nach meiner Heirat zog ich mich auch in der Familie öfters zu einem Gebet zurück. Insbesondere betete ich vor dem Schlafengehen das Vaterunser. Mitunter musste ich noch mit zum mohammedanischen Gottesdienst gehen. Ich sprach die Gebete zwar mit, aber im innersten Herzen richtete ich sie an unseren Herrn. Wieviel Freude gab mir mein neuer Gott, der von meiner früheren Gottesvorstellung so verschieden war!
Hier muss ich eine interessante Persönlichkeit erwähnen, die meinen Lebensweg kreuzte, als ich an der Universität studierte: Pater Stanley Jones, der als bedeutender Gelehrter galt. Mein oben erwähnter evangelischer Freund forderte mich auf, bei ihm zu hören. Seine gedankentiefen Vorlesungen rüttelten mich zutiefst auf. Er wies nach, dass keine geschichtliche Persönlichkeit unserem Herrn an Liebe und Güte gleichkomme. Am Schluss seiner Vorlesungen erklärte ich ihm, dass er mein inneres Leben endgültig gewandelt habe. Ich besuchte ihn allein. Seit diesem Gespräch denke ich mit größter Bewunderung an ihn, der mir auch sagte, dass er die Inder sehr liebe.
Ich möchte hier an Gandhi erinnern, , der so oft Worte unseres Herrn angeführt hat. Wie oft in den Tagen seines passiven Feldzuges hat er sich auf die Bergpredigt berufen! Und wie ergreifend waren seine Anspielungen auf das Leiden unseres Herrn während der Bewegung des "zivilen Ungehorsams"! Der Gedanke, dass er starb, bevor er Christ wurde, hat mich immer betrübt.
Nach meiner Heirat kam ich in das südliche Indien, wo ich christliche Freunde fand, von denen einer Katholik war. Der Direktor des Hotels, in dem ich einige Zeit wohnte, besaß einen Rosenkranz und ein katholisches Gebetbuch. Ich glaube, es war um Ostern, als er mir vorschlug, einmal eine katholische Kirche zu besuchen. Wie merkwürdig kam mir alles vor! Brennende Kerzen und Schweigen, während der Priester am Altar betete. Tiefe Andacht ergriff mich.
Kurz danach musste ich ins Krankenhaus. Der diensttuende Arzt war während der Visite von einer Klosterschwester begleitet, die ganz in weiß gekleidet war und auch auf dem Kopf eine weiße Haube trug. An ihrer Seite hing ein langer Rosenkranz. Wie war es möglich, dass man in unserer modernen Zeit noch eine solch mittelalterliche Gestalt antraf? Ein Duft vergangener Jahrhunderte kam zu mir. Ich dachte an die Klöster, in denen fromme Nonnen wohnten und das Lob des Herrn sangen, und erinnerte mich an das, was ich in der "Ewigen Stadt" von Hall Caine gelesen hatte. Ich hatte mich ganz mit der Heldin des Buches identifiziert, so dass ich einmal sogar darüber weinte. Ihr "Ave Maria" war eine heilige Erinnerung für mich geworden. Nun war auf einmal eine solche Schwester, eine Personifikation der Reinheit und Liebe aus vergangenen Jahrhunderten, vor mir aufgetaucht. Wie hätte ich da schweigen können?
"Sie sind römisch-katholisch, Schwester?"
"Natürlich", antwortete sie.
"Die Katholiken beten doch Maria an, nicht wahr?"
"Nein! Sie verehren sie nur."
"Und warum tun sie das?"
"Weil sie die Mutter Jesu ist."
"Ja, das stimmt. Wie könnte es auch anders sein! Und sind Sie glücklich mit Ihrem Leben?"
"Ja, ich bin glücklich!"
Das sah man ihr auch an. Nun wollte ich mich über den katholischen Glauben orientieren. Man gab mir ein apologetisches Werk. Der Verfasser wies nach, dass Christus seine Kirche auf Petrus, den Felsen, gegründet hatte und dass die katholische Kirche diese Kirche ist. Das überzeugte mich. Welch eine neue Entdeckung für mich! Und diese Kirche war für den Christen notwendig! Die Heiligkeit der christlichen Religion konnte nur in einer Kirche blühen. Bis jetzt hatte ich den Herrn nur in der Einsamkeit und Isolierung geliebt. Jetzt aber tat sich mir der Trost einer ganzen himmlischen Gesellschaft auf. Die Schwester gab mir das Leben der kleinen Theresia zum Lesen. Die "Kleine Blume" entzündete in mir das Feuer der Liebe. Christus bis zur Aufopferung zu lieben, bis zur Vernichtung des Selbst, bis zum völligen Vergessen der Welt, das war wirklich ein gewaltiges Leben!
Viele Monate vergingen. Eines Tages richtete ich zufällig meinen Blick auf eine Statue des hl. Sebastian. Der Pfeil, der in seiner Seite steckte, schien auch mich zu durchbohren. Ein anderes Mal ergriff mich beim Besuch einer Kirche und dem Anblick unseres Herrn am Kreuz ein solches Mitleid, dass ich mich fast nicht mehr rühren konnte. Und wieder einmal hörte ich, wie man den Rosenkranz betete, und wurde vom Verlangen ergriffen, mich dem Chor der Beter anzuschließen. Kurz darauf betrat ich eine Kirche gerade in dem Augenblick, als man die heilige Kommunion austeilte. Man hätte meinen können, unser Herr hätte mich vom Altar aus angezogen. In dieser Stimmung beschloss ich, von nun an wie ein Katholik zu leben, obwohl ich der Kirche noch gar nicht angehörte.
Mit diesem Wunsch im Herzen stellte ich mich dem Geistlichen dieser Kirche vor und erbat mir ein Kreuzchen, um es bei mir zu tragen. Der Priester war sehr freundlich zu mir. Von diesem Augenblick an begann ich, regelmäßig zu beten und mich in allem an unseren Herrn zu wenden.
Ein Pater machte mir den Vorschlag, mich taufen zu lassen. Mit Ungeduld erwartete ich den Tag, an dem ich Christ würde. Ich erzählte meiner Frau und meinen Kindern davon. Sie waren ebenfalls bereit, sich taufen zu lassen. Ich schickte die Kinder in eine katholische Schule. Dann begann ich mich ernstlich auf die Taufe vorzubereiten, und betete allabendlich mit den Kindern.
Im Laufe der religiösen Unterweisung schien es mir, dass sich manche Probleme des Islam, über die ich lange nachgedacht hatte, von allein lösten. Vieles war nur eine unvollkommene Nachahmung christlicher Einrichtungen. An ihre Stelle trat nun die Wahrheit. Dieser Wechsel ging wie selbstverständlich vor sich. Der Islam erschien mir wie ein falscher Edelstein, an dessen Stelle nun der reine Diamant, der wahre Glaube, trat.
Die Tage vergingen, und ich fing an, Angst vor dem Kommenden zu bekommen. Die Taufe war keine Kleinigkeit für mich. Der Geist war willig, aber das Fleisch war schwach. Doch der Herr flüsterte mir jeden Tag zu: "Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer es verliert, wird es finden." In diesen Tagen half mir eine Frau mit ihrem Gebet. So gab ich mich entschlossen in die Hände Gottes. Ich musste mich einfach taufen lassen, ganz gleich, was auf mich wartete! Ich wollte alles dem Herrn aufopfern.
Dann kam der Tag, an dem der Pater mir die Tore der Kirche öffnete und ich das Sakrament der Taufe empfing. Kurze Zeit darauf folgten meine Frau und meine Kinder nach.
________________________________________________________________________

hl. Adele
25. Interessantes über die Äbtissin in der Geschichte
Die Wahl und Ordination der Äbtissin
Die Bezeichnung Abbatissa stammt von dem syrischen Wort Abba ab und ist wahrscheinlich durch die Regel des heiligen Benedikt eingeführt worden. Wie der Vorsteher der Genossenschaft mehrerer Männerklöster Abt genannt wurde, so legte man der Vorsteherin der Frauenklöster den Namen Abbatissa oder Äbtissin bei. Das erste Beispiel sehen wir beim Konzil von Arles im Jahr 554, wo im 5. Canon der Äbtissin verboten wird, etwas gegen die Ordensregel zu unternehmen. (Nec Abbatissae ejus monasterii aliquid liceat, contra regulam facere. - Auch ist es der Äbtissin dieses Klosters nicht erlaubt, etwas gegen die Regel zu tun.) Mit der Regel des heiligen Benedikt verbreitete sich auch dieser Titel in der lateinischen Kirche und dehnte sich später auf die anderen Orden aus.
Wie die ersten Klöster ganz unter der Leitung und Jurisdiktion (Gerichtsbarkeit) des Bischofs standen, so setzte dieser auch den Obern oder die Oberin eines Klosters ein. Die Regel des heiligen Benedikt sicherte aber den Gliedern des Klosters die freie Wahl, die auch von den Synoden und durch die Kapitularien bestätigt wurde. (Abatissa a cunta congregatione eligatur. - Die Äbtissin wird von der gesamten Gemeinde gewählt.) Nach der Wahl musste die Neugewählte dem Bischof, in dessen Sprengel das Kloster lag, vorgestellt werden, der sie im Vorsteheramt bestätigte.
In England blieb den Bischöfen insoweit das frühere Recht, dass sie mit den Gliedern des Klosters zugleich die Äbtissin einzusetzen hatten, so dass weder ein Kloster ohne den Bischof, noch ein Bischof ohne das Kloster eine Äbtissin anordnen konnte.
Nicht jede Kandidatin erkannte man als wahlfähig und zum Äbtissinnenamt tauglich. Die zu Wählende musste zuvor eine Zeitlang Mitglied der Genossenschaft und des Klosters gewesen sein, nach der Verfügung Gregors I. vierzig, oder nach dem Dekret Innozenz IV. doch wenigstens dreißig Jahre alt sein, im Übrigen aber nach der Vorschrift des Konzils von Aachen im Jahr 816 allen anderen an Tugend, Weisheit und Keuschheit vorangehen. Das Generalkonzil von Trient erneuerte diese kirchlichen Vorschriften. Im 7. Kapitel der 25. Sitzung schreibt es vor: „Zu einer Äbtissin oder wie immer die Vorsteher oder Vorsteherinnen heißen, soll keine jünger als vierzig Jahre, erwählt werden, und nachdem sie acht Jahre nach abgelegter Profession tadellos gelebt hat. Wenn in demselben Kloster keine mit diesen Eigenschaften vorgefunden wird, so kann sie aus einem anderen ebendesselben Ordens genommen werden. Wofern aber auch dieses dem Obern, der die Wahl leitet, unpasslich scheint, so werde mit Einstimmung des Bischofs oder des andern Obern eine aus denjenigen, welche in demselben Kloster das dreißigste Jahr zurückgelegt, und wenigstens fünf Jahre nach der Profession ordentlich gewandelt habe, erwählt.“
Vor dem Antritt ihres Amtes empfing die neue Äbtissin vom Bischof die Benediktion, die in den alten Ritualbüchern auch Ordination und Konsekration genannt wird und wahrscheinlich von der alten Diakonissen-Ordination ihre Ableitung hat. Wir wissen, dass im 5. und 6. Jahrhundert von mehreren Synoden in Frankreich verboten wurde, Diakonissen zu ordinieren. Dagegen finden wir gerade in diesem Land und zu gleicher Zeit die erste Spur der Äbtissinnenordination. Die heilige Radegund, die Stifterin des Klosters zu Poitiers, bemerkt in ihrem Schreiben an die Bischöfe, die beim König Gunthram waren, dass ihre Schwester Agnes durch die Benediktion des Bischofs German von Paris als Äbtissin des Klosters konsekriert worden sei. Gregor I. erkannte schon die Allgemeinheit dieses Gebrauches in dem Brief an die Äbtissin Thalassia und in einem andern an die Äbtissin Respecta, in denen er befiehlt, dass nach ihrem Tod von der Klostergemeinde gleich eine Nachfolgerin gewählt und vom Bischof ordiniert werden sollte.
Diese Ordination wurde somit ein ausschließliches Recht für die Bischöfe, das sich kein einfacher Priester aneignen durfte. In den Kapiteln Theodors von Canterbury wird allerdings gesagt: „Presbyter potest Abbatissam consecrare cum Missae celebratione. - Ein Priester kann die Äbtissin bei der Feier der Messe weihen.“ Nach der Vorschrift eines alten Pontifikalbuches von Sens sollen bei der Ordinationsfeier einer Äbtissin noch zwei oder drei Äbtissinnen anderer Klöster gegenwärtig sein. Diese Vorschrift scheint nicht allgemein gewesen zu sein, indem die anderen Ritualbücher davon schweigen.
Nach dem alten gallikanischen Ritus bestand die Ordination in einer einfachen Benediktion oder in einem Gebet über die Äbtissin, das so beginnt: „Omnipotens domine Deus, apud quem non est discretio sexuum etc. - Allmächtiger Gott, bei dem es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt etc.“ Später setzte man noch mehrere Gebete hinzu. Am Schluss wurde ihr die Ordensregel unter der Gebetsformel überreicht: „Nimm die Richtschnur des heiligen Wandels und zugleich die Gnade des göttlichen Segens, damit du durch diese einst am Tag des Gerichtes mit der dir anvertrauten Herde Gott dem Herrn unbefleckt vorgestellt werden mögest. Er helfe dir, der mit Gott dem Vater in Einigkeit des heiligen Geistes lebt und regiert in alle Ewigkeit.“
Sie erhielten auch einen Stab unter der Formel: „Nimm den Stab des Hirtenamtes, den du deiner Gemeinde zum Zeichen der Gerechten Strenge und Korrektion vortragen sollst.“ – In dem alten römischen Ordo wird noch eine Handauflegung mit einem großen Gebet oder Präfation vorgeschrieben. Nach dem bis ins 20. Jahrhundert, im römischen Pontifikal vorgeschriebenen, Ritus muss die Neugewählte zuerst einen Eid in die Hände des Bischofs schriftlich und mündlich, in Gegenwart der ältesten Mitglieder des Klosters ablegen. Der Eid lautete: „Ich, die künftige Äbtissin des Klosters … verspreche vor Gott und seinen Heiligen, und vor dieser feierlichen Versammlung der Schwestern Treue, gebührende Unterwerfung, Gehorsam und Ehrfurcht, meiner Mutter der heiligen Kirche, dir … meinem Herrn, Bischof dieser Kirche und Nachfolgern, gemäß den Anordnungen der kirchlichen Satzungen und wie es die unverletzliche Autorität der römischen Päpste befiehlt.“ Hierauf wird vom Bischof die Litanei angestimmt und danach die Benediktion vorgenommen, wobei er beide Hände über das Haupt der Neugewählten ausgestreckt hält. Dies geschieht nach der Epistel vor dem Evangelium, wo ihr auch zugleich die Ordensregel, aber kein Stab überreicht wird. Am Schluss der heiligen Messe wird die Ordinierte vom Bischof inthronisiert: „Accipe plenam et liberam potestatem regendi hoc monasterium et congregationem ejus et omnia quae ad ejus regimen interius et exterius, spiritualiter et temporaliter, pertinere cognoscuntur. - Erhalten Sie die volle und freie Macht, dieses Kloster und seine Kongregation zu leiten und alles, was bekanntermaßen mit seiner Leitung zu tun hat, sowohl intern als auch extern, spirituell und zeitlich.“
Von den geistlichen Privilegien der Äbtissinnen
Aus der oben angeführten Inthronisationsformel ist eine von der Kirche den Äbtissinnen übertragene geistliche Gerichtsbarkeit zu schließen. In dieser Formel wird ihnen nicht nur die äußere und temporelle, sondern auch die innere und spirituelle oder geistliche Regierung, eine volle und freie Macht übergeben. In der Darreichungsformel der Ordensregel liegen ähnliche Hinweise für eine geistliche Gerichtsbarkeit über die Untergebenen. Die Worte: „ad regendum custodiendumque Gregem tibi a Deo commissum . . . accipe gregis Domini maternam providentiam et animarum procurationem - eine dir von Gott anvertraute Herde zu regieren und zu bewahren. . . nimm die mütterliche Vorsehung der Herde des Herrn und die Sorge um die Seelen an“ genommen im gewöhnlichen Kirchensinn, begreifen mehr in sich, als die Übertragung eines einfachen Vorsteheramtes, dessen Privilegien aus dem natürlichen Recht der Eltern über ihre Kinder entspringen. Wie weit sich aber diese geistliche Gerichtsbarkeit erstrecken könne, und aus welcher Quelle sie abzuleiten sei, soll hier nicht erörtert werden. Gewiss ist es, dass sie nicht aus dem von Christus, dem Hirten der Kirche, verliehenen göttlichen Recht entspringen kann, und daher diese Gerichtsbarkeit nichts in sich fasst, was nur aus diesem Schlüsselrecht fließt. Doch gibt es auch die Meinung, die Päpste könnten aus ihrer Machtvollkommenheit sich der Äbtissinnen als Instrumente und Werkzeuge bedienen, gewisse Punkte höherer Gerichtsbarkeit in Vollzug zu setzen. Auf solche Weise übe eine Äbtissin amtlicher Weise die geistliche Jurisdiktion.
Dies gewinnt einen Anschein dadurch, dass nicht alle Äbtissinnen gleich ausgedehnte Jurisdiktion hatten. Besonders merkwürdig waren die Äbtissinnen zu Burgos in Spanien, zu Ebraldsbrunnen in Frankreich, zu Lucia in Italien, zu Quedlinburg in Deutschland usw. Die Äbtissin zu Burgos, die das Haupt der ganzen Frauengenossenschaft des Zisterzienserordens war, hatte gleichsam eine Art bischöflicher Jurisdiktion in ihrem Territorium. Sie konnte nicht nur das Investiturrecht ausüben, sondern auch die von den Examinatoren als fähig befundenen Geistlichen, als Seelsorger und Beichtväter anstellen und ihnen die Gewalt, zu predigen, erteilen. – Die Äbtissin von Lucia wurde wegen ihrer großen Macht „Episcopa“, die Bischöfin genannt. – Die Äbtissin von Ebraldsbrunnen, die ebenfalls das Haupt der ganzen Kongregation war, befahl so den Priestern wie den Nonnen ihrer Kongregation. – Die Äbtissin von Quedlinburg entsetzte die Benefikaten ihrer Pfründen und übte so eine gewisse Art geistlicher Suspension aus. Papst Honorius unterstützte sie in diesem Vorrecht und schrieb an den Abt von St. Michelstein: „quatenus dictas Canonicas et Clericos, ut Abbatissae suae praefatae obedientiam et reverentiam debitam impendentes ejus salubria monita et mandata observent, ecclesiastica censura compellat. - damit sich die kirchliche Zensur an diejenigen wendet, die den Kanonikern und Geistlichen drohen, dass sie den vorgenannten Gehorsam und die Ehrfurcht gegenüber ihrer Äbtissin beachten, die ihre gesunden Ermahnungen und Gebote bedrohen.“ Aus der Synode von Magdeburg, in der der Streit zwischen den beiden Äbtissinnen Sophia, Prinzessin von Dänemark, und Berthradis von Croseck geschlichtet wird, können wir noch mehrere Bestandteile der geistlichen Gerichtsbarkeit erkennen. Ähnliche Privilegien hatten die freiadeligen Stifter Thoren und Herford.
Wir dürfen uns auch nicht verwundern, wenn wir Äbtissinnen auf den Synoden erblicken. Sie erschienen bald als großmächtige Reichsstände, bald als Häupter der Genossenschaften, die einen ansehnlichen Teil der Provinz ausmachten. Im 8. Jahrhundert treffen wir Äbtissinnen beim Konzil Bacancelde in England. Beim Konzil zu Nidden führt die Äbtissin Aelfleda das Wort gegen die Bischöfe. In Deutschland erschien nach dem Bericht des Tritheim die Äbtissin Rotrud von Ehrenstein auf dem im Jahr 895 gehaltenen Konzil zu Tribur. Bischof Lambert von Arras erteilte sogar der Äbtissin Guisendis von Maubeuge das Patronatsrecht zu Herem, unter der Bedingung, dass sie zu den Synoden von Arras kommen solle. „Concedimus tibi altare de Herem, hac interposita conditione, quatenus ad Synodum Atrebatensem advenias ita et succedentes tibi Abbatissae, nisi cum licentia Episcopi remanseritis aut canonica et synodali excusatione. - Wir gewähren Ihnen von hier aus einen Altar, nachdem diese Bedingung erfüllt wurde, dass Sie zur Synode von Artois kommen und Ihnen, der Äbtissin, nachfolgen, es sei denn, Sie bleiben mit der Erlaubnis des Bischofs oder durch eine kanonische und synodale Entschuldigung.“
Einige Beispiele
Als unter Karl dem Großen die adeligen Nonnenklöster in Frankreich und Deutschland festen Fuß gefasst und sich ausgebreitet hatten, begann auch das entsprechende Wirken der Äbtissinnen. Die ihnen verliehene Gerichtsbarkeit und Lehnherrschaft stärkte ihr Selbstbewusstsein derart, dass sie so viel Einfluss in der Kirche gewannen, Ausspenderinnen der Geheimnisse Gottes und Vorgesetzte der Priester zu sein. Es war üblich, dass sie vor ihren Untergebenen die Predigt hielten, sie segneten und ihnen die heilige Kommunion reichten. Sie waren sogar so weit ermutigt und befähigt, Priestern die feierliche Benediktion zu erteilen, ihre Hände über sie zu legen und das heilige Sakrament der Firmung zu spenden, den Jungfrauen in Gegenwart des legitimen Diözesanbischofs den heiligen Schleier anzulegen, Beichte zu hören, die Priester selbst mit Zensuren zu belegen und zu exkommunizieren. Weil sie geistlichgekrönte Häupter waren, rechneten sie sich nicht mehr unter die Frauen, denen der Apostel Anweisungen über das Verhalten in der Kirche gegeben hatte, sondern glaubten sich berechtigt, über die Auserwählten selbst zu gebieten und mit denen gleiche Rechte zu teilen, die als Bischöfe bestellt waren, die Kirche Gottes zu regieren.
Im Rückblick ist dies für manche eine unzulässige Grenzüberschreitung gewesen, ein Eingriff in das Heilige und Göttliche. Man sah ohnehin als warnendes Beispiel in der alten Kirche die Diakonissen, die sich scheinbar in heilige Sachen einmischten, die sie nichts angingen. Man erzählt, dass im Patriarchat zu Antiochien die Diakonissen, die zugleich Äbtissinnen der Nonnen waren, ihren Untergebenen das heilige Abendmahl dargebracht hätten: „In Patriarchatu Antiocheno Abbatissas Monialium, quae etiam Diaconissae erant, teste Bathebraco, subditis monialibus Eucharistiam porrexerunt. - Im Patriarchat von Antiochia dehnten Äbtissinnen von Nonnen, die auch Diakonissen waren, wie Bathebracus bezeugt, die Eucharistie auf Nonnen unter ihrer Kontrolle aus.“ Nach den Worten dieses Kapitulars spielten die Äbtissinnen also ganz vollkommen die Rolle der Bischöfe. Denn durch die Händeauflegung und die Bezeichnung des Hauptes mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes kann man entweder die heiligen Weihen oder auch die heilige Firmung verstehen. Klarer drückt der Zusatz: „cum benedictione sacerdotali - mit priesterlichem Segen“, die feierliche Konsekration der Klosterfrauen aus, die gemäß den Vorschriften nicht einmal den Priestern erlaubt war. Die Äbtissin von Burgos war im 13. Jahrhundert in der Lage und ermächtigt, einer ihrer Klosterfrauen in Gegenwart des Bischofs, der die Messe gehalten hatte, und des Königs und der Königin von Kastilien, öffentlich mit allen feierlichen Zeremonien den heiligen Schleier umzuhängen. Papst Innozenz IV. erließ allerdings deshalb an den Generalabt des ganzen Zisterzienserordens ein sehr ernsthaftes Schreiben, in dem er befahl, diesen Missbrauch zu beheben, unter Androhung schwerer Strafen.
Es ist sicher nicht so, dass die Äbtissin von Burgos sich auf ein altes Recht oder auf eine alte Gewohnheit stützte, aber im 9. Jahrhundert war dieser Gebrauch in einigen Gegenden schon so allgemein, dass man gleichsam ein Recht daraus machte. Die 6. Synode von Paris sagt, dass beinahe in allen Klöstern einige Nonnen sich befänden, die von den Äbtissinnen den heiligen Schleier empfangen hätten, ohne dass die Bischöfe diese scheinbaren Eingriffe in ihre Privilegien gerügt oder bestraft hätten. „Paene in omnibus monasteriis puellaribus hujusmodi velatas invenies. - Sie finden diese Art von Empfang des Schleiers in fast allen Frauenklöstern.“ Über die Gründe, warum die Nonnen lieber von ihrer Äbtissin als von ihrem Bischof den Schleier empfingen, lohnt es sich nachzudenken.
Die Äbtissin von Burgos gibt aber noch ein weiteres Beispiel. Sie hörte die Beichten ihrer untergebenen Nonnen, gab ihnen den Segen und hielt, nachdem sie zuvor eine Lektion aus dem Evangelium vorgelesen hatte, eine Predigt. Dies geschah auch bei anderen Äbtissinnen. „Nova quaedam nostris sunt auribus intimata, quod Abbatissae moniales proprias benedicunt, ipsarum quoque confessiones in criminibus audiunt, et legentes evangelium praesumunt publice praedicare.“ Es ist jedoch zu verstehen, wie die Äbtissinnen auf diese Wege kommen konnten. In einigen alten Mönchsregeln wird den Untergebenen anbefohlen, dreimal am Tag ein Bekenntnis ihrer Missetaten und Vergehen ihrem Obern oder ihrer Oberin abzulegen. Diese Vorschrift, die gewiss einen heiligen Zweck hatte, führten die Oberinnen dahin, dass sie meinten, sie können, wie die Priester, das Sakrament der Buße verwalten. So hörten sie Beichte, legten eine Pönitenz auf und erteilten die Lossprechung. Nach der Regel des heiligen Basilius wird der Äbtissin gestattet, mit dem Priester die Beichten der Nonnen zu hören. Verwunderlich ist, dass hierüber noch ein Patriarch von Alexandrien Zweifel haben konnte. Markus fragte nämlich beim griechischen Rechtgelehrten und Chartophilar der Kirche zu Konstantinopel Balsamon an, ob man den Äbtissinnen, wenn sie die Genehmigung Beichte zu hören, beim Bischof beantragten, sie erteilen soll. Balsamon antwortete: „Nein.“ Es war indessen noch eine gewisse Art von Bescheidenheit, dass die orientalischen Äbtissinnen um die Genehmigung baten, was wir von den abendländischen Äbtissinnen nicht wissen.
Die Geschichte kennt auch ein Beispiel, dass sogar ein hochangesehener Mann bei einer Klosterfrau sein Sündenbekenntnis abgelegt hat. Thomas Cantipratanus erzählt vom Grafen Ludwig von Lüttich, dass er mit vielen Tränen der Nonne Christin im St. Katharinakloster bei Lüttich, seine Sünden bekannt habe. Thomas setzt aber fast entschuldigend hinzu, der Graf habe dies nicht getan, um durch die Klosterfrau Christin von seinen Sünden losgesprochen zu werden, sondern damit sie bewegt würde, für ihn zu beten. „Hoc quidem non pro indulgentia, quam dare non potuit, sed ut magis ad orandam pro se, tali piaculo moveretur. - Dies war freilich nicht wegen des Nachlasses, den er nicht geben konnte, sondern um durch eine solche Sühne eher dazu bewegt zu werden, für sich selbst zu beten.“ Der Kardinal Jakob von Vitriako berichtet, dass viele Personen zu dieser Nonne ihre Zuflucht genommen und bei ihr gebeichtet hätten, weil sie die Gabe hatte, auch die vergessenen Sünden aufzudecken: „Aliqua faemina a Domino te certissime probante tantam gratiam accepit, ut peccata hominum, quae per veram confessionem detecta non erant, in multis personis perciperet. Et dum multis peccata oblita nuntiaret, multos ad confessionem invitans, causa salutis eorum apud Deum extitit. - Eine Frau erhielt so große Gnade vom Herrn, ganz gewiss mit deiner Zustimmung, dass sie bei vielen Menschen die Sünden der Menschen wahrnahm, die durch die wahre Beichte nicht offenbart wurden. Und während er viele Sünden vergessen hatte und dies verkündete, indem er viele zur Beichte aufforderte, kam die Ursache ihrer Errettung bei Gott.“
Bei den gehaltenen Predigten der Äbtissin von Burgos ist leider kein Beispiel erhalten geblieben. Sie können also auch nicht beurteilt werden. Sie waren aber gewiss mehr als bloße Ermahnungen einer Oberin an ihre Untergebenen. Wahrscheinlich wurden sie in der Kirche öffentlich gehalten. Dies anzunehmen, berechtigen uns die Worte des päpstlichen Schreibens: „Legentes evangelium praesumunt publice praedicare. - Diejenigen, die das Evangelium lesen, maßen sich an, es öffentlich zu predigen.“ Die Äbtissinnen lasen also zuvor einen Abschnitt aus dem Evangelium vor und fingen dann an, öffentlich, also in der Kirche nach der Art der öffentlichen Prediger, zu reden oder zu predigen. Der Papst würde es sicher nicht gerügt haben, wenn sie ihre geistlichen Ermahnungen bloß auf ihre Untergebenen beschränkt und innerhalb des Klosters gehalten hätten. Das haben alle frommen Vorsteherinnen getan und es zu tun, ist ihre Pflicht. Aber diese damaligen Äbtissinnen traten öffentlich auf als Prediger des Evangeliums, und das war etwas ganz neues in der katholischen Kirche, was leider in späteren Zeiten wieder ganz in Vergessenheit geraten ist.
In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert die Lebensgeschichte des seligen Robert von Arbrissel, in der Hersenda von Champagne genannt wird, die 1. Äbtissin von Fontevrauld. Robert war Priester und Stifter des Ordens von Fontevrauld, auch „Apostel der Bretagne“ genannt, + 25.2.1117 – Fest: 25. Februar.
Robert, mit dem Beinamen von Arbrisselles, seinem Geburtsort, einem Dorf in der Diözese von Rennes, wurde von seinen Eltern, die reicher waren an Tugenden, als an irdischen Gütern, in der Frömmigkeit erzogen. In Bretagne legte er den ersten Grund zu seinen Studien und vollendete sie zu Paris, wo er das Doktorat der Theologie erhielt. Hiermit wurde er Erzpriester, Generalvikar von Rennes und Kanzler des Herzogs von Bretagne. Und diese Ämter verwaltete er mit großer Erbauung und mit aller Gewandtheit. Allein bald verließ er sie, um den frommen Wandel der alten Einsiedler in dem Forst Craon, in Anjou, wieder in das Leben zurückzurufen. Da sein Ruf eine große Anzahl Schüler zu ihm hinzog, ließ er ihnen ein Kloster bauen, und führte bei ihnen die Regel der regulierten Chorherren ein.
Papst Urban II., der wegen eines Kreuzzugs nach Frankreich kam, und in Angers verweilte, um die Abteikirche zum heiligen Nikolaus einzuweihen, wollte einen Mann kennenlernen, von dem der Ruf so viel Wunderbares verbreitete. An dem Tag dieser Feierlichkeit hörte er ihn predigen, und zwar mit solcher Zufriedenheit, dass er ihm den Titel eines apostolischen Missionars erteilte, neben der Vollmacht, überall das Evangelium zu verkünden. Die herrlichen Wirkungen, die die Vorträge des gottseligen Robert hervorbrachten, sind nicht mit Worten zu beschreiben. Er bekehrte unzählige Seelen, an allen Orten, wo er Gelegenheit hatte, sein Predigtamt auszuüben.
Im Jahr 1099 stiftete er das Kloster von Fontevrauld, eine Meile von der Loire, in der Diözese Poitiers. Es begriff zwei voneinander getrennte Gebäude, eins für Männer, und das andere für Frauen. Jedoch standen auch die Männer unter der Gerichtsbarkeit der Äbtissin, die die allgemeine Aufsicht über den ganzen Orden hatte. Seine Absicht war, durch diese Einrichtung die allerseligste Jungfrau zu ehren, die von Jesus am Kreuz dem heiligen Johannes, der durch diese Ordensmänner dargestellt werden sollte, als Mutter gegeben wurde. Unter allen Klosterregeln zog er die des heiligen Benedikt vor als die für seine Genossenschaft geeignetste. Er untersagte seinen Schülern den Gebrauch des Fleisches, auch selbst in Krankheiten, und gebot ihnen aufs Strengste das Stillschweigen. Die Klausur musste immer vollkommen beobachtet werden. Die Priester durften nicht in das Krankenzimmer zu den Nonnen. Und wenn eine von diesen krank wurde, trug man sie in die Kirche, wo sie dann die heiligen Sakramente empfing. Hersenda von Champagne, Mutter des Herzogs von Bretagne, war die erste Äbtissin von Fontevrauld. Dieser gab der heilige Stifter zur Gehilfin, Petronilla von Craon, Fräulein von Chemillé.
Robert fuhr indessen fort mit seinem gewöhnlichen Eifer zu predigen. Er war das Werkzeug, dessen sich Gott bediente, um die Bekehrung der Königin Bertrada zu bewirken, die ihren Gemahl verlassen hatte, um Philipp I., König von Frankreich, zu heiraten. (Bertrada war die Tochter Simons von Montfort und Schwester Amaurys von Montfort, des Grafen von Evreux. Im Jahr 1092 verließ sie Julio, den Grafen von Anjou, ihren Gemahl, um Philipp I., den König von Frankreich zu heiraten. Papst Urban II. belegte diesen Fürsten, im Jahr 1094, wegen dieser ärgerlichen Verbindung, mit dem Bann. Philipp entließ Bertrada. Allein im Jahr 1100 nahm er sie wieder zu sich, wodurch er sich einen zweiten Kirchenbann zuzog. Bertrada befand sich in einem Schloss der Diözese Chartres, als sie den gottseligen Robert predigen hörte.) Diese Fürstin, gerührt durch die Reden des frommen Robert, entsagte für immer der trügerischen und verführerischen Welt und legte zu Fontevrauld das Gelübde ab, wo sie auf eine heilige Weise ihre übrigen Lebenstage zubrachte. Mehrere andere Prinzessinnen traten in denselben Orden, noch bei Lebzeit und nach dem Tod des heiligen Stifters.
Im Schaltjahr 1116, am 25. Februar starb der gottselige Robert im Kloster von Orsan in Berry, im siebzigsten Lebensjahr. Sein Leichnam wurde nach Fontevrauld gebracht. Im Jahr 1644 stellte der Bischof von Poitiers eine Untersuchung über mehrere Wunder an, die durch dessen Fürbitte gewirkt wurden. Man verehrte ihn nach seinem Tod unter dem Titel des seligen Robert. Auch findet man seinen Namen in den Litaneien seines Ordens. Er hat jedoch keine besondere Tagzeiten, und man liest an seinem Festtag eine Messe von der heiligen Dreieinigkeit.
(Man wollte den Namen des seligen Robert von Arbrisselles dadurch verdunkeln, dass man ihn beschuldigte, er habe ohne Unterschied allen das Ordenskleid gegeben, die ihn darum baten, und habe in zu vertraulichem Umgang mit den Klosterfrauen gelebt. Diese Beschuldigungen sind aus einem Brief des verrufenen Roscelin gezogen, dessen Irrtümer über die Dreieinigkeit das Konzil von Soissons, im Jahr 1095, verdammte. Es ist wahr, dass selbst mehrere rechtschaffene Männer gegen Robert von Arbrisselles, selbst noch bei seiner Lebzeit, eingenommen wurden. Unter anderen der Verfasser des Briefes, der Marbod, dem Bischof von Rennes, und dem Abt von Bendome, Godfried, zugeschrieben wird. Letzterer schrieb deshalb dem Diener Gottes selbst, denn es lässt sich wohl nicht bezweifeln, dass der Brief, der seinen Namen trägt, nicht auch wirklich von ihm sei. Allein alle Beschuldigungen, die man gegen Robert von Arbrisselles vorbringt, gründen sich nur auf Gerüchte, deren Falschheit leicht aufzudecken ist. Übrigens ist es nicht verwunderlich, dass ein Mann, der in so hohem Ansehen stand, Feinde hatte. Das Verdienst und besonders der Eifer entgehen nie den giftigen Pfeilen des Neides. Zu seiner Rechtfertigung ist schon hinreichend, dass er die Geißel des Lasters war, und selbst der vornehmsten Personen nicht schonte; dass er unablässig den verhärtetsten Sündern die Aussprüche des göttlichen Gesetzes entgegenrief; dass ihn alle, die ihn wahrhaft kannten, als einen heiligen Diener Gottes ansahen; und dass er wirklich mit den Gesinnungen der zärtlichsten Frömmigkeit starb. Godfried von Bendome erkannte auch endlich seinen Irrtum, und ließ Robert Gerechtigkeit widerfahren. Er wurde sogar sein Freund und sein Verteidiger. Er besuchte ihn oft zu Fontevrauld, wo er eine beträchtliche Stiftung machte, und ließ sich sogar dort ein Haus erbauen, damit er sich leichter und bequemer mit ihm unterhalten konnte, und mehr als einmal unterstützte er ihn in Ausführung seiner frommen Unternehmungen.)
________________________________________________________________________
 Marianisches
Marianisches






















